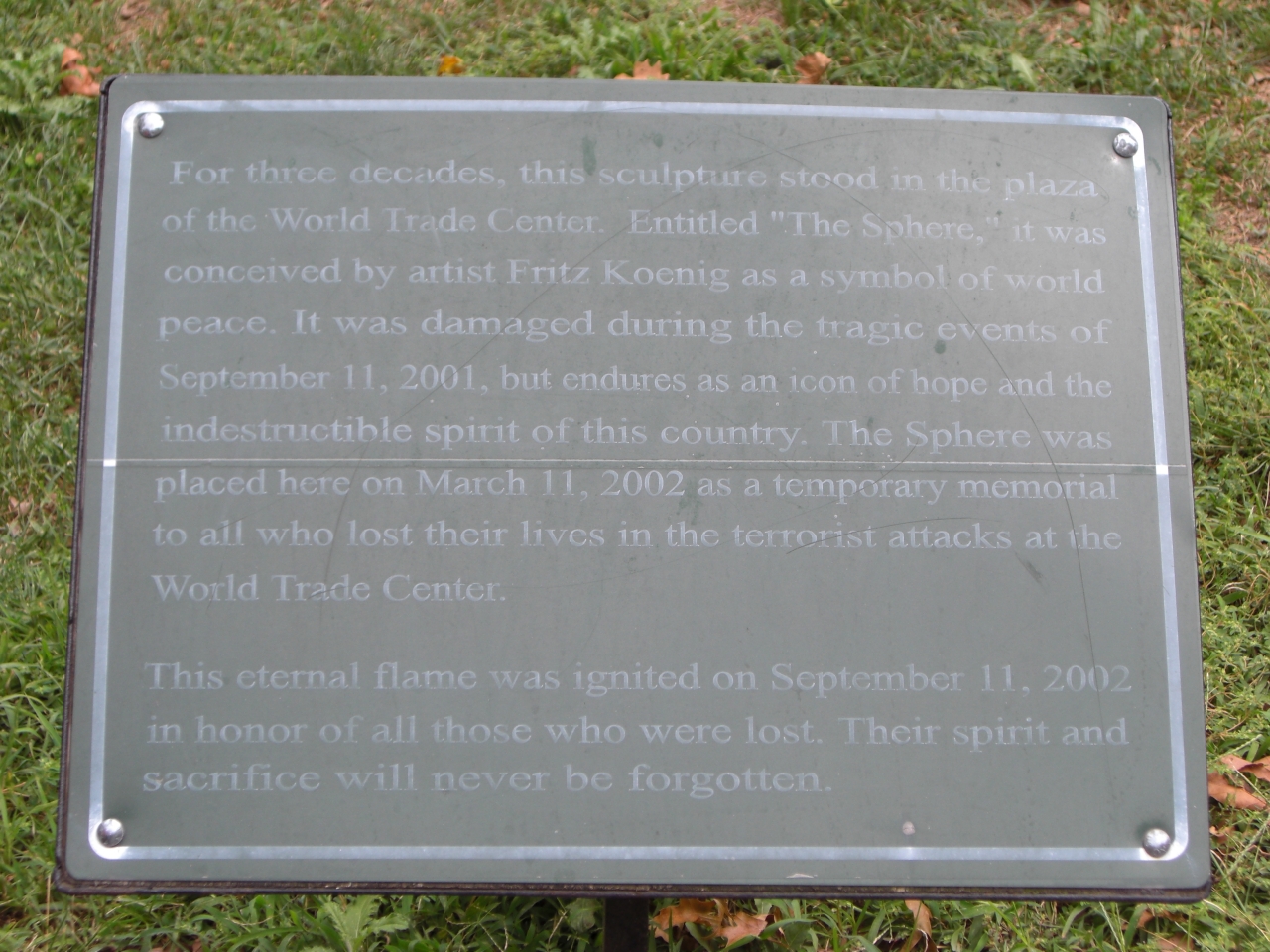Dies ist ein Beispiel einer statischen WordPress-Seite. Du kannst sie bearbeiten und beispielsweise Infos über dich oder das Weblog eingeben, damit die Leser wissen, woher du kommst und was du machst. Du kannst entweder beliebig viele Hauptseiten (wie diese hier) oder Unterseiten, die sich in der Hierachiestruktur den Hauptseiten unterordnen, anlegen. Du kannst sie auch alle innerhalb von WordPress ändern und verwalten.
Anna Krusch Buchenstr. 18 35745 Herborn Deutschland ak@annakrusch.de
Ein sanfter Beginn meiner großen Reise
Das erste Ziel meiner großen Reise: Montréal. 8 Stunden Flug, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt… aber im Zug habe ich diese Zeit ja schon öfter verbracht und in Bussen erst… allerdings muss ich mal wieder feststellen, dass ich doofe Ohren habe (bin ich eine Elfe?), denn schon nach dem ersten Film machen mir die Kopfhörer Schmerzen. Memo an mich: andere Kopfhörer kaufen. Kurz vor der Landung muss ich dann ein Einreiseformular ausfüllen. Natürlich trage ich mein Geburtsdatum erst einmal falsch ein und nicht wie gewünscht mit dem Jahr zuerst. Das kann auch nur mir passieren, denke ich und schaue nach links und rechts: doch nicht. Offensichtlich ein gerne genommener Fehler. Aber alles nicht weiter tragisch. Man lässt mich ins Land und die größte Hürde ist das ewige Schlangestehen. Dafür muss ich nicht mehr auf mein Gepäck warten. Begrüßt werde ich von meinem Bruder und einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Noch bevor wir im Bus sitzen habe ich das Gefühl schweißgebadet zu sein. Also erstmal zu Felix’ süßer Wohnung. Sehr niedlich auch die kleinen Treppen, die vor fast allen Häusern in den ersten Stock führen. Warum ich sie nicht fotografiert habe, ist mir schleierhaft (warum denke ich gerade zum ersten mal mal an den Zusammenhang von Ehe und „Schleier-Haft“?). Bei meinem Bruder buche ich die „kleine Stadtführung“, die uns zum Olympic Parc führt. Wow. Das Olympia-Stadion ist schon ein extrem cooles Gebäude. Wurde für die olympischen Spiele 1976 erbaut. Die Montréaler sind – wie ich später erfahre – keine so riesigen Fans, weil das Stadion im Unterhalt und wg. ständiger Renovierungen des Dachs (das konnte man früher mal öffnen), wohl nach wie vor Unmengen an Geld verschlingt. Aber ich bin Tourist. Mich darf es begeistern. Drumherum gibt es noch einen Botanischen Garten – der drittgrößte der Welt, nach London und Berlin – und den Biodome, im ehemaligen Velodrom. Aber für uns gibt es erstmal einen Kaffee. Abends dann leckeres Essen (man merkt einfach die Französischen Einflüsse…) und ich habe ein eher unschönes Erlebnis mit einem nicht mehr funktionierenden Tagesticket für die Öffentlichen Verkehrsmittel und einem Angestellten, der es wohl nicht so gut fand, dass ich ihn auf Englisch angesprochen habe. Das Problem habe ich nach wie vor nicht verstanden und kann es nur erahnen, aber Isabelle konnte es klären – naja zumindest hat er uns ein neues Ticket verkauft, was er zuerst auch nicht tun wollte – und ich beschließe, meine Taktik zu ändern: Erst mit meinen paar Brocken Französisch klar machen, dass ich nicht viel spreche und sie vor allem nicht verstehe, und dann – wenn mein Akzent geklärt ist – wenn notwendig auf Englisch weitermachen. Nach dieser kleinen Episode geht’s in eine typische Bar mit Live-Musik zum Mitsingen. Und das funktioniert sogar, wenn man die Sprache nicht versteht! Auffällig: die Kanadier teilen ihre Maß Bier. Sie nennen es „Pitcher“ und es ist eher eine schlichte Karaffe, als ein Krug. Dazu gibt’s Gläser und Bier ohne Schaum. Schmeckt aber gar nicht so übel und hilft erwiesenermaßen gegen Jetlag. Am Tag drauf erklimmen wir den „Mont Royal“. Den Hügel in Montréal. Von hier aus gibt es zwei sehr unterschiedliche Aussichten auf die Stadt. Welche gefällt euch besser? Ich bitte um euer Voting! Was mich wirklich erstaunt hat: Montréal hat eine extrem lebendige Unterwelt. Ok, bei den Temperaturen im Winter ist es nicht wirklich erstaunlich, dass ein großer Teil der Stadt untertunnelt ist und es dort riesige Einkaufszentren gibt. Man muss also nicht mal ans Tageslicht gehen, wenn man von der U-Bahn ins Büro oder zum Shoppen will. Es sei denn, man möchte auf den wunderschönen, ziemlich großen Markt, auf dem Bauern aus der Region Obst, Gemüse und vieles mehr verkaufen. Um diese Jahreszeit vor allem Maiskolben… selten so etwas leckeres gegessen mal abgesehen von dem Lachs, den es dazu gab! Alles in Allem ist Montréal ein sehr sanfter Start in meine große Reise. Nicht nur, weil Felix dort lebt, sondern auch und vor allem, weil es sich alles sehr vertraut anfühlt. Denn sieht man einmal davon ab, dass eine erstaunlich große Anzahl an Menschen Englisch spricht – und das auch noch ohne diesen lustig-süßen Akzent – könnte man meinen, man wäre in Frankreich. Wenn sich Europa verlassen so anfühlt, dann ist dieses Gefühl nicht der Rede wert, aber ich schätze, das wird sich noch ändern.
Genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich daran gewöhnen sollte, in Cafés und an anderen öffentlichen Orten den Computer auszupacken. Erstens macht es hier ohnehin jeder und zweitens gibt es Kaffee. Ich bin in einem gemütlichen, ziemlich alternativen Laden gelandet, der eine Mischung aus Café und vegetarischem Restaurant ist. „Sleepless Goat Café“. Aus Mangel an Ziegen hängen, hier aber überall Einhörner. Das verstehe, wer will. Hat mir gestern im Bus mein Sitznachbar empfohlen. Naja. Sitznachbar ist übertrieben. Er saß eigentlich einige Plätze entfernt, aber das ist den Kanadiern wohl egal. Wenn sie mal Menschen zu Gesicht bekommen, sprechen sie auch mit ihnen. Das würde zumindest die Theorie erklären, dass man von Landmenschen eher angesprochen wird, als von Stadtmenschen. Und so ist es auch kein Wunder, dass sich die Frau hinter mich gleich mit in das Gespräch eingeklinkt hat und die Fahrt ziemlich schnell vorbei ging. Eine ziemlich nette Eigenschaft, die mir auch beim Warten auf den örtlichen Bus gleich die Lebensgeschichte einer Angestellten, des örtlichen Busbahnhofs beschert hat, die während ihrer 14 Stunden-Schicht gerade eine Zigarettenpause machte. Ich bin gerade in Kingston/Ontario. Was ich hier tue? Bei meiner relativ planlosen Suche, was zwischen Ottawa und Toronto noch interessant sein könnte, wollte ich plötzlich die „Thousand Islands“ sehen. Hab ich auch. Also nicht alle. Glaub ich. Nachgezählt hab ich nicht. Aber jetzt hätte ich gern nen Salat mit dem entsprechenden Dressing… den scheint es hier allerdings gar nicht zu geben. Ich war auf einer dreistündigen Bootstour „Heart of the Thousand Islands“. Ziemlich schön. Verstehe gar nicht, warum das außer mir hauptsächlich Rentner und Asiaten gemacht haben. Jetzt will ich ne Insel. Mit einem kleinen Hutzelhäuschen drauf. Zusätzlich zu den Bienen und dem See. Obwohl ich mit der Linken Seite zur Sonne saß, hab ich auf der rechten Schulter jetzt dummerweise einen leichten Sonnebrand. Das war nicht mein Plan. Schließlich befindet sich all mein Hab und Gut in meinem Rucksack, der leider nicht wie ein Luftkissenboot knapp über meinen Schultern schwebt… also besser nicht mehr so viel draußen rumlaufen heute. Kingston ist nicht gerade Hauptreiseziel für Backpacker (obwohl es die erste Hauptstadt der „United Provinces of Upper and Lower Canada“ war), daher gibt es auch kein Hostel, aber die Möglichkeit, im Studentenwohnheim zu schlafen. Das tue ich auch. Die „Queen’s University“ ist nicht gerade klein, muss ich sagen… Als ich dort angekommen bin, hab ich natürlich erst mal gefragt, ob es „Wireless Internet“ gibt. Die Antwort: „Ja… und das ist das Kabel für’s Internet im Zimmer!“ Hab ihn kurz dafür ausgelacht und dann hat er mir auch noch das Passwort für’s W-LAN in den Aufenthaltsräumen gegeben. Und ich dachte schon, ich könnte mit W-LAN-Kabeln reich werden. Mit was man hier definitiv nicht reich werden kann sind Dampf-Saunen. Ich verstehe gar nicht, wo die das ganze Wasser für diese enorme Luftfeuchtigkeit hernehmen. Oh, doch… ich kann trotz Sonnenbrand wieder draußen rumlaufen, denn: Überraschung, es regnet. Wenn die hier immer an mich denken, wenn es regnet, wundert es mich, dass mein Schluckauf weg ist.
Poutine. Das typischste Gericht der Region: Pommes mit brauner Soße und Käse. Erfunden wurde es in den 80er Jahren und so sieht es auch aus. Ich habe ja für vieles Verständnis, aber garantiert nicht dafür, dass dieses Essen auch noch mit Fotos beworben wird! Nun gut. Ich werde es wagen und zwar in einem der vielen „Restaurants“ in Quebec, die behaupten, die Urheber dieses Gerichtes zu sein. 3…2…1…. der erste Biss ist erstaunlich geschmacksneutral und ich bin ein wenig enttäuscht, denn es schmeckt einfach nur wie nasse Pommes. Aber schon beim zweiten Happen wird es intensiver. Ich erwische etwas Käse, der lustig zwischen meinen Zähnen quietscht. Es schmeckt wirklich nicht schlecht… aber auch irgendwie nicht so richtig gut….eben nach Pommes mit Soße und Käse… meine Meinung ob ich es mag oder nicht schwankt. Der Käse schmilzt nicht, die Pommes sind je nach Lage knusprig bis matschig. Obwohl ich schnell satt bin, muss ich noch ein wenig weiter essen. Die ganze Portion (und es war eine kleine!) ist aber unmöglich zu schaffen. Ich wünschte, ich hätte einen Kater, denn ich gehe jede Wette in, dass der sich nach wenigen Bissen verzieht…. diesen Versuchsaufbau werde ich mir merken.
Weiter geht es mit dem Bus nach Quebéc. Und was mich wirklich erstaunt: die Landschaft sieht aus, wie zu Hause. Viel Wald, leichte Hügel, sonst nichts. Ok, vielleicht etwas mehr Nichts, als ich es gewohnt bin und es gibt teilweise andere Bäume, aber alles in allem ist der Blick aus dem Fenster wie im Sauerland. „Sauerland… mein Herz schlägt für das Sauerland….“ Seit mich die seltsamen Zwillinge Anja und Anja (zumindest wurde nie ein anderer Name genannt), die ich im Hostel in Quebéc kennengelernt habe, auf diesen Vergleich gebracht haben, bekomme ich das Lied nicht mehr aus dem Kopf…. Nachdem ich den Hügel in Montréal ausgelacht habe, treffen mich die bergigen Straßen in Québec ziemlich unerwartet. Bereits auf dem Weg zum Hostel muss ich meinem Bruder Recht geben: ich habe zu viel Gepäck. Dafür ist das Hostel nicht allzu weit und ich werde es schnell wieder los. Also auf in die Altstadt. Und die ist sowas von Europäisch! Kleine Gassen, alte Häuschen, und über allem thront Chateau Frontenac, das gar kein Schloss, sondern ein Hotel ist. Von „Terrasse Dufferin“sieht man, dass St. Laurence River seit Montréal nicht unwesentlich zugenommen hat und an jeder Ecke gibt es Straßenkünstler, die gar nicht mal schlecht sind und die großen Touristenmassen (hauptsächlich Franzosen, wie ich feststelle) begeistern. Über die Gourverneur-Promenaden erreiche ich die Zitadelle, deren Existenz mich überrascht, da Isabell meinte, sie wäre abgebrannt. Meine Neugier treibt mich weiter, bis ich schließlich ein Ticket zu einer Führung kaufe und feststelle, dass wohl was anderes abgebrannt ist. Die Zitadelle jedenfalls ist noch ziemlich existent, aber ich freue mich, diesem Irrglauben verfallen zu sein, denn hier sieht man ziemlich anschaulich, für wen die Region alles einmal interessant war und das waren ziemlich viele. Die Sonne scheint nach wie vor und ich merke, wie meine Haut langsam ihre Bürofarbe verliert. Außerdem rieche ich irgendwie knusprig, wenn ich schwitze. Das ist mir ja auch noch nie aufgefallen. Mal sehen, wann ich gar bin.
Die Landschaft verändert sich von Frankreich, über das Sauerland bis hin zu einer Aussicht, die ich aus Schweden kenne. Viel Wald, ein paar Seen und an jedem See, ein bis zwei Häuschen. Sehr schön. Aber noch bevor ich es schaffe, die zu fotografieren, sehe ich Wasser. Und es ist kein Meer, auch kein riesiger See… es ist ein Fluss, so groß, dass man das andere Ufer nicht sehen kann. Der St. Laurence River ist hier unmerklich breiter, als in Montréal oder Québec. Spree… du wirst zu recht oft von Besuchern ausgelacht. Und dass der Wortursprung für „Dill“ von „reißender Strom“ kommt, erscheint mir noch lächerlicher, als zu dem Zeitpunkt, als ich das erfahren habe. Kurz darauf bin ich auch schon in Tadoussac. Mental mache ich mich auf einen viertelstündigen Fußmarsch zum Hostel bereit. Aber nein. Ich habe Glück. Der Bus hält direkt vor meiner Herberge, die eine lustige Hippie-Absteige zu sein scheint. Und das ist sie auch. Allerdings empfinde ich das gut gemeinte „Komm rein und haab Spaaaaaß!“ von einem Typen mit Rastalocken doch eher als befremdlich. Werde ich alt? Außerhalb der lustigen Hippie-Absteige sieht die Welt ganz anders aus. Der Ort besteht aus ca. 2,5 Straßen mit sauber aneinandergereihten, trotzdem individuellen Holzäusern, die wie Kulissen aussehen, aber echt zu sein scheinen. Außer Touristen gibt es hier glaube ich niemanden. Bin ich in Disney-Land Kanada gelandet? Nein, dann würde es jetzt vermutlich nicht regnen. Am nächsten Morgen geht’s bereits um 6.00 Uhr raus. Ich möchte Wale sehen und habe eine „Whale-Watching-Tour“ gebucht. Nachdem wir alle mit scheinbar wasserfesten Anzügen ausgestattet sind, geht’s auf ein Zodiac – ein großes Schlauchboot mit Motorantrieg. Das Salzwasser erstaunt mich seltsamerweise. Da hätte ich auch drauf kommen können. Es dauert nicht lange und wir sehen die ersten Wasserspritzer der Meeresriesen und dann lassen sie auch nicht lange auf sich warten. Wir haben verschiedene Arten gesehen, welche genau kann ich nicht sagen, denn bei anhaltenden Motorengeräuschen Wal-Namen auf Französisch verstehen ist leider nicht meine Kernkompetenz. Aber Belugas waren dabei. Soviel weiß ich. Jetzt habe ich doch tatsächlich zuerst Wale in freier Wildbahn gesehen, bevor ich mal einen Tapir im Zoo erlebt hab! Ich sollte an meinen Prioritäten arbeiten.
Obwohl es schon irgendwie komisch ist, habe ich das Angebot von Isabelles Cousine angenommen und bei ihr und ihrer Freundin übernachtet. Wie sich herausstellte, eine sehr gute Idee. Wie sonst bekommt man die besten Touri-Tips von „Einheimischen“ und dazu noch ein Fahrrad? Mein erster Tag in Toronto besteht also in einer ziemlich ausgedehnten Fahrradtour. Zu einem lustigen Haus, das ein reicher Mann in allen Stielrichtungen hat bauen lassen, die er mochte. Sehr muntere Kombination. Weiter geht’s durch China Town, Kensington Market (absolutes London-Gefühl an dieser Stelle), CN-Tower, Hafen und Distillery District. In dieser ehemaligen Destillerie gibt es heute lauter kleine Geschäfte, recht designlastig, Kaffee, Schokolade und ähnliche, schöne Dinge. Müsste ich nicht alles tragen, was ich kaufe, würde ich gegebenenfalls in einen kleinen Kaufrausch verfallen. Außerdem scheint es ein sehr beliebter Ort für Hochzeitsfotos zu sein, denn zu meinem Erstaunen kann ich gleich 5 Hochzeitsgesellschaften beobachten, die mit riesigen Limousinen (wer sagt eigentlich, dass das schön ist?) und einer ganzen Encourage an Brautjungfern etc. zum Fotos machen extra dorthin kommen. Also… so richtig begeistert sehen die alle nicht aus… Am zweiten Tag tauche ich dann in den Teil Torontos ein, der sich wirklich nach Großstadt anfühlt. Zu Fuß vorbei an diversen Hochhäusern, durch eine riesige Mall… ja… nicht übel… so langsam nähere ich mich dem an, was ich von Nordamerika erwarte. Hat was… muss ich sagen… Zu meiner Freude gibt es abends noch eine kleine Party bei Geneviève und Lysanne. Sehr lustig und eine weitere gute Gelegenheit, in Kanada auch Kanadier kennenzulernen. Ein lustiger Sprachmischmasch aus Englisch und der Sprache, die so ähnlich ist, wie Französisch. So langsam entdecke ich bestimmte Muster im Akzent, Silben, die einfach mal eingefügt werden etc. Vielleicht sollte ich doch nochmal mehr Enthusiasmus in das Erlernen dieser Sprache stecken? Aber ich habe noch einen Tag und noch immer ein Fahrrad zur Verfügung. Also mache ich mich auf zu den Toronto Islands. Mit der Fähre kann man zu diesem gemütlich-kleinen Feriendomizil übersetzen und dieses mit dem Fahrrad erkunden, oder – sollte man das wirklich wollen – den kleinen Freizeitpark genießen. Irgendwie finde ich die Idee gut, so eine Art riesigen Insel-Park direkt vor einer Stadt zu haben.
Auf der gegen Unendlich gehenden Liste der Dinge, die ich gerne einmal sehen möchte, stehen natürlich auch die Niagara Fälle. Was ich erwarte: Viel Wasser, viel Natur, viele Touristen. Mit Letzterem liege ich auch vollkommen richtig. Die örtliche Busgesellschaft bringt mich und einen lustigen Brasilianer, den ich an der Bushaltestelle kennengelernt habe, ins Zentrum. Ich will in mein Hostel, er will sich einfach nur kurz die Fälle ansehen und dann wieder zurück nach Toronto. Zuerst halte ich dies für eine seltsame Idee, dann sehe ich das Riesenrad und überlege, ob es evtl. gar keine schlechte Idee ist, sich nur eine Stunde Zeit zu nehmen… In meinem Hostel hält der „Herbergsvater“ (sagt man das eigentlich noch?) mir und den anderen drei Deutschen, die gerade ankommen, erst einmal einen ausgedehnten Vortrag darüber, dass ein bis zwei Tage viel zu wenig sind für die Niagara Fälle und das Deutsche und Koreaner diesen Fehler immer machen und dass der „Lonely Planet“ mit seiner Beschreibung falsch liegt und es in der nächsten Ausgabe ändert… und ich habe einen ca. 15 Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken und schwitze ohne Ende, weil ich mich in dem extrem klimatisierten Bus doch für meine Fleecejacke entschieden habe… Außerdem verkauft er ja nichts …aber wir sollten uns überlegen, ob wir nicht mit den „Wirlpool-Jets“ fahren wollen, davon gibt es auch ziemlich viele Fotos von nassen Menschen. Außerdem gibt’s zum Frühstück Blaubeer-Muffins… er merkt einfach nicht, dass er nervt… und die meisten Übernachtungen in seinem Hostel sind 1,60 große, blode Au Pair Mädchen aus Deutschland… Das macht meinen Rucksack auch nicht leichter… Nach einer gefühlten Stunde und real vermutlich einer halben, bekomme ich endlich meinen Zimmerschlüssel, kann meine Sachen loswerden und mal sehen, ob dieses Riesenrad so schlimm ist, wie vermutet… Nein, ist es nicht. Es ist schlimmer. Drumherum blinkt und leuchtet und schimmert es in allen Farben, die Burger King, Starbucks, Softeisstände und Souvenierläden so zu bieten haben. Es riecht nach Zucker und überall sind Menschen. Die berühmten Wasserfälle können also nicht weit sein. Ich kämpfe mich durch das vergnügungssüchtige Volk und sehe schließlich tatsächlich zuerst die Amerikanischen und etwas weiter entfernt auch die Kanadischen Fälle. Bunt beleuchtet und ziemlich laut. Mein erster Eindruck ist etwas enttäuschend, bis ich mal genauer hinsehe und die Höhe abschätze. Plötzlich bin ich beeindruckt und genieße den Ausblick eine Weile. Ich freue mich darauf, die Fälle bei Sonnenlicht zu sehen. Dann sind sie bestimmt nicht pink. Eben noch voller Verachtung, begebe ich mich am nächsten Tag selbst in das volle Touri-Programm. Mit dem Boot zu den Fällen (sehr schön, da wird man ordentlich nass und bekommt einen Eindruck von der Höhe), auf einem Holzweg neben dem Fluss an verschiedenen Strohmschnellen vorbei (warum auch immer das eine Attraktion sein soll…das spannendste waren die mit Kaugummis gepflasterten Mauern) und dann noch auf eine „Reise hinter die Fälle“. Das ist allerdings eine echte Übertreibung, denn eigentlich läuft man einen Tunnel lang, der zwei Aussichtsplattformen hat, vor denen halt nun mal Wasser herunterfällt. Da man aber nicht alleine ist, steht man kurz Schlange, um vor einer weißen Wasserwand zu stehen, ggf. ein Foto zu machen und wieder zu verschwinden. Alles in allem bin ich schon ziemlich schockiert, was die hier mit einem wundervollen Naturspektakel machen. Schuttlebusse fahren von einer Attraktion zur nächsten, der ewig süße Geruch geht mir auf die Nerven und ich würde so gerne etwas nicht essen, das nicht frittiert ist. Nach langem Überlegen und ausgiebiger aber vergeblicher Suche nach etwas Frischen, esse ich doch eine Pizza und bin erbost darüber, dass die hier doch tatsächlich in dem einzigen Laden, der ein paar Elemente eines Lebensmittelladens aufzuweisen hat, den Instantkaffee, den ich 3 Päckchen für 1 Dollar gekauft habe für 5,99 $ pro Päckchen verkaufen!!! Nichtsdestotrotz zieht es mich aber immer wieder zu den Wasserfällen. Da ich etwas von einem Feuerwerk gelesen habe, dass evtl. stattfindet, gehe ich auch wieder zurück. Es ist 8.00 Uhr und die größte Masse an Touristen hat sich verzogen, bzw. ist jetzt in Richtung Riesenrad und Burger King unterwegs. Die Souvenierläden, die direkt an den Fällen sind, schließen. Es wird geräumt, gefegt, eine Mitarbeiterin lässt einen Karton mit Flaschen fallen, die Musik hört auf, Feierabend. Ein paar Menschen sind noch unterwegs, machen Fotos, starren auf die unglaublichen Massen an Wasser, die die Horseshoe Falls hinunterdonnern. Ich suche mir einen Platz auf einem Steinhaufen und beobachte, wie die Lichter angehen und nach einer ersten Freude, über die bunten Lichter die Touristen mehr und mehr verschwinden. Nur noch wenige genießen die einbrechende Nacht. Keiner will einem mehr eiskalte Getränke, Eis, Burger oder irgendeinen Nippes verkaufen. Es ist ruhig, bis auf das Getöse, dass die Wasserfälle verursachen. Und irgendwie beruhigt es mich sehr. Völlig unbeeindruckt davon, ob tausende von Touris Fotos machen, in lustigen Regencapes auf Booten hin und her fahren, Eisessen oder was auch immer: die Wasserfälle machen einfach weiter. Ob man ihnen zuschaut oder nicht. Ob Tag oder Nacht. Mit Beleuchtung oder ohne. Sie sind einfach da. Sie sind groß, sie sind überwältigend und definitiv einer der schönsten Orte, die mir die Natur bisher gezeigt hat. Eine kleine Wanderung am nächsten Tag, außerhalb von all dem Trubel versöhnt mich auch wieder mit der Region. Mann kann hier auch anders seine Tage verbringen, als mit Riesenradfahren und Geisterbahn. Trotzdem hat Niagara-Disney in mir irgendwie schon einen Fast-Food-Ekel erzeugt, bevor ich überhaupt die USA betreten habe. Ich will Obst. Aber dieser Wunsch soll ein solcher bleiben, bis ich am kommenden Tag mit dem Bus in die USA einreise und am Rastplatz Bananen entdecke. Die Freude, die ich in diesem Moment über die Früchte verspürte, kann vermutlich nur jemand nachvollziehen, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist… Aber meine Freude ist nur kurz, denn neben den Bananen kaufe ich mir ein Thunfischsandwich und einen Kaffee. Da es keine Milch gibt, suche ich eine Weile, bis ich Sahne ohne irgendeine abstruse Geschmacksrichtung finde und gehe zurück in den Bus. Meine Sitznachbarin kann zwar die Freude über meine Bananen nicht teilen, ist aber darüber hinaus eine wirklich spannende Person. Während ich mich wundere, dass nicht nur mein Kaffee extrem süß ist, sondern auch das Thunfischsandwich (zuckern die hier wirklich ihr Brot?????), kommen wir ins Gespräch und ich erfahre, dass sie mit ihrem zweiten Mann in nur 2,5 Jahren alle 7 Kontinente bereist hat. Die beiden haben sich irgendwo kennengelernt und er wollte gerne mal in die Antarktis. Sie sagte „ich komme mit“ und so wurden sie ein Paar und da beide bereits pensioniert waren, haben sie ihre Zeit mit Reisen verbracht. Und sie waren wirklich überall, haben ihre teure Kamera mit Klebeband getarnt, sich auf einem auseinanderbrechenden Eisberg fast verloren und Kälte und Hitze gleichermaßen mitgenommen. Die letzte geplante Reise konnten sie nicht mehr machen, da er Krebs bekam und starb. Sie blickt aber nicht auf das, was sie nicht mehr gemeinsam gesehen haben, sondern auf die vielen Reisen, die sie gemacht haben, wie sie ihre Zeit genutzt haben und wie viel Spaß sie so zusammen hatten. Eine wirklich beeindruckende Begegnung, die mich darin bestätigt, dass man Gelegenheiten wahrnehmen sollte und Gelegenheiten zum Reisen erst recht.
Am nächsten Tag geht es mittags los in Richtung Flagstaff. Zum ersten Mal hab ich wirklich etwas konkret geplant und gebucht und festgemacht. Und zum ersten Mal macht mir Greyhound auch gleich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Mein erster Bus hat 45 Minuten Verspätung. Nicht etwa, weil die Straßen voll waren, sondern weil der Busfahrer bei jeder Gelegenheit trödelt. Wir steigen aus einem Bus aus und der freundliche Greyhound Service-Mann sagt nur: “Den Bus nach Dallas haben sie verpasst, der nächste fährt um 1.50 Uhr”. Ich versuche Informationen über meine Weiterfahrt aus ihm herauszubekommen, aber er wiederholt, eher vorwurfsvoll, dass wir ja schließlich den Bus verpasst haben und dass der nächste erst in einigen Stunden fährt. Kaum in Houston angekommen, habe ich also schon ein ernsthaftes Problem, denn mein Aufenthalt dort hätte nur 30 Minuten sein sollen und mein Anschlussbus hat natürlich keine weiteren 15 Minuten gewartet. Schnell stellt sich heraus, dass dies für mich bedeutet, dass ich 15 Stunden später in Flagstaff ankommen werde, keine Chance mehr habe an diesem Tag, also an meinem Geburtstag, zum Grand Canyon zu kommen. Meine Reservierungen für Hostel, Shuttle und Muli-Tour sind also umsonst, wenn auch leider nicht kostenfrei und ich werde auch meine folgenden Hostel-Reservierungen noch ändern müssen, wenn ich mir den Blick auf den Canyon gönnen möchte. Keine gute Aussicht und alles andere, als das, was ich mir vorgestellt habe. Meinen Geburtstag halb im Bus und dann halb in Flagstaff, ohne wirklich etwas zu tun zu haben und ohne bekannte Gesichter zu verbringen… nicht gerade meine Traumvorstellung. Also beginne ich mit aller, mir möglichen Penetranz sämtliche Greyhound-Mitarbeiter zu fragen, ob es nicht doch irgendeinen Weg gibt, der mich rechtzeitig an mein Ziel führt. Während meines Aufenthalts in Houston spreche ich wirklich mit jedem, warte Schichtwechsel ab und breite mein gesamtes emotionales Spektrum von Freundlichkeit über Boshaftigkeit, bis hin zu Tränen und absolutem Mädchengetue vor den Menschen mit dem lustigen Windhund auf dem Hemd aus. Außer einer Umarmung und einem verfrühten „Happy Birthday“ Ständchen bringt mich das allerdings gar nicht weiter. Immer wieder die gleiche Auskunft: Die erste Möglichkeit, in Flagstaff anzukommen ist Sonntag, 5. September, 12.45 Uhr, mittags. Auch keine Chance, an einen anderen Ort zu kommen, der mich irgendwie in die nähe des Canyons bringt. Wie konnte ich nur so bescheuert sein, diese Reise mit Greyhound zu machen??!!! Ich hasse es, wenn meine Pläne nicht funktionieren! Es ist kein Problem, wenn sich der Weg zum Ziel verändert, aber ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass ich nicht bekomme, was ich möchte und steige in den nächsten Bus nach Dallas. Damit liege ich drei Stunden hinter meinem Zeitplan, bewege mich aber immerhin in Richtung Westen. Vielleicht bringt mich ja hier irgendetwas weiter. Vielleicht ein Zug? Die Aussage, dass die auch nicht schneller sind, habe ich schließlich erst einmal bekommen. In Dallas also wieder zum Info-Schalter. Anstellen, warten. Ein Mitarbeiter fischt sich zwischendurch Personen heraus, die keine Tickets kaufen wollen und so auch mich. Ich schildere auch ihm mein Problem und er überlegt, tippt in seinen Computer, überlegt, probiert und sagt schließlich einem Busfahrer, dass er doch bitte noch ein wenig warten soll. Ich bekomme ein neues Ticket mit einer neuen Route, angeblich die schnellste und soll mich beeilen, in den Bus zu kommen. Auf dem Ticket steht die planmäßige Ankunft: Sonntag, 5. September, 12.45 Uhr, mittags. Arrrrgggghhhhh! Und jetzt habe ich nicht mal mein altes Ticket, das beweist, dass ich zu spät war und mit dem ich evtl. noch eine kleine Chance gehabt hätte, meine Reservierungen mit Bestätigung von Greyhound zu verschieben. Egal. Ich kann es nicht ändern und hetze zum Bus. Der wartet wie verprochen, ich steige ein und schaue mir mein Ticket genauer an. Um am Sonntag um 12.45 Uhr mittags anzukommen, müsste ich am 4. September um 12.30 mittags ab Dallas losfahren. Es ist aber erst 6.00 Uhr morgens. Das gibt mir Hoffnung. An der ersten Rast frage ich den Busfahrer, wann ich in Flagstaff bin. Er sagt: „Steht auf dem Ticket“ ich sage „Auf meinem Ticket steht aber auch, dass ich erst in ein paar Stunden losfahre!“ Er „Ach ja. Dann hast du wohl den letzten Bus verpasst. Dann kommst du 24 Stunden früher an, als auf dem Ticket steht!“ Diese Aussage klingt zwar gut, macht aber keinen Sinn. Er denkt noch einmal nach und sagt „Ach nee, 24 Stunden minus 9.“ So richtig logisch klingt es immer noch nicht, aber ich schöpfe Hoffnung, dass ich es noch schaffe. In Oklahoma erfahre ich dann endlich, dass ich um 4.00 Uhr morgens in Flagstaff ankommen sollte. Ich rufe im Hostel an, der Mann ist nett und verspricht mir, mir einen Schlüssel zu hinterlegen. Und so langsam kommt meine Vorfreude zurück. Natürlich ist auch dieser Bus zu spät und ich bin erst um 6.00 Uhr in Flagstaff, aber es reicht, um mit dem Taxi zum Hostel zu fahren, meine Klamotten zu wechseln, meinen Rucksack einzuschließen, schnell etwas zu frühstücken und mich auf zum Shuttlebus zum Grand Canyon zu machen. Und ich sage euch, so aufgeregt und nervös war ich vor der gesamten Reise nicht. Und dann bin ich endlich da, steige aus dem Bus, laufe einige Meter und stehe an meinem 30. Geburtstag ungeduscht, übermüdet und überglücklich am schönsten Platz dieser Erde, den ich bisher gesehen habe. Wohlverdient breche ich erst einmal in Tränen aus, weil es dort so wunderschön ist. Ich laufe rum, mache meinen Muli-Ritt – sehr, sehr lustige Tiere, die außerdem den Vorteil haben, nicht den Teil vom Pferd zu besitzen, gegen den ich allergisch bin – und kann einfach meine Augen nicht vom Canyon lassen. Alle die sagen: „ Was will ich da, es ist doch nur ein Loch/ es sind doch nur Felsen!“ die haben einfach keine Ahnung, denn ich kann mir keinen schöneren Ort auf dieser Reise vorstellen, um meinen Geburtstag zu verbringen. Abgesehen davon sind 30 Jahre gar nichts, wenn man bedenkt, wie viele Millionen es gebraucht hat, um den Canyon zu formen. Sächsische Touristin zu ihrem Mann: „Hast du Sonnencreme benutzt? Ich sag dir… creme dich endlich ein, sonst bekommst du wieder einen roten Kopf und glühst so, dass wir heute Abend kein Licht anmachen müssen.“
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, meinen 30. Geburtstag am Grand Canyon zu verbringen, was dazu führt, dass ich mich jetzt ein Wenig beeilen muss. Für New Orleans bleibt mir daher nicht viel Zeit. Nur eine Übernachtung, aber 1,5 Tage sollten für einen ersten Eindruck reichen. Und so ist es auch, allerdings ist dieser nicht besonders gut. Schon nach kurzer Zeit geht es mir tierisch auf die Nerven, ständig als „Lady, Honey, Sweety, Darling oder Sweetheart“ angesprochen zu werden. Und zwar nicht nur im Gespräch, sondern auch wenn man einfach nur die Straße langläuft. Ich lasse mich ja ohnehin nur ungern ansprechen und in Key West wurde ich auch sofort als Deutsche identifiziert, weil ich nicht darauf eingegangen bin, was am Straßenrand so gequatscht wird. Aber so offensichtlich ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sämtlicher am Straßenrand stehenden Männer zu stehen, bringt doch wohl hoffentlich noch andere Menschen zur Weißglut, oder? Das kann doch kein rein deutsches Ding sein! Muss denn alles an mir kommentiert werden? „I like your haircut, Sweety!“ „Lady, where are you going!“ „That’s a heavy backback, Honey!“ Irgendwann zähle ich von drei rückwärts, wenn ich an irgendwem vorbei laufe und warte auf einen Kommentar. Manchmal ist es nur ein „How are you doing, Darling?“ aber unkommentiert komme ich hier an niemandem vorbei. Wie immer zieht es mich erst einmal in Richtung Wasser. Ich mag doppelte Buchstaben, also will ich natürlich auch den Mississippi sehen. Aber die Ecke, die ich zuerst sehe ist irgendwie stickig und industriell. Also mache ich mich auf in das vielbeschworene „French Quarter“ und lande in einer Straße, die zwar ganz nett aussieht, aber die Menschen, die hier herumlaufen sind doch irgendwie zwielichtig. Das soll die Touri-Ecke sein, in der man sich ohne weiteres Tag und Nacht aufhalten kann? Ich biege in die nächste Straße ein. „Bourbon Street“, die Party-Meile schlechthin. Aber was ich dort sehe ist der nachmittägliche Eindruck von einem Sexshop, der sich an den anderen reiht und ich beschließe, dass dieses „French Quarter“ vielleicht doch nicht so mein Ding ist und mache mich auf in Richtung „Arts & Museum“-Viertel. Die Ecke ist auch gleich viel weniger zwielichtig, könnte aber auch daran liegen, dass es dort einfach gar keine Menschen gibt. Auch irgendwie unheimlich. Ich spiele kurz mit dem Gedanken, mir im „World War II Museum“ mal anzusehen, wie die Amerikaner diesen Krieg wohl so sehen, entscheide mich dann aber doch, dass Museum zum Hurricane Cathrina zu suchen. Gesucht habe ich es auch. Gefunden allerdings nicht und da es in dieser Ecke leider keine Menschen gibt, konnte ich auch niemanden fragen. Also gebe ich dem „French Quarter“ eine weitere Chance und tatsächlich: es ist schön. Wundervolle Häuser mit zauberhaften Balkonen, irgendwie eine andere Welt. Und es gibt tatsächlich an jeder Straßenecke Musik. Da sich hier ohnehin ein Touri-Geschäft an das andere reiht, erscheint mir die Gelegenheit günstig, mir ein langärmliges Oberteil für meine Muli-Tour zu kaufen. Für einen Pulli ist es zu warm und kurze Ärmel sollte man wegen der Dehydrierung vermeiden. Hat jemand von euch schonmal versucht, Anfang September etwas Langärmliges in New Orleans zu kaufen? Keine gute Idee. Und etwas zu finden, was nicht im „Ed Hardy“-Style ist, ist vollkommen aussichtslos. Ich finde schließlich etwas, das den fiesen, bunten Glitzerdruck nur auf dem Rücken hat. So muss ich es wenigstens selbst nicht sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Damit habe ich auch genug getan und fahre mit den lustigen Cabel Cars (die würde ich als historisch aufgemachte Kurzsstraßenbahn bezeichnen) wieder zum Hostel. Von dieser Stadt hatte ich mir wirklich mehr erwartet. Vielleicht liegt es daran, dass ich anfänglich nicht ganz die richtigen Ecken entdeckt habe, aber der Funke springt irgendwie nicht über.
Auch diese Hauptstadt werde ich nicht ignorieren und so geht es weiter nach Washington D.C., oder kurz „D.C.“, auf keinen Fall „Washington“, das sorgt für Verwirrung. Im Hostel in New York habe ich mein Buch gegen „Dear John“ von Nicolas Sparks getauscht und als ich es so auf meiner Busreise lese, schaue ich kurz hoch, als wir an Wilmington vorbeifahren. Sehr seltsam, gerade eine Geschichte zu lesen, die von genau dem Ort handelt, an dem man gerade vorbeifährt… In New York habe ich mit den Kanadiern noch gewitzelt, dass man mit der Wegbeschreibung „zwischen McDonald’s und Starbucks“ immer richtig liegt und dass man diese Läden daher auf keinen Fall zur Orientierung nutzen sollte. In D.C. lerne ich hingegen eine weitere Lektion Amerikanischer Wegbeschreibungen und die lautet: „Wenn du zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, frag gar nicht erst. Die Leute haben weder Ahnung, noch das geringste Gefühl für Entfernungen.“ Von meinem Hostel wurde mir geraten, auf gar keinen Fall mit Greyhound zu kommen, da dieser zu weit außerhalb hält und es wirklich kompliziert ist, zum Hostel zu kommen. Diese nicht zu überwindende Distanz ist aber für einen Europäer mit mittelprächtiger Kondition immernoch kurz genug, um sich mit ordentlich Gepäck auf dem Weg zur Bushaltestelle zu verlaufen, zur Metrostation zu gehen, wo einem ein Mitarbeiter am Ticketschalter nicht weiterhelfen kann, zu beschließen direkt zum Hostel zu laufen und dort immer noch halbwegs entspannt anzukommen. D.C. scheint eine muntere Mischung aus Regierungsstadt und Slum zu sein. Zum einen brüsten sich die Schulen damit „Drugfree Zones“ zu sein (zumindest laut den Schildern) und die Häuser sind alles andere als in gutem Zustand und zum anderen gibt es die National Mall und alles drumherum, mit den protzigen, strahlend weißen Gebäuden. Ich bin fast geneigt die extremen Unterschiede mit Osteuropa zu vergleichen… Die Sonne macht mich fertig und ich krieche am nächsten Tag mehr oder weniger von Parkbank zu Parkbank, immer mit einer Flasche Wasser in der Hand im ständigen Kampf gegen die Dehydrierung. Schon mal den Arm in lustige Falten gequetscht und festgestellt, dass diese minutenlang nicht verschwinden? Trotzdem versuche ich noch so viel zu sehen, wie möglich. Ich überlege, ob ich mich für eine Führung im Capitol anstellen soll, aber da ich zuviele Dinge in meinem Rucksack habe, die eine ernsthafte Bedrohung für das Land sind (Wasser, ein paar Kleinigkeiten zu Essen etc…) und es außerdem unklar ist, wie lange man warten muss und ob es überhaupt so weit kommt, dass man rein darf, entscheide ich mich dagegen und laufe die National Mall entlang. Die Brühe im „Lake Mirror“ (heißt der so oder bild ich mir das grad ein?) ist nur schwerlich dazu fähig, mich zu spiegeln und ich wundere mich nicht mehr, dass Schauspieler so gut bezahlt werden, wenn sie doch in so vielen Filmen durch diese fiese Suppe laufen müssen. Oder übernehmen Stuntmen nicht nur die gefährlichen, sondern auch die ekelhaften Aufgaben? Natürlich besuche ich auch den guten, alten Abraham Lincoln. Sehr dezentes Denkmal, dass ihm da gesetzt wurde… aber dafür hat der Gute jetzt eine wirklich schöne Aussicht hin zum Capitol. Und einen gemütlichen Sessel. Und viel Besuch. Was mich wirklich erstaunt ist, dass die Amerikaner in dem Park für jeden Krieg, in den sie je involviert waren, ein Memorial errichten. So langsam sollten sie sich mal zurückhalten, denn wenn sie so weiter machen ist bald nix mehr vom Park übrig… Die Obamas sind nicht zu Hause oder machen zumindest keine Anstalten, Trudi und mich auf eine Tasse Kaffee einzuladen. Von wegen amerikanische Gastfreundlichkeit. Ich würde ja auch Kuchen mitbringen…
Als waschechter Europäer halte ich es natürlich für eine gute Idee, mir die älteste Stadt der Vereinigten Staaten einmal anzusehen. Also auf nach St. Augustin. Morgens um 6.00 Uhr erfahre ich dann auch die wortwörtliche Bedeutung von „The bus will drop you off at the visitor’s centre…“, denn es ist der erste Ort, an dem es keine Greyhoundstation gibt. Ich stehe also plötzlich im Stockdustern an einem Greyhoundschild. Das einzig Beleuchtete ist eine Tiefgarage und ich sehe keine Menschenseele. Nichteinmal Autos. Wirklich gespenstisch. Was ich von den Gebäuden um mich herum erkennen kann, sieht aus wie ein Ferienresort, aber dunkel und komplett unbelebt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich sofort pudelwohl fühle. Ich schaue mich um, entdecke ein Hotel und beschließe, dort nach Asyl zu fragen. Als ich mit meinem großen Rucksack auf dem Rücken und dem Kleinen auf dem Bauch und immer noch extrem warm gekleidet in der Lobby ankomme und erkläre, dass ich gerade im Dunkeln hier gestrandet bin und mich nicht traue weiterzugehen und außerdem ein bemitleidenswertes, kleines Mädchen bin, fragt mich der Mann an der Rezeption auch gleich, ob ich denn mit dem Greyhound angekommen bin… offensichtlich hätte ich nichtmal „süß“ spielen müssen. Ich bekomme Stadtpläne, habe nette Gesellschaft diverser älterer Menschen und hätte vermutlich sogar Kaffee bekommen. Gegen 7.00 Uhr ist es hell genug und ich gehe durch die Stadtmauern und betrete Disney-Land. Die Häuser wirken wie Kulissen. Alte Holzhäuser, restauriert und das Einzige, was es dort gibt, sind Restaurants und Souvenirläden. Überall hängen schicke Holzschilder – wie Früher- aber mit modernen Inschriften. Das „älteste hölzerne Schulhaus“ ist auch restauriert und zwar so, dass man ihm noch ansieht, dass es ein altes Haus ist. Jemand hat sich extrem viel Mühe dabei gegeben, die Bretter so zu bemalen, dass sie verwittert aussehen. Und dann dieser Bodenbelag, der zwar aus Muschelschalen besteht, aber trotzdem aussieht wie Beton… ich bin entsetzt. Nach einem kurzen Nickerchen (irgendwie hab ich im Bus nicht gut geschlafen, weil ständig irgendwelche Körperteile meines widerlichen Sitznachbars auf mich drauf fielen) begebe ich mich in das touristische Geschehen und senke ersteinmal den Altersdurchschnitt um eine nicht unwesentliche Anzahl an Jahrzehnten. Geschichte findet man hier trotz der Disney-Aufmachung tatsächlich an diversen Orten und so mache ich eine Führung im „Flagler College“ mit. Das Gebäude war früher einmal ein Luxushotel, genaugenommen das erste mit elektrischer Beleuchtung. Gebaut wurde es von Henry Morrison Flagler. Kumpel und Geschäftspartner von Rockefeller, aber nicht ganz so bekannt, dafür wenn überhaupt, nur unwesentlich ärmer. Er war ein absoluter Perfektionist, da er aber der Meinung war, dass die absolute Perfektion nur von Gott erreicht werden kann, hat er in einem Mosaik einen Stein falsch setzen lassen. Natürlich an einer Stelle, wo es keiner sieht. Irgendwie gefällt mir diese Episode. Die Studenten essen heute noch in den Räumen, in denen damals die Reichen und Schönen speisten. Hat schon was. Dort hätte man auch Harry Potter drehen können oder so. Wenn ich auch eben von „touristischem Geschehen“ gesprochen habe, so muss ich doch sagen, dass ich außerhalb der Saison hin St. Augustin bin. Genauergesag genau zwischen den Saisons. Es gibt also kaum Menschen auf den Straßen, denn die Einheimischen sind natürlich woanders. Nicht übertrieben habe ich allerdings mit dem Durchschnittsalter, vermutlich wollen die Damen und Herren ihre letzte Chance nutzen, aus dem „Fountain of Youth“ zu trinken. Ich überlege kurz, ob das so knapp vor meinem 30. nicht vielleicht eine Option wäre, finde Altern dann aber doch ganz gut und entscheide mich dagegen. Sehen möchte ich den Brunnen aber trotzdem gerne, kann ich aber nicht, macht um 16.00 Uhr zu. Als ich so die Straße langlaufe, spricht mich wiedereinmal ein Amerikaner an: „Did you see the Peacock in the middle of the street?“ Ich gucke nach rechts zu dem weißen Pick-Up und denke mir: „Ein Pick-Up auf der Straße… ja… das hab ich in der Tat erst ca. 10098 Mal gesehen. Danke für die Info!“ und sage „ Oh yes… a Pick-Up… in the middle of the street!“ und er sagt: “Peacock, not Pick-Up!“ Und so habe ich die einmalige Gelegenheit ein Foto von einem Peacock und einem Pick-Up mitten auf einer Straße zu machen. Was gibt es sonst noch über St. Augustin zu sagen… dort wo die ersten Spanier ankamen und ihre Mission errichteten, steht jetzt ein riesiges Kreuz aus rostfreiem Stahl. Das hat schon eine krasse Wirkung… und es gibt einen Leuchtturm und in einem abgelegenen Ökoladen esse ich den besten Veggie-Burger, den ich bisher gefunden habe. Aber sonst….Bei aller Liebe meine verehrten Amerikaner, von historischen Innenstädten habt ihr echt keine Ahnung. Also bitte versucht es erst gar nicht!
Es geht weiter in Richtung Westen, am Sagueney River entlang in ein kleines, Örtchen namens Chicoutimi. Der einzige Grund, warum es mich hierher verschlägt ist, dass Felix und Isabelle mich hier abholen werden, um weiter in einen noch kleineren Ort zu fahren, in dem Isabelles Vater wohnt. Im Gegensatz zu Tadoussac ist Chicoutimi nahezu unbekannt und ich frage mich, wie viele Straßen es dort wohl gibt, wenn doch Tadoussac schon so klein ist. Zu meinem erstaunen ist Chicoutimi zwar viel unbekannter, dafür aber auch viel größer. Es ist eine wirkliche Stadt. Mit einer Einkaufsstraße, einem Musikfestival, das ausgerechnet dann stattfindet, als ich da bin und jeder Menge Regen zu meiner persönlichen Begrüßung. So freue ich mich nicht zum ersten Mal über meine schicke Regenjacke und noch mehr über die freundliche Hilfe am Informationsschalter des Busbahnhofs, wo man mir einen handgezeichneten Plan mit Wegbeschreibung zum Hostel in die Hand drückt. Im Hostel werde ich freudig begrüßt und ganz aufgeregt über meine Buchung über www.hostelworld.com ausgefragt. Das Hostel ist noch recht neu, ich bin die erste, die das System bisher genutzt hat und so ist die Freude riesig. Außer einem kurzen Besuch des Musikfestivals gönne ich mich hauptsächlich viel Schlaf und am nächsten Tag einen ausgiebigen Spaziergang durch den Ort. Sehenswürdigkeit Nummer eins ist das „little maison blance“. Ein kleines weißes Häuschen, das als einziges Gebäude eine große Flut überstanden hat. Heute ist es Museum und da damals Wasser durch das Haus floss, ist das heute auch noch so. Ein kanadischer Student, den ich im Hostel kennengelernt habe, begleitet mich auf meiner Tour. Als Sommerjob pflanzt er Bäume und ist erstaunt, dass das in Deutschland nicht wirklich zu den Standartjobs gehört. Und promt fragt er mich auch: „Habt ihr in Deutschland nicht so viel Wald?“ Habt ihr euch da schonmal Gedanken drüber gemacht und wenn ja, würdet ihr diese Frage einem Kanadier genauso beantworten, wie einem, sagen wir mal… Spanier? Irgendwie möchte ich einfach nur Laufen und da mein Tagesabschnittsgefährte weitergereist ist und mir nichts mehr einfällt, was wirklich noch sehenswert ist, laufe ich zu der Mall, die Chicoutimi zu bieten hat. Dabei summe ich dieses alberne „Let’s go to the mall“ Lied, das die muntere Kanadierin in „How I met your mother“ als teen-star gesungen hat. Nach einer halben Stunde Fußmarsch wundere ich mich nicht mehr, warum hier alle Auto fahren und laufe weiter. Ich habe auch gar keine Lust mit dem Laufen aufzuhören und so wandere ich weiter, bis ich wirklich an der Mall ankomme. Nachdem ich mir das ekelhafteste Mineralwasser mit irgendeiner Geschmacksrichtung gekauft habe, das ich offensichtlich zu finden vermocht habe, laufe ich zurück. Keine Ahnung, wie lange ich unterwegs war, aber es ist sicher kein Weg, den man zweimal macht. Mein Zitat des Tages: „Backtracking is such a waste of time!“
Abends holen Felix und Isabelle mich ab und es geht noch einmal ein paar Kilometer weiter in einen Ort, der immerhin über eine Kirche mit erstaunlichem architektonischen Einfallsreichtum verfügt. Aber der Ort an sich ist ohnehin egal, denn wir fahren zu Isabelles Vater an den See. Und dieser See ist ein Traum. Der Grund unseres Besuchs ist ein alljährliches Treffen von Isabelles Familie zum Pétanque spielen. (Die Spanier nennen es Boccia, wir nennen es glaub ich Boule). Wenn ihr mich fragt, fast ein schönerer Grund als Weihnachten, denn es ist Sommer und durch das Turnier sind alle irgendwie beschäftigt. Und auch mich packt die Faszination des Spiels. Ich sitze stundenlang in der Sonne und schaue mir fremden, aber wahnsinnig netten Menschen zu, die Metallkugeln in einem Riesensandkasten in Richtung einer kleinen Kugel werfen und kann mich nichts schöneres vorstellen, genau das zu tun. Abgesehen von am See sitzen und diesen einfach anzustarren oder noch besser: eine Kombination aus beidem. Und das tue ich auch. Vermutlich wirke ich relativ unkommunikativ, aber bei mir setzt eine derart tiefe Entspannung ein, dass ich mich nun wirklich nicht zu weiteren Aktivitäten aufraffen kann. Habe ich schon erwähnt, wie schön dieser See ist? Irgendwann gehe ich doch einmal schwimmen, fahre Tretboot und mit Isabelle Kanufahren. Es ist wirklich ein See, nicht nur ein kleiner Weiher. Und so schön! Und so entspannend. Langsam realisiere ich, dass ich gerade eine großartige Reise begonnen habe, viel sehen und viel erleben werde, aber bestimmt nicht alles sehen werde, was ich möchte. Und das ist auch nicht schlimm. Die Rastlosigkeit, die mich in den ersten Tagen dazu gebracht, nahezu ungebremst durch die Gegend zu laufen, um alles zu entdecken, was man nur entdecken kann, schwindet langsam und wird durch den Gedanken ersetzt, dass es absolut gar keinen Grund gibt, mich auf meiner Reise zu stressen. Ich wüsste gerne, ob sich meine Laufgeschwindigkeit nach den Tagen am See verringert hat. Ich gehe fast davon aus.
Obwohl mir alle erzählen, dass die Stadt doof ist, fahre ich weiter nach Ottawa. Man kann ja schließlich nicht einfach die Hauptstadt ignorieren. Und kaum dort angekommen, bin ich auch schon im Knast. Nein, nicht wegen irgendeiner Straftat, sondern, weil ein ehemaliges Gefängnis, nachdem es wegen zu gruseliger Haftbedingungen geschlossen wurde, in ein Hostel umgewandelt wurde. Und das hat was. Die Zimmer sind ehemalige Zellen, überall grauer Beton. Gemütlichkeit ist etwas anderes, aber es ist cool. Am Abend erfahre ich bei einer Führung, dass die Zellen für 2-3 Personen waren, also sehr, sehr eng und unmenschlich. Als ich später so in meinem Bett liege, betrachte ich den Raum einmal genauer… ja… die haben hier zwei Zellen zusammengelegt… dafür schlafen wir hier mit 6 Personen und es ist wirklich genug Platz. Unmenschlich ist es demnach nur, wenn man keine Stockbetten hat. Aber da wir auch die Folterkammer und den Galgen sehen, wird mir doch noch klar, warum das Gefängnis geschlossen wurde. Und die Einzelzellen sind auch alles andere, als nett… Die Stadt selbst hat allerdings in der Tat nicht viel zu bieten, aber doch mehr, als ich dachte. Es gibt kostenlose Führungen im Parlament und alleine die Organisation beeindruckt mich. Man geht an einen Infoschalter und bekommt ein Ticket mit einer Uhrzeit. Dann kann man tun was man will, bis es soweit ist und bekommt dann eine Führung mit richtig gut geschulten Guides. Und die Gebäude sind es wirklich wert, einmal von innen gesehen zu werden. Besonders die Bibliothek in einem runden Raum mit Kuppel. Leider gibt es dort nicht diese verschiebbaren Leitern, sonst wäre es wirklich ein netter Anbau für meine zukünftige Wohnung. Außerdem gibt es das „Museum of Civilisation“, das nicht nur in einem wunderschönen Gebäude untergebracht ist, sondern außerdem wohl die am besten gemachte Ausstellung enthält, die ich je gesehen habe. So gibt es zum Beispiel einen Nachbau einer kleinen Stadt, der zeigt, wie es so aussah, als dann die Europäer da waren. Alles ist in Originalgröße nachgebaut und ich wundere mich zuerst, ob es so schnell so spät geworden ist, weil es bereits dämmert und entdecke dann, dass ich mich in einem Raum befinde! Wirklich beeindruckend. Darüber hinaus nutze ich die Zeit in Ottawa, um mich ein wenig zu organisieren. Meine Reise weiterzuplanen, Wäsche zu waschen und mein Gepäck zu reduzieren… ja Felix… ich gebe es nur ungerne zu, aber zu hattest recht. Dafür lag ich richtig mit der Aussage, dass ich mich immer noch von einigen Dingen trennen kann und so kommt alles weg, was ich bisher nicht gebraucht habe. Außer der warmen Kleidung.
Ich komme in Chicago an und irgendwie fühlt es sich vom ersten Moment gut an. Extreme Hilfsbereitschaft am Fahrkartenschalter, interessante Aussichten aus dem Fenster der Bahn und zu guter Letzt ein extrem schönes, wahnsinnig professionell geführtes Hostel. Ich entschließe mich, das erste mal in meinem Leben an einem „Pub Crawl“ – einer Kneipentour – teilzunehmen, weil ich es für eine gute Gelegenheit halte, um Menschen kennenzulernen. Und das ist es auch. 6 Kneipen in ca. 3 Stunden sind ein hohes Ziel aber mit ein bisschen Disziplin geht alles und so verbringe ich den Abend mit zwei Australierinnen (die auf einer Hochzeit in den USA waren und einen Urlaub draus machen), einem Österreicher (der ein Auslandssemester beginnt und vorher noch ein wenig reist) sowie jeweils einem amerikanischen (sie geht nach Frankreich und musste wegen des Visums nach Chicago) und einem kanadischen Päärchen (auf einem Road Trip in die USA, Kurzurlaub eben). Damit haben wir -außer den Rentnern- auch fast alle Reisekategorien abgedeckt, die man so in einem Hostel trifft. Ein sehr lustiger Abend mit vielen Geschichten, viel Gelächter und zu meinem Erstaunen bezeichnet mich der weibliche Teil des amerikanischen Päärchens im Einvernehmen mit ihrem Freund als „cool“. Das ist mir ja noch nie passiert. Aber sie meint, dass ich genau die Art von Mensch bin, die man hofft, in einem Hostel zu treffen. Jemanden, der einfach so um die Welt reist. Ich freue mich über das Kompliment. Kurze Zeit später fällt sie auf dem Weg zurück ins Hostel und bricht sich Arm und Knöchel. Das gibt dem Abend nicht nur ein sehr unschönes Ende, sondern lässt mich auch ein wenig an der Qualität der Aussage zweifeln. Der vermutete Kater bleibt aus und bereits nach zwei Tassen Kaffee bin ich am nächsten Tag in der Lage und gewillt, mir die Stadt anzusehen. Wieder einmal scheint die Sonne und Chicago begeistert mich weiterhin. Im Millennium-Park gibt es ein Kunstwerk namens „The Bean“. Dabei handelt es sich um eine riesige Bohne aus Chrom. Ein absolut faszinierendes Gebilde, zu dem ich noch mehrfach zurückkehre. Und auch der Rest des Parks ist der absolute Hammer. Da ein gewisser Abstand zum Strand gewahrt werden muss und es dort keine Gebäude geben darf, hat man die gewünschte Bühne kurzerhand auch in ein Kunstwerk umgewandelt. Mittags gibt’s hier Proben für ein Konzert und so liege ich im Sonnenschein und betrachte die Wolkenkratzer durch die Metallstreben der Bühne. Was machen Wolkenkratzer eigentlich an einem sonnigen Tag wie heute? Eigentlich verfolge ich ja eine kleine Stadttour, im „Lonely Planet“ aber mich zieht das Wasser das Lake Michigan magisch an. Gigantisch und schön liegt der See vor mir und ich freue mich einfach. Hin und wieder schrecke ich hoch. Ein Düsenjäger. Geräusche meiner Kindheit. Aber es ist nicht so, dass die Amis nach wie vor an dieser Tradition festhalten, es findet lediglich die „Air and Water Show“ statt. Und dafür muss man natürlich proben. Die Stadt hat an spannenden Bauwerken noch viel mehr zu bieten, als ich lesen und in einer (kostenlosen!!!) Stadtführung erfahren kann. Mein Führer ist Jude und weit über 80. Er genießt es, Menschen aus aller Welt zu treffen und ihnen etwas über seine Stadt zu erzählen. Und da wir nur 3 Erwachsene und ein Kind sind wird es eine ziemlich gute, individuelle Führung, die statt einer fast zwei Stunden dauert. Durch Regularien wie „Abstand zum Lake Michigan“ und „Wenn du hier ein Hochhaus baust, musst du aber nebenan einen freien Platz in entsprechender Größe gestalten“ etc. ergibt sich ein wunderbares Stadtbild. Die Häuser sind sehr individuell und das obwohl die Verzierungen zeitweise in Massenproduktion hergestellt wurden und aus Katalogen bestellt werden konnten. Was nicht mehr gebraucht wird, wird zwar oft abgerissen und es entsteht neues Bauland, manchmal bleiben aber auch die Fassaden und es wird nur der hintere Teil des Gebäudes neu gebaut. Später erfahre ich auch noch von einem Haus, das keine Verankerung mit dem Boden (und auch mit sonst nix) hat. Wie das funktionieren soll, weiß ich allerdings nicht, es sei denn, Siemens hat doch endlich die Lufthaken erfunden. Faszinierend auch der „Tribute Tower“. In den Wänden sind Steine sämtlicher bekannter Bauwerke eingemauert. Dass man ohne weiteres ein Stück Berliner Mauer für solche Zwecke nutzen kann, ist mir ja klar, aber wie bitte kommt man an ein Stück vom Taj Mahal oder der Wartburg? Läuft da ein kleiner Amerikaner mit Hammer und Meißel durch die Welt und klaut Steine? Zusammen mit dem kanadischen Päärchen aus meinem Hostel erlebe ich dann am Abend das Konzert Millennium-Park in seiner Gesamtheit. Klassik unter freiem Himmel bei Picknick in dieser wahnsinnigen Kulisse. Und das auch noch kostenlos. Ich mag diese Stadt. Zu den letzten Klängen fängt es an zu gewittern und ich bilde mir ein, das Blitz und Pauke zusammenpassen. Welch grandiose Inszenierung! Und am nächsten Tag gibt’s noch einen – ebenfalls kostenlosen – Salsa-Workshop. Bei der Hitze ist das mit der sportlichen Betätigung zwar ein ständiger Kampf gegen die Dehydrierung, aber den nehme ich in Kauf. Ganz offensichtlich ist man hier bemüht, seinen Einwohnern und den Besuchern so einiges zu bieten, was sie aus den Stadtteilen fern hält, in denen „Drive-by-Shootings“ an der Tagesordnung stehen. Schon erschreckend, was man so hört, gleichzeitig scheint es einem so unglaublich, wenn man sich eben nicht in den entsprechenden Vierteln aufhält. Zitat meines Stadtführers: „Wenn du Hilfe brauchst, solltest du jemanden fragen. Anderenfalls bringst du ihn um die Möglichkeit, dir zu helfen.“
Weiter geht es nach New York. Eine Stadt, die einen mit Eindrücken fast erschlägt. Aber erstaunlicherweise nicht unangenehm. Falls das geht. Bereits beim Einchecken im Hostel treffe ich wiedereinmal Kanadier und ziehe mit ihnen los. Times Square (warum will ich denn immer Trafalgar Square sagen?), Rockefeller Center (erstaunlich, wie lange man daran vorbeilaufen kann), 5th Avenue, Central Park und was sonst noch so dazu gehört. Irgendwie fühle ich mich klein und ein wenig reizüberflutet. Gleichzeitig fasziniert mich die Dynamik dieser Stadt. Leider haben die beiden Kanadier ein anderes Erkundungstempo als ich. Gemütlich irgendwo hingehen, kurz gucken, schnell weg und sobald man einen unspektakulären Ort gefunden hat, erstmal hinsetzen und ausruhen. Er redet die ganze Zeit, lediglich unterbrochen davon, dass sie gerne mal jammert wie viel sie schon gelaufen ist und wie wenig sie geschlafen hat. Da bin ich ja ein Freund von. Am meisten Sightseeing Enthusiasmus legen die beiden an den Tag, als wir am Times Square in einen relativ großen Spielzeugladen gehen. Er freut sich über alles, was sich bewegt, sie freut sich über die Barbies… Wie gut, dass ich alleine reise. Die beiden abzuhängen ist leider trotzdem nicht leicht und es gelingt mir erst am nächsten Tag. Und da tue ich, was man als Besucher dieser Stadt so tut und fahre mit einem Schiff an der Freiheitsstatue vorbei, um schöne Bilder zu bekommen, erkunde Greenwich Village (sehr netter Stadtteil!!!) und lasse mich ein Wenig von der Großstadt treiben. Außerdem fahre ich nochmal zurück zum Central Park. Das was ich bisher gesehen habe, erscheint mir doch zu klein, um von solch großer Bedeutung zu sein und ja…. wenn man so direkt auf die „Strawberry Fields“ zusteuert, ein Foto macht und wieder geht, bekommt man gar keinen Eindruck von der Größe und Vielseitigkeit dieses Parks. Was heute Park ist, ist komplett von Menschenhand entworfen und geschaffen und so wundere ich mich, dass ich offensichtlich die Einzige bin, die die Felsen erst einmal anfasst, um zu testen, ob sie echt sind. Aber ich bin ja ohnehin eher haptisch veranlagt. Abends gehe ich dann mit dem weiblichen Teil des kanadischen Päärchens noch in das „Institute of Photography“. Er hat keine Lust und außerdem geht er mit seinem ständigen Kommunikationsdrang jetzt sogar ihr auf die Nerven. Dafür ist sie mittlerweile ausgeschlafen. Das freut auch mich. Die Ausstellung ist eher weniger spannend, aber dafür schauen wir uns dann noch Times Square bei Nacht an. Den Strohmverbrauch wüsste ich ja gerne mal. Und wie lange man für meinen Jahresverbrauch all die Lämpchen leuchten lassen könnte. Ja.. ich hätte mich mal etwas früher mit dem Schreiben dieses Textes auseinandersetzen sollen, denn mittlerweile bringe ich die Tage durcheinander und was ich wann gemacht habe… aber eigentlich spielt es ohnehin keine Rolle. Natürlich wollte ich auch den „Ground Zero“ sehen, der hauptsächlich dadurch beeindruckt, dass dort eben nichts mehr ist, außer einer Baustelle. Mitten im dicht gedrängten Hochhaus-Jungle von Manhattan, ist diese riesige Freifläche. Und vor allem der Skyline fehlt etwas, sie wirkt irgendwie gleichförmig und langweilig. Organisiert von Angehörigen und Freiwilligen, gibt es ein Info-Centre und ich mache eine Tour mit Audio-Guide. Natürlich sehe ich auch da nichts, aber die Erfahrungsberichte von Augenzeugen und Familien geben dem Ort doch eine ganz besondere Bedeutung und mir einen tieferen Einblick in die Geschehnisse. Wieder einmal schüttle ich den Kopf über mich selbst. Wie konnte ich die Nachricht über ein Flugzeug, dass ins World Trade Center fliegt denn als so unwichtig erachten, dass ich sie gleich wieder vergesse und Maike und Habi nach ihrer Zigarrettenpause nicht sofort erzähle, was passiert ist. Bei näherer Betrachtung wäre die Info sogar wichtig genug gewesen, aufzustehen und die Pause zu unterbrechen… Mir war auch die örtliche Nähe zur Wallstreet gar nicht so bewusst. Ok, die meisten Amerikaner würden dafür trotzdem ihr Auto aus der Tiefgarage holen, aber sie ist wirklich direkt um die Ecke. Die hohen Gebäude, die keinerlei Licht in die Straße dringen lassen finde ich ein wenig bedrückend und diesen blöden Bullen finde ich auch nicht. Damit bin ich aber nicht alleine, denn andere Touristen fragen mich auch danach. Dafür sehe ich einen Hund, der mit einem Absperrhütchen kämpft. Das muss reichen. Irgendwann lande ich in Chinatown. Hier würd ich ja gerne mal das deutsche Gesundheitsamt hinschicken. Ob die einem erlauben, einfach ein Brett über einen frisch gebuddelten Minikanal auf dem Gehweg zu legen, durch den Fischwasser abfließt? Ich hab ja wirklich nicht vor, irgendwelche albernen Souvenirs zu kaufen, aber an einem New York City-T-Shirt in Trudis Größe komme ich dann doch nicht vorbei. Leider ist es nicht der I love NY-Klassiker, aber ich freue mich trotzdem und auch der Chinese in dem Laden ist sichtlich begeistert, denn er möchte gerne ein Foto von Trudi in ihrem schicken neuen T-Shirt machen. Offensichtlich werden die T-Shirts sonst tatsächlich von irgendwelchen seltsamen Touristen an den lustigen Kleiderbügeln mit Saugnapf ins Auto gehängt. Ich erlaube ihm, Trudi zu fotografieren und fotografiere ihn dabei selbst. So macht man Annas, Chinesen und Schweine glücklich. Dann geht es für mich zur Brooklyn-Bridge und ich warte bis die Sonne untergeht und das ist es wert. Leider lässt sich auch das nicht so auf Fotos festhalten, wie es in der Realität aussieht, aber selbst die Farben auf den Bildern sind schon ziemlich beeindruckend. Also stellt euch vor, ihr seht diesen wunderschönen Sonnenuntergang nach einem sonnigen Tag in einer so spannenden Stadt, wie New York… noch Fragen, ob es mir gut geht auf meiner Reise?
Auf dem Weg in Richtung Süden mache ich einen Stop in Charleston. Der Beschreibung nach ein schöner Ort. Als ich aus dem Bus steige beschlägt mir erst einmal die Brille. Was zum einen daran liegt, dass die Greyhoundbusse bis knapp über dem Gefrierpunkt heruntergekühlt werden und zum anderen an einer Hitze und Luftfeuchtigkeit, die ihres Gleichen sucht. Der Greyhoundmitarbeiter im Dienst weiß nicht, ob es einen Bus in die Stadt gibt, der alte Mann hinter mich schon und so gehe ich zur Bushaltestelle, besser gesagt zu einem minikleinen Schild ohne weitere Informationen auf der anderen Straßenseite. Nach nur wenigen Minuten rieche ich nicht nur knusprig, sondern habe auch meine Wasservorräte fast leergetrunken und fühle mich wie bei einem Sauna-Besuch. Es ist Sonntag und meine Hoffnung darauf, dass ein Bus kommt, bevor ich dehydriert bin, sinkt stetig. Dafür sind die Taxifahrer hier relativ clever und wissen, wo sie gestrandete Backpacker finden. Und so gönne ich mir den Luxus, mich zu dem Hostel bringen zu lassen. Hier kann ich leider noch nicht einchecken und auch mein Gepäck nicht abladen. Also setze ich mich auf die Veranda in einen Schaukelstuhl und lese. Das stand ohnehin auf meiner „To-Do-Liste“ für die USA. Wäre das auch erledigt. Die Aussagen, die ich nachher im Hostel bekomme bestätigen meine Aussage, dass ich mich in diesem Viertel auf keinen Fall nach Sonnenuntergang draußen aufhalten sollte und so schaffe ich es nach dem Einchecken immerhin noch zu einem Supermarkt. Das Hostel ist voll von deutschsprachigen Austauschstudenten, die auf der Suche nach einer Wohnung verzweifeln. Unterkünfte sind offensichtlich entweder unerschwinglich oder unzumutbar. Letzteres heißt: kein Strom, dafür diverses Viechzeug. Ein Mannheimer gibt zwischendurch auf und will wieder nach Hause. Ich habe die Ehre das Telefonat mit seiner Mutter zu belauschen. Er weiß nicht, dass ich ihn verstehe. Die Mädels versuchen es weiter und erzählen im Gegensatz zu besagtem Mannheimer, zu Hause nur die Hälfte ihrer Erlebnisse. Bevor ich weiterreise habe ich noch ein paar Stunden, um den touristisch erschlossenen Teil der Stadt zu erkunden. Das ist schon recht hübsch. Aber auch sehr schick und es ist umso erstaunlicher, dass der Rest der Stadt so heruntergekommen ist. Hier sieht man die zwei Seiten der USA gleich auf einen Blick. Wenn man sich traut.
Ja… auch L.A. muss man einfach mal gesehen haben. Dann ist’s aber auch gut. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele schöne Dinge man hier mit richtig viel Geld kaufen kann und wie offensichtlich jeder hier, eine gewisse Grundeitelkeit besitzt, die weit über dem Durchschnitt der Menschheit liegt. Und das fällt mir mit Sicherheit nicht nur deshalb auf, weil ich eine Weile in Berlin gelebt habe und seit einigen Wochen mit dem Greyhound unterwegs bin. Zumindest in Santa Monica (ob man das zu L.A. zählen möchte oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen) erscheint mir alles einfach schön, surreal schön. So schön, dass ich es schon nicht mehr gut finden kann. Bars und Restaurants, anhaltender Sonnenschein, Musik, traumhafte Strände und tatsächlich irrsinnig viele Menschen, die am und um den Strand herum für ihre tägliche Bewegung sorgen. Hier hatte die amerikanische Fitnesswelle ihren Anfang… zugegeben, so wirklich unangenehm ist es gar nicht, gut trainierten Männern dabei zuzuschauen, wie sie an Ringen turnen oder Seile hochklettern. Aber irgendwie springt der Funke dieser Stadt nicht auf mich über. Auch nicht, als ich eine Weile am Strand entlang laufe und in Venice Beach lande. Von einer Sekunde auf die andere befinde ich mich in einer eher heruntergekommenen Hippie-Gegend mit Straßenverkäufern, einem großen Markt mit allerhand bunten Sachen und ich werde schon wieder ständig von irgendjemandem angesprochen. Ich sollte mir ein T-Shirt zulegen, auf dem steht, dass ich nicht „Sweetheart, Honey, Darling oder Lady“ heiße. Warum gibt es die eigentlich noch nicht? Jeder andere, je dagewesene Kommentar wurde doch bereits auf Textil gedruckt und ist an jeder Straßenecke erhältlich… vielleicht ist das eine Marktlücke… vielleicht wäre ich auch mein einziger Kunde. Was mich allerdings wirklich fasziniert ist der Skateboard-Park. Sieht aus wie ein großzügig angelegtes Werk moderner Kunst, hat aber eine Funktion. Die Jungs, die sich dort auf ihren Brettern auslassen, wissen wirklich was sie tun und der Jüngste – vermutlich nicht älter als fünf – steht keineswegs im Schatten der Größeren. Im Gegenteil. Er springt und dreht sich und macht allerhand Kunststücke, die mich mit offenem Mund dort stehen lassen. Am Abend treffe ich Emma, eine Bekannte aus meiner Zeit in Bracknell. Als ich so vor dem Hostel warte unterhalte ich mich mit zwei Mädels und die eine erzählt mir, dass sie am Rodeo Drive Shoppen war und meinte, dass man dort sehr herablassend angeschaut wird, wenn man ganz offensichtlich nicht zu dem Klientel gehört, das dort normalerweise zum Einkaufen kommt. Ohne weiter darüber nachzudenken sage ich so etwas wie: „Ach, das ist ja genau wie in „Pretty Woman“, da scheint der Film ja doch nah an der Realität zu sein.“ Ich ernte einen verwirrten Blick und wir wechseln das Thema. Erst im Laufe der weiteren Unterhaltung wird mir der Grund für die Verständnislosigkeit klar: Als der Film in den Kinos lief, war meine Gesprächspartnerin noch gar nicht auf der Welt… Emma und ich haben uns seit ungefähr 12 Jahren nicht mehr gesehen… erstaunlich, dass sowas in meinem Alter überhaupt möglich ist. Es ist ganz schön viel passiert in der Zwischenzeit, gleichzeitig ist von Beginn an schon wieder alles wie immer und so wird es ein schöner Abend mit so viel Gesprächsstoff, dass wir beide die Zeit vergessen. Natürlich möchte ich mir auch Hollywood ansehen. Gehört ja dazu. Also mache ich mich am nächsten Tag auf zum Hollywood Boulevard und ich muss sagen: ich habe selten einen weniger glamourösen Straßenzug gesehen, als diesen. Das Kodak Theatre mit angrenzendem Shopping-Centre sind ja noch ganz hübsch aber darüber hinaus? Ein heruntergekommener T-Shirt-Shop neben dem anderen. Es ist dreckig, die Häuser sind alt und grau… hier wird auf der Leinwand und unseren Bildschirmen wirklich eine Traumwelt geschaffen. Allerdings finde ich es schon sehr lustig, dass mich Superman auf die Idee brachte, ein Foto von Trudi in den Fußabdrücken von Donald Duck zu machen. Da mich offensichtlich keiner als Filmstar entdecken möchte, verlasse ich diesen Stadtteil dann doch recht schnell wieder. An der Bushaltestelle bin ich mir fast sicher, dass Angelina Jolie an mir vorbeifährt, die sich gerade mit einer alten Dame auf dem Beifahrersitz unterhält. Und war das eben nicht Tom Cruise? In der Nähe meines Hostels setze ich mich in der Fußgängerzone auf einen Bordstein. Sonnenschein, Straßenmusik und eine schöne Tasse Tee… ach, wenn ich so drüber nachdenke ist es hier eigentlich doch ganz schön.
Was in Miami als Regen begann weitet sich auf meiner Fahrt nach Key West zu einem ordentlichen Unwetter aus. Wie schön das ist, im trockenen Bus zu sitzen, aus dem Fenster zu starren und sich über Wind, Regen, Blitz und Donner zu freuen. Die Strecke über die Keys bis hin nach Key West ist ohnehin ein Traum und das Wetter ist lediglich das Tüpfelchen auf dem I. Aber in dieser Region kommt und geht das Wetter relativ fix und so scheint die Sonne wieder gnadenlos, als ich in Key West ankomme. Das einzige Hostel vor Ort ist auch ein Motel und außerdem einer der teuersten und ekelhaftesten Orte, an denen ich bisher war. Mein Mitbewohner ist eine Kakerlake, bestimmt nicht die einzige auf meiner Reise, aber mit Sicherheit eine, die durch einen Hauch an Modernisierung zu vermeiden gewesen wäre. Key West ist sehr Touristisch und es gibt von jedem erdenklichen Gegenstand den „Südlichsten“. Nachdem ich also die südlichste Anna war, schlendere ich die „Innenstadt“ entlang, die wiedereinmal ausschließlich aus T-Shirt Shops und Souvenirläden besteht. Auch hier bin ich nicht zur Hauptreisezeit und so ist es trotzdem noch relativ angenehm. Natürlich komme ich nicht drumherum „Key Lime Pie“ zu probieren. Wow… sowas von lecker! Kulinarisch bisher mein absoluter Favorit. Darüber hinaus geht es hier hauptsächlich um Alkohol und Spaß jeglicher Form. Sehr lustig fand ich daher die Anpreisungen einer Dame vor einem „Etablissement für Erwachsene“: „Cheap alcohol and naked women!“ Als keiner reagiert fügt sie hinzu „Common guys… there is free pizza as well!“
„I’m going to Miami… Miami iami iami…!“ Miami Beach bringt sogar mich dazu, mich ein paar Stunden an den Strand zu legen und mich in der allgegenwärtigen Sonne zu toasten. Hauptsächlich aber möchte ich im Atlantik baden. Mache ich auch, allerdings lässt der Erfrischungsgehalt sehr zu wünschen übrig. Ich wusste ja, dass das Wasser warm ist, aber dass es Badewassertemperatur hat, fand ich dann doch erstaunlich. Und es riecht auch nirgends nach Meer, so wie man es von Nordsee, Ostsee und dem Mittelmeer kennt. Trotzdem ist es schön und die Zeit, die ich brauche, bis ich mich langweile, entspricht ziemlich genau der Zeit, die mein Körper freiwillig in der Sonne verbringt und der Länge einer Flasche Wasser. Außer Strand hat Miami hauptsächlich Restaurants und Clubs zu bieten, aber ausgerechnet in der Partymetropole schlechthin habe ich einmal wieder ein ausgedehntes Schlafbedürfnis und verschiebe den richtigen Zeitpunkt zum Feiern von Tag zu Tag, bis ich schließlich abreise. Als ich in der ersten Nacht um ca. 1 Uhr ankomme ist in meinem Zimmer noch ordentlich was los mit Mädels, die sich schminken, aufdonnern, in zu enge Röcke schießen und schließlich losziehen. Genauso aufgeregt, nur etwas betrunkener und daher nicht weniger geräuschvoll kommen sie auch irgendwann wieder. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern nacheinander und ich brauche zum ersten Mal auf meiner Reise Ohro-Pax und meine Schlafbrille. Und das will was heißen, denn ich kann normalerweise überall schlafen. Egal ob laut/leise, warm/kalt, in Bewegung/an einem Ort, hell/dunkel was auch immer. Aber meine Zimmergenossinnen sind extrem. So langsam entwickle ich einen Hass auf Mädels Anfang 20, die in die große Welt gelassen werden (alle, die das lesen natürlich ausgeschlossen). Sie sind laut, extrem unordentlich, rücksichtslos – warum sollte man auch kleine Lichter anmachen, wenn es große Neonröhren gibt – und glauben anscheinend dass Sie alleine auf dieser Welt sind. An meinem ersten Morgen in Miami gehe ich zum Frühstück und – nachdem ich mich erkundigt habe, ob dort schon jemand sitzt – stelle ich meine Tasse (sorry, meinen Styroporbecher) auf einen freien Platz und hole mir Cornflakes. Während ich gerade die Milch darüber schütte und mich wundere, warum diese sich gelb färbt, sehe ich, wie ein Mädel sich auf meinen Platz setzt und meckert, warum dort Kaffee steht. Ich überlege kurz, ob ich etwas sage in Richtung „Weil die alte Tante, die ca. 1,5 m in Blickrichtung von dir entfernt steht gerne Kaffee zum Frühstück mag“ Entscheide mich aber für ein kurzes, deshalb aber nicht weniger weises, Kopfschütteln. Zum Glück scheinen Jungs in dem Alter etwas weniger ignorant ihrer Umwelt gegenüber zu sein, denn das Mädel bekommt derweil eine Erklärung von ihrem Freund, die wohl ähnlich ausfällt. Nachdem ich in der Zwischenzeit eine ordentliche Schweinerei veranstaltet habe, weil ich versuche in einer Hand Orangensaft und in der anderen eine „Schüssel“ mit Cornflakes zu tragen, räumt sie auch tatsächlich den Platz und das sogar recht freundlich, jetzt wo sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Das mit den Cornflakes ist im übrigen nur passiert weil ich die Stabilität von Styroporschüsseln überschätzt habe. Diese darf man auf keinen Fall nur mit einer Hand halten, dann brechen sie nämlich auseinander. Wieder was gelernt über ein Material, dass in Deutschland bereits in den 80er Jahren als Nahrungsmittelverpackung abgeschafft wurde. Und das sogar bei McDonald’s. Überhaupt… die ökolokischen Fußsspuren, die ich auf meiner Reise hinterlasse, erschrecken mich selbst. Und damit meine ich nicht den CO2 Ausstoß des einzigen Flugzeugs, dass ich bisher genutzt habe, oder Gummiabrieb der Reifen an diversen Greyhoundbussen. Alleine das Einweggeschirr, dass in den letzten Wochen durch meine Hände ging erschreckt mich. Und das ist nur in wenigen Fällen von Pappe. Und noch eine kleine Anekdote meiner Mitbewohnerinnen Anfang 20: Zwei Engländerinnen, die in einem Sommercamp gearbeitet haben und nun reisen (auch ein absoluter Klassiker der Reisekategorien) machen sich für den Abend fertig und wir unterhalten uns. Eine ist schon 21, eine noch nicht, hat aber morgen Geburtstag. Da sie die ganzen 3 Monate in den USA nichts trinken durfte, freut sie sich entsprechend auf den Abend und hofft, bereits vor Mitternacht in die Bar gelassen zu werden. Die beiden schminken sich, machen sich die Haare, ziehen sich an und um und wechseln erneut ihre Klamotten (bin ich die einzige Person, die ohne Hackenschuhe reist?). Um ca. 23 Uhr verlassen sie das Zimmer und ich gehe schlafen. Bereits um ca. 2.00 Uhr werde ich wieder wach und wundere mich, was dort gerade passiert, denn ich kann (und will) die Geräusche nicht ganz deuten. Die „ältere“ von den beiden rückt gerade Mülleimer an das Bett des Geburtstagskindes und versucht, Eimer und Kopf so zu positionieren, dass sie sich zu einem möglichst großen Teil überschneiden, ohne dass der Kopf das Gleichgewicht verliert. Ich kann nicht anders und muss grinsen. So erfahre ich, dass die Gute es wohl etwas zu gut gemeint hat, als sie „endlich“ wieder trinken durfte und alle um sie herum es wohl ebenfalls gut mit ihr meinten. So konnte sie ihren Geburtstag erstaunliche zwei Stunden genießen, wird jetzt vermutlich wunderbar schlafen, während ihre Freundin weiter feiern geht. Wie gut, dass ich nicht aus dem „Fountain of Youth“ getrunken habe und weiterhin altern darf. Ein Grund für meine Tour nach Miami ist, dass ich gerne die Everglades sehen mag und Miami für einen guten Ausgangspunkt halte. In den Everglades gibt es Kanutouren und Ähnliches, was eine schöne Zeit außerhalb der Bespaßungsmeile verspricht. Das einzige Problem: es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die mich zum Nationalpark führen. Egal wie engmaschig ich das Internet durchforste und wie viele Touri-Informationen ich nerve. Meine einzige Chance: eine Tagestour. Ich verabschiede mich also von der Idee des Individualtourismus und buche eine solche. Nichtmal festes Schuhwerk hätte ich gebraucht! Mit dem Bus hin, im Pulk in ein Boot mit Riesenventilator auf dem Rücken. Damit gibt’s eine kleine Rundfahrt, auf der man diverse Aligatoren sieht und zum Glück wenigstens einen kleinen Eindruck von dem erhält, was die Everglades ausmacht. Und obwohl ich mir immer wieder sage, dass es gar nicht gefährlich sein kann, weil sonst schon irgendjemand den Veranstalter verklagt hätte und es diese Touren nicht mehr gäbe, ist mir nicht ganz wohl, als ein Aligator bis knapp vor unser Boot schwimmt. So ganz sicher bin ich mir gar nicht, ob es sich nicht evtl. um dressierte Tiere handelt. Zumindest reagieren sie auf kleine Brotstückchen, die die Guides werfen. Auch, wenn es lächerlich ist, verstecke ich mich hinter meiner Zigarrettenschachtelgroßen Kamera. Was man auf Bildschirm sieht entspricht schließlich nicht der Realität. Hab ich gelernt. Irgendwann. Wir hatten Glück und verlassen das Boot kurz bevor uns ein Aligator frisst und auch bevor es anfängt, in Ströhmen zu regnen. Weiter geht es mit einer Aligator-Show, in der ein Typ, der aussieht wie Bud Spencer nach einer Kur bei den Weight Watchers, einen Aligator, der seit Stunden faul in der Ecke liegt zuerst aufscheucht und dann wieder bändigt. Danach darf jeder für 3 Dollar noch ein Babyaligator halten und ein Foto machen (ja, auch ich habe mitgemacht, als alter Haptiker wollte ich mal wissen, wie sich das anfühlt), dem mit Duck-Tape (das meineserachtens Aligator-Tape heißen sollte) das Maul zugeklebt bekommen hat. Dann wieder auf in den Bus, ab in eine Einkaufspassage, wo man sich zur Mittagszeit mit Essen, Souvenirs und auf Wunsch auch Hundebekleidung jeglicher Art, eindecken kann. Und schon sind wir wieder im Bus und machen eine Stadtrundfahrt. Miami ist schon schick. Downtown lebt nur von Banken und Büros, sämtliche Promis versammeln sich auf einer Insel und in „Little Havanna“ gibt’s guten Kaffee (wenn nicht gerade Sonntag ist) und handgefertigte Zigarren. Leider habe ich vergessen in Miami Beach Fotos zu machen, bzw. dachte mir, ich mache es an meinem letzten Tag und da hat es so geregnet, dass fotografieren aussichtslos war. Dort gibt es nämlich ein Art Deco Viertel, praktisch sämtliche Hotel und Restaurantbauten, die in der angesagten Gegend am Strand liegen, sind also entsprechend hübsch. Ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste für die USA ist: in einem Waschsalon Wäsche waschen. Wenn man Hollywood glauben darf, findet man dort schließlich die Liebe seines Lebens. Da mein Hostel keine Waschmöglichkeiten hat, packe ich also alles ein und gehe frohen Mutes in den Waschsalon. Nehme mir ein Buch mit und beobachte meine Mitwäscher… Ich will ja hier nicht allzu kritisch erscheinen, aber wenn das die Auswahl ist, die ich für die Liebe meines Lebens habe, dann lehne ich dankend ab und freue mich über meine saubere Wäsche!
Nun geht meine Reise an einen Ort, der eine ähnliche Faszination auf mich ausübt, wie… sagen wir… ein Unfall auf der Autobahn. Man will ihn sehen, Details wissen, aber wirklich gut finden, wird man ihn bestimmt nicht. Was eine gute Entscheidung, dass ich meine Reise mit dem Greyhound bestreite, denn so kann ich die Landschaft genießen, die vor den schmutzigen Fenstern an mir vorbei zieht. Es ist einfach schön, wie sie sich verändert, langsam immer mehr zur Wüste wird, aber immer vielseitig und diese unglaubliche Weite! Als wir auf Las Vegas zukommen, ist es bereits dunkel und so liegt ein gigantisches Lichtermeer vor uns, dass mich zugegebenermaßen beeindruckt. Mein Ipod ist auf Shuffle-Modus und gerade als wir die Stadt erreichen läuft das Pipi Langstrumpf Lied. Ja… hier hat sich wirklich jemand die Welt so gemacht, wie sie ihm gefällt. Und mal eben eine Stadt in die Wüste gebaut. Kann es einen passenderen Song geben? In dieser Stadt versucht offensichtlich jeder, irgendwie an Geld zu kommen und so glaubt doch tatsächlich ein „Taxifahrer“ an der Greyhoundstation, dass ich in einen alten, extrem zerbeulten Pick-Up steige, in der Hoffnung, in meinem Hostel anzukommen. Zum Glück haben die Amis die Angewohnheit, die richtigen Taxen ordentlich zu beschriften und auch diese finden sich problemlos. Da die Hostelaktivitäten in Chicago so lustig waren und ich meinen Geburtstag zwar genossen, aber noch nicht gefeiert habe, ist es nicht gerade schwer, mich davon zu überzeugen, an der abendlichen Las Vegas Tour teilzunehmen. Eine Hammer-Limousine, 7 Hostelgäste, 1 Guide, erst Fotos am Las Vegas Schild, dann 2 Clubs, Getränke inklusive… ein sehr spaßiger Abend und ich sage mal… es heißt nicht umsonst „What happens in Vegas, stays in Vegas!“ Nachdem ich ordentlich ausgeschlafen habe und meinen Schlaf dann noch einmal um ein Stündchen verlängert habe, weil es aus irgendeinem Grund kein Wasser zum Duschen gab (war das mit der Stadt in der Wüste vielleicht doch keine so grandiose Idee), schaue ich mir am Nachmittag den „Strip“ bei Tageslicht an. Strahlender Sonnenschein rückt den bekannten Vegas Boulevard einfach nicht ins richtige Licht. Die großen Hotels und Casinos mit all ihrem Schnickschnack drumherum wirken dermaßen surreal und deplatziert, während die Touristen planlos herumlaufen und nicht so ganz zu wissen scheinen, was sie tun sollen. Schließlich ist es (für einen Großteil) noch nicht spät genug zum Trinken. Es ist wiedereinmal wie ein Blick hinter die Kulissen. Diese Stadt ist wirklich nur für die Nacht gemacht und so ziehe auch ich am Abend wieder mit ein paar Leuten aus dem Hostel los. Wir fragen uns, ob die Bildchen spärlich bekleideter Frauen, die man an sämtlichen Zeitungsautomaten findet, wohl einen ähnlichen Zweck erfüllen, wie Pokémon Sammelbilder, schauen uns im „Circus Circus“ (aus irgendeinem Grund immer wieder irrtümlich als „Casino Casino“ bezeichnet) eine Show an, spielen ein wenig an den Automaten, an denen auch Kinder spielen dürfen (welch grandiosen Mist man bekommt, wenn man die Gewinnmärkchen eintauscht) und gehen schließlich in ein weiteres Casino, in dem es Bier für 1 Dollar gibt. Natürlich müssen wir wiedereinmal unsere Ausweise zeigen und nach Kontrolle meiner Begleiter, die allesamt Anfang zwanzig sind, guckt der Barkeeper auf meinen Ausweis, guckt mich an, guckt wieder auf meinen Ausweis und sagt: „1980… I don’t know anything about that!“ Danke. Schau mal in dein Geschichtsbuch. Leider haben sie die Spielautomaten abgeschafft, in die man Geld einwirft und (mit etwas Glück) Geld gewinnt. Man kann zwar noch Geldscheine reinstecken, bekommt aber einen Ausdruck, den man entweder in die nächste Maschine steckt, oder eintauscht. Das zügelt meine Spielsucht enorm, denn ohne das klimpern ist es irgendwie nicht so spaßig. Natürlich spiele ich trotzdem (schließlich geht es hier ums Prinzip, man spielt hier einfach) und beim Pokern am Computer gewinne ich irgendwann 20,00 Dollar. Damit habe ich alles wieder raus, was ich an dem Abend esse, trinke und verspiele und es reicht noch für eine Runde Bier für alle. Ich bin halt einfach ein Glückskind.
Knapp zwei Wochen Alaska liegen vor mir. In jedem Fall eines der vielen Highlights meiner Reise. An so vielen Orten habe ich mich beeilt, damit ich es noch schaffe, im September nach Alaska zu kommen. Das zählt noch als Sommer, danach ist es kalt, die Fähren fahren nur noch selten und viele Unterkünfte schließen. Und auch jetzt ist es an manchen Orten nicht mehr so einfach, etwas zu finden. Nicht, weil es viele Reisende gibt, sondern im Gegenteil, weil einige Hotelbesitzer im Urlaub sind, den Winter bereits eingeläutet haben etc. Ich freue mich auf das was mich erwartet, ohne genau zu wissen, was es sein wird und ich freue mich darauf, dem Sommer doch für ein paar Tage zu entfliehen. Mit er Fähre geht es zunächst durch die Inside Passagen nach Haines und man merkt, dass die Saison zu Ende geht. Nur wenige besteigen das Schiff mit mir und am Fährhafen habe ich kurz Angst, die ca. 66 stündige Fahrt alleine mit einer Gruppe Rentner erleben zu dürfen. Noch bevor es losgeht, werde ich von einer alten Dame adoptiert, die mich und meine Reise total spannend findet und das auch noch, nachdem ich ihr erkläre, dass ich nicht die Autorin von „Eat, pray, love“ bin. Sie und ihre Freunde haben sich für eine wirkliche Kreuzfahrt mit der Fähre entschieden. Einfach nur bis nach Haines und zurück, ohne Aufenthalte, nur mit Landgängen. Irgendwann, schon nachdem der Polizeihund unsere Taschen und Koffer nach Drogen untersucht hat, kommen zwei Schweizerinnen, die das Durchschnittsalter erheblich senken. An Bord sammeln sich dann doch noch ein paar andere junge Leute auf Deck an. Hier kann man nämlich zelten, oder auf Sonnenliegen unter einem kleinen Dach schlafen, das geheizt wird und wohl meine Unterkunft für die nächsten Tage sein wird. Natürlich kann man auch Kabinen mieten, aber die hätten meinen Fahrtpreis verdoppelt. Das hab ich nun wirklich nicht eingesehen. Die beiden Schweizerinnen hatten sich dazu entschieden, blicken aber schon sehr neidisch, als sich langsam eine kleine Zeltstadt auf dem Oberdeck bildet. Ihr glaubt gar nicht, was für einen Spaß man haben kann, wenn man andere Menschen beim Zelte aufbauen beobachtet. Päärchen, bei denen man genau sieht, dass er die Idee auf Deck zu zelten total gut findet und sie… eher nicht. Zwei Mädels, die sich erst bei etwas mehr Wind dazu entscheiden, ihr Zelt zu sichern, ein einzelner Typ, der so lustig mit der Zeltplane gekämpft hat, dass wir ihm dann später doch geholfen haben, als er in eine etwas windstillere Ecke umgesiedelt ist und ein absoluter Fähr-Zelt-Profi, der sich die ruhigste Stelle suchte, kleine Schnüre an die Zeltstangen band und diese dann mit ordentlich Gaffa-Tape fixierte. Für die Variante auf den Sonneliegen unter dem überdachten Teil des Decks entschieden sich außer mir nur diverse Männer, die vermutlich hauptberuflich zur See fahren und eine Frau, die mit hoher Wahrscheinlichkeit früher einmal ein Mann war (oder zumindest eine Russische Geheimagentin) und noch vor Einbruch der Dunkelheit doch unter Deck Unterschlupf sucht. Ich frage mich, ob ich nicht vielleicht die falsche Zielgruppe für diese Schlafgelegenheit bin und daher eventuell auch nach drinnen umziehen sollte. Da ist es aber nicht so bequem und ich werde nicht als erstes (naja, zweites, nachdem ich meine Brille angezogen habe) die wunderbare Aussicht genießen können… umziehen kann ich ja immer noch. Platz genug ist ja… und so entscheide ich mich für die Outdoorvariante. Und die Entscheidung war gut. Nur einer meiner Nachbarn hat geschnarcht, die Heizstrahler haben mich relativ warm gehalten und ziemlich früh „auf hoher See“ wachzuwerden und diese unglaubliche Natur zu beobachten hat schon eine ganz besondere… ich bin fast dazu geneigt zu sagen: Romantik. Nach zwei Nächten, als es stetig kälter wird und die ersten Gletscher in Sicht sind, beschließe dann aber doch, genug romantische Erfahrungen auf dieser Fähre gesammelt haben und schlafe in der dritten Nacht lieber drin. Die Tage auf der Fähre haben schon ihre ganz eigene Dynamik. Man wird früh wach, geht früh ist Bett und zwischendrin lebt man von Mahlzeit zu Mahlzeit. Die Landschaft ist so unglaublich schön, so dass man Stunden damit verbringen kann einfach nur zu schauen, wie sie sich verändert. Hin und wieder sieht man Wale, die munter durch die Gegend springen – ich Depp hab in Tadoussac 45 Dollar für’s Whale Watching bezahlt. Wäre ich ein Wal, so wäre Alaska vermutlich meine Wahlheimat. So schön, wie es hier überall aussieht. Ich fotografiere wie eine Wilde, aber das was ich sehe und wie ich es sehe, lässt sich einfach nicht auf SD-Karte bannen. Wir haben riesiges Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint und zumindest die Einheimischen tragen T-Shirt und kurze Hose. Ich fürchte mich einfach nur davor zugeben zu müssen, mir ausgerechnet in Alaska einen Sonnenbrand geholt zu haben. Da die größten Touristenströhme abgeebbt sind, ist die Anzahl der Passagiere überschaubar und so kommt man außerdem leicht ins Gespräch. Der vermeintliche Fähr-Zelt-Profi macht das tatsächlich nicht zum ersten Mal. Er will nach Alaska zum Fischen. Weniger aus Interesse am Fisch, als wegen der Entspannung. Alle paar Stunden freut er sich auf den „Car Deck Call“, denn dann ist es den Passagieren für ein paar Minuten erlaubt, zu ihren Fahrzeugen zu gehen und die unglaubliche Menge an Hunden (und wie ich bemerke auch Katzen) zu füttern und zwischen den Autos „Gassi“ zu führen. Sieht sehr lustig aus. Ich treffe zwei weitere Schweizer (sagt mal: ist das Land gerade komplett leer?), die mit dem Landrover auf einer Panamerika-Tour sind. Ein Jahr vom Süden in den Norden. Zwei Monate haben sie noch vor sich. Außerdem drei Amerikanerinnen. Eine zieht für ein Praktikum nach Juneau, eine hat mal in Alaska gelebt und eine ist Alaskanerin/Alaskino/Alaskinenser oder wie auch immer man das nennt. Letztere hat einen alten VW-Bus gekauft, der nun von Bellingham nach Haines überführt werden soll. Von dort aus will sie, zusammen mit ihrer Freundin das Auto nach Anchorage bringen. Dort wird es bleiben, denn zu dem Ort in dem sie lebt (die Region wird liebevoll die Achselhöhle Alaskas genannt) gibt es keine Straßen. Sie reist gerne, aber ihren Freund hat sie nur ein paarmal mitgeschleppt. Er mag reisen nicht so gerne, er mag lieber „Alaskan stuff“ (Dinge, die man so in Alaska tut). Ich frage, was das ist und sie sagt: „Jagen, Waffen und Fischen“. Das sind noch echte Männer. Nicht umsonst sagt man hier wohl zu Frauen, die einen Mann finden möchten: „Your odds are good, but your goods are odd!“ („Deine Chancen sind gut, aber was du bekommst ist seltsam!“ Von Haines bis Anchorage sind es ca. 1000 Meilen, was eine nicht unwesentlich größere Vorbereitung, Nahrungs- und Benzinvorräte und gute Tipps gegen Bären bedarf, als die gleiche Strecke in Europa. Ich überlege kurz, ob ich meine Pläne über den Haufen werfen und die Mädels begleiten soll, aber wir sind und nach kurzer Debatte recht schnell einig, dass ein Flug zurück die einzige Möglichkeit und gleichzeitig unverhältnismäßig teuer sein würde. Abgesehen davon, dass wir auf dem Schiff keine Chance haben, es herauszufinden. So werde ich auf meiner Reise leider nur die Inside Passagen kennenlernen.
Im Hostel habe ich eine Engländerin kennengelernt mit der ich mich auf den Weg nach San Francisco mache. Ein Ort, der mir vom ersten Moment an gefällt. Allerdings ist es nicht gerade die beste Idee, diese Stadt mit einem Mädel im Rollstuhl erkunden zu wollen. Ja… da hätte ich wirklich drauf kommen können. Und so habe ich wieder einmal nur ein Kopfschütteln für mich übrig, als Caroline und ich auf dem Weg zum Hostel sind. Wie kommt man denn auf die Idee, eine Stadt auf so viele Hügel zu bauen? Wobei… gerade das macht ja den Charme aus. Ob das beabsichtigt war, gerade, weil es so hübsch ist? Ich weiß nicht mehr wer diese These in den Raum geworfen hat, aber ich halte es zunächst für völligen Blödsinn… bis mir wiedereinmal bewusst wird, dass die Städte hier ja eher geplant als entstanden sind und tatsächlich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es irgendein Stadtplaner einfach nur (und das auch noch zurecht) für charmant gehalten hat. Eigentlich gar nicht so dumm. Da die Fahrt von L.A. nach San Francisco Carolines erste Greyhound-Erfahrung war, ist sie allerdings so müde, dass ich bis zum Abendessen alleine losziehe. Hier ist man wirklich nie „auf dem Berg“ oder „über den Berg“, sondern immer nur „zwischen den Bergen“. Kein Wunder, dass die Bevölkerung hier allem Anschein nach ein geringeres Problem mit übermäßiger Gewichtszunahme hat, als im Rest des Landes. Und so tue auch ich etwas für meine Wadenmuskulatur und freue mich, an jeder Ecke wieder etwas neues zu entdecken, was ich vorher noch nicht sehen konnte. Das Einzige, was ich dabei nicht sehe, ist die Golden Gate Bridge, denn die versteckt sich im Nebel. Macht sie ja gerne. Ich schätze, so stellt die Stadt sicher, dass Tagestouristen wiederkommen und noch einmal Geld in der Stadt lassen. Natürlich fahre ich auch mit den Cabel Cars und freue mich über die „Crockedest Street“. Wobei ich mich hier hauptsächlich an den anderen Touristen erfreue, die sich selbst dabei filmen, wie sie durch die Serpentinen fahren, versuchen mit dem Fahrrad in entgegengesetzter Fahrtrichtung herauf zu kommen etc. Ein munteres Spektakel, dass auf den vorbeiführenden Straßen für ein leichtes Chaos sorgt. Als Anwohner umfährt man diese Ecke vermutlich. Alle scheinen wahnsinnig aufgeregt und erfreut, wenn sie diesen Berg herunter fahren und ich bin kurz versucht, mir entweder einen freien Platz bei anderen Reisenden zu suchen, oder mir ein Taxi zu nehmen. Zum Glück merkt mein Verstand dann doch noch rechtzeitig an, dass es sich lediglich um fünf aneinandergereihte Kurven an einem Berg handelt und dass Menschenbeobachten vermutlich ohnehin das Spaßigste ist. Am Abend trainiere ich dann auch noch meine Arme, denn egal, welche Richtung Carolin und ich auf der Suche nach etwas zu Essen nehmen, irgendwann geht es immer bergauf. Komisch, dass mir erst jetzt auffällt, wie viele Metaphern man zum Thema Leben und San Francisco machen könnte… Um meiner Reise einen gewissen Bildungsfaktor hinzuzufügen, buche ich für den nächsten Tag eine Wein-Tour. Eine sehr gute Idee, wie sich schnell herausstellt. Drei Weingüter in Napa Valley und Sonoma und entsprechend viele verschiedene Weine. Dazu eine Busfahrt durch die traumhafte Landschaft der „Wine Country“. Ja… das Leben ist zugegebenermaßen hart. Im Bus sitze ich zufällig neben einer Kanadierin, die feststellt, dass wir am Vortag bereits im Cable Car nebeneinander gesessen haben. Diese Welt hat doch schon wieder zu wenige Statisten. Vermutlich ist die ganze Crew statt mit dem Cast damit beschäftigt, die außergewöhnlichen Landschaften herzustellen, die ich tagtäglich zu sehen bekomme. Und so sehe ich auf dem Weg zurück dann auch endlich die Golden Gate Bridge. Wiedereinmal kann ich nicht in Worte fassen, wie schön es aussieht, als die roten Metallpfeiler plötzlich hinter den goldenen Hügeln auftauchen. Natürlich ist wieder jeglicher Versuch vergeblich, diesen Moment auf einem Foto festzuhalten.
Mein kurzer Aufenthalt in Haines ist irgendwie eine Reduktion auf das Notwendige, zurück zur Natur und so beschränke ich meine Aktivitäten auf Schlafen, Essen, Laufen und Kajakfahren. In meiner ersten Nacht komme ich so auf unglaubliche 14 Stunden Schlaf. Mit nur einer kurzen Unterbrechung und dem kleinen Kampf, ob ich wirklich so dringend muss, dass es sich lohnt aufzustehen und durch die Kälte einmal über den „Hof“ zu laufen. Es hat sich gelohnt, aber die Überwindung war groß. Haines ist ein kleiner Ort, der von den Touristenmassen noch relativ verschont ist. Zwar gibt es auch hier das eine oder andere Kreuzfahrtschiff und außerdem eine Schnellfähre von und nach Skagway (Touri-Mekka), aber viele Einwohner wohnen hier tatsächlich das ganze Jahr über und die Stadt hat eine echte Infrastruktur und nicht nur Souvenir-Läden. Es ist das Ende der Saison und ich habe wirklich Glück, noch an einer Kajaktour teilnehmen zu können. Der letzten der Saison, denn zum letzten Mal kommen Kreuzfahrt-Touristen mit der Schnellfähre nach Haines. Über Reisende, die unabhängig von den Kreuzfahrtschiffen ankommen ist man hier eher verwundert und so werde ich in jedem Geschäft etc. gefragt, ob ich denn jetzt in Haines wohne. Nein, tue ich nicht. Würd’ ich aber. Alaska muss man einfach lieben. Trotz Sonnenschein ist es nicht übermäßig warm (ca. 6 Grad) und ich schwitze nicht und rieche folglich nicht knusprig. Hier gefällt es mir einfach. Das Hostel ist ca. 2 Meilen außerhalb von Haines, gute Laufentfernung und als ich frage, ob man das auch so ohne weiteres tun kann (bin da ja doch etwas vorsichtig), bekomme ich die Auskunft, dass ich es lediglich früh morgens und abends vermeiden sollte, wegen der Bären. Das ist in der Tat eine Gefahr, über die ich noch nie nachgedacht habe. Warum auch. Gibt ja keine Bären in Deutschland und wenn es mal einen gibt, ist es gleich ein riesiges Thema (der arme Bruno…). Wenn man hier vor Bären gewarnt wird, ist das nur zum Teil aus Sorge um die Mitmenschen, denn wenn ein Bär einen Menschen angreift (was er nur tun wird, um sich zu verteidigen), wird er erschossen. Und die Menschen hier mögen ihre Bären. Aber die Menschen hier sind auch sonst extrem freundlich, jeder grüßt und nach nicht einmal zwei Tagen kennt mich ohnehin der ganze Ort. Außerdem merkt man einfach an jeder Ecke, dass die Saison vorbei ist. Im Hostel wohnt außer mir nur noch eine Engländerin, die ihre Doktorarbeit in Haines schreibt. Alle anderen Cabins sind leer und jeder scheint sich auf den Winter vorzubereiten. Irgendwie ist das eine ganz besondere Stimmung. Das Leben ist hier ein ganzes Stück langsamer. Eine „Kreuzfahrerin“ die ich auf meiner Kanutour treffe nannte es „primitiv“. Das würde ich aber überhaupt nicht sagen. Hier hat man einfach andere Prioritäten und bei einer Entscheidung zwischen warmen Socken und IPhone würde hier wohl jeder die warmen Socken wählen. Hier sind die Autos alt und dreckig und die Pick-Ups werden (im Gegensatz zum Rest der USA) zum Transportieren benutzt. Meist ergänzt durch ein bis zwei übergroße Hunde, die auf der Pritsche den Fahrtwind genießen. Die Internetverbindung im Hostel funktioniert nicht mit jedem Rechner, Cafés mit Wi-Fi gibt es nicht, man muss also in die Bibliothek. Dort gibt es Computer mit Diskettenlaufwerken und auch für viele Einheimische scheint es die einzige Möglichkeit zu sein, ins Netz zu kommen. Aber an so einem wunderbaren Ort ist es einfach egal, wenn man auf den gewohnten Luxus verzichten muss. Wenn man durch die frische Luft läuft, die alten Häuschen betrachtet, mit dem Kajak über einen See fährt, Adler beobachtet, oder einfach nur die Berge anstarrt, bleibt die Zeit ohnehin stehen. Ihr glaubt gar nicht wie viel Zeit ich mit Berge anstarren verbringe und ich habe Angst, dass diese irgendwann zurückstarren. Und apropos anstarren: nach meiner Kajaktour, sehe ich vom Bus aus Bären. Braunbären, um genau zu sein. Noch genauer: Speedy mit ihren zwei Kleinen. In guter Entfernung und aus einem Bus ist das Bärenbeobachten ohnehin am besten und so gibt es genug Zeit zum Fotos schießen. Speedy ist stadtbekannt, denn sie hat als Junges nicht das Fischen gelernt (und ich sage euch: in Haines könnte sogar ich Lachse mit der Hand fangen, so viele gibt es da). Als sie also von zu Hause auszog ist sie in die Stadt gelaufen und hat sich über den Müll her gemacht. Nicht gerade das, was Anwohner gerne mögen und auch nicht gut für den Bär selbst, denn das führt früher oder später dazu, dass er erschossen wird. Also wurde alles versucht, um Speedy davon abzuhalten. Mit Gummipatronen wurde sie daher immer wieder verscheucht und nach ca. einem Jahr hat man sie dann tatsächlich beim Fischen beobachtet. Die regionalen Zeitungen waren voll und alle haben sich gefreut. Jetzt hat Speedy selbst zwei Junge und zeigt ihnen, wie man fischt. Und ich durfte sie sogar dabei beobachten und ein Foto machen. Ende gut, alles gut. Das Leben kann so schön sein.
Es geht weiter nach Juneau. Hauptstadt von Alaska. Warum auch immer. Neben Skagway und Ketchikan ist Juneau eine der Touristenhochburgen, hat aber sonst nichts städtisches. Täglich legen hier mehrere Kreuzfahrtschiffe an, teilweise mit Kapazitäten von bis zu 40 000 Passagieren (hab ich auch nicht geglaubt, aber dann habe ich die offiziellen Infos des Tourismusbüros gesehen). Letztere werden dann an Land geschwemmt, strömen in die zahlreichen Geschäfte, in denen es Pelze, T-Shirts, Diamanten und allerhand Nippes gibt und werden dann irgendwann wieder von den riesigen Schiffen verschlungen und verschwinden hinaus aufs Meer. So stelle ich mir das zumindest vor. Als ich in Juneau ankomme, ist die Saison vorbei und die Stadt bereitet sich auf den Winterschlaf vor. Das bedeutet nicht nur, dass die Straßen ausgestorben sind, sondern auch, dass die Geschäfte schließen. Außerdem starrt mich ein Berg an. War ja klar, dass das irgendwann passiert. Dieser wirkt unglaublich böse und hat sich außerdem eine Wolkenmütze aufgesetzt. Ich erwische mich dabei, wie ich mich immer wieder hektisch umschaue, um zu sehen, ob er mich verfolgt. Wieder einmal kommt es mir so vor, als könnte ich hinter die Kulissen einer Touristenattraktion blicken, als ich bei strömendem Regen nahezu alleine durch eine geschlossene Einkaufsstraße laufe. Gerade habe ich das Gefühl der letzte Tourist in dieser Stadt zu sein, als ich um die Ecke biege und die beiden Schweizerinnen von der Fähre wiedertreffe. Die zwei hatten gerade einen ähnlichen Gedanken und so war die Freude über das Wiedersehen umso größer. Die Welt ist so klein. Und da ich am Abend ohnehin eine der Amerikanerinnen von der Fähre treffen möchte, passt das natürlich. Man sollte nie die Gemeinschaft auf einer Fähre unterschätzen. Wir wollen herausfinden, ob es um diese Jahreszeit noch irgendwie möglich ist, zum „Glacier Bay“ zu kommen, aber da keines der zahlreichen Münztelefone funktioniert, gehen wir schließlich in ein Café mit Wi-Fi. Telefonieren funktioniert zwar auch hier nicht, aber als wir uns so auf deutsch unterhalten, spricht uns irgendwann ein Mädel an. Sie ist aus Juneau und freut sich einfach nur, deutsch zu hören. Wir unterhalten uns kurz und es stellt sich heraus, dass sie Austauschschülerin am Johanneum war. Das verkleinert die Welt erneut und steht nun ganz oben auf meiner Liste der Zufälle. Da ich etwas bei den Fähr-Zeiten falsch verstanden habe und das Hostel komische Öffnungszeiten hat, habe ich für die erste Nacht in Juneau ein Zimmer in einem Motel gebucht. Finanziell doch keine so schlechte Entscheidung, denn der Fährhafen ist 40 Dollar mit dem Taxi von der Innenstadt entfernt und Busse fahren abends nicht. Mein Motel aber hat einen kostenfreien Shuttledienst. Manchmal muss man einfach Glück haben. Und außerdem bringt mir diese Entscheidung eine Nacht lang absoluten Luxus. Ein riesiges Bett, so hoch, dass ich mit den Füßen nicht auf den Boden komme, einen Fernseher und ein Bad, ganz für mich alleine. Bevor ich es gesehen habe, war mir gar nicht bewusst, wie schön das sein kann. Selten habe ich eine Dusche so genossen… Für die nächsten beiden Nächte ziehe ich dann aber doch ins Hostel um und wenn ich schonmal mit Gepäck durch den Regen laufe, da nehme ich doch auch gleich einen Umweg… ich Pappnase. Aber so kann ich mich umso mehr freuen, als ich endlich ankomme. Das Hostel ist billig, dafür muss man täglich eine kleine Aufgabe verrichten. So staubsauge ich den Gemeinschaftsraum und putze ein Schuhregal. Ja, ich bin mir vollkommen darüber bewusst, dass es seltsam klingt, aber nachdem ich 2 Monate lang keinen Handschlag getan habe, fühlt sich das Putzen eines Schuhregals unheimlich produktiv an… nahezu ein Glücksgefühl. Kein Glück habe ich hingegen mit dem Wetter in Juneau. Wer ein Jahr lang Urlaub macht, sollte sich aber nicht über ein oder zwei Regentage ärgern und so nutze ich die Zeit, meine Reiseberichte aufzuholen. Im Café sitze ich mit dem Rücken zu dem bösen Berg und fühle mich beobachtet. Irgendwann kommt ein Alaskaner/Alaskinenser/Alaskit herein, den ich schon von der Fähre kenne (ja…. Juneau ist klein) und erklärt mir, dass das der „Mount Juneau“ ist. Dort kann man gut wandern gehen, dauert auch nicht zu lange, aber dafür sind dort schon diverse Leute gestorben. Sag ich doch. Der Berg ist böse. Ein Ausflug muss aber trotz des schlechten Wetters sein und ich will auch endlich einmal einen Gletscher sehen. Wofür bin ich sonst in Alaska? Also fahre ich mit einem Amerikaner aus dem Hostel zum Gletscher, oder zumindest so weit, wie uns der Bus führt. Dann noch ca. 30 Minuten laufen und wir können ihn sehen. Mein erster Gedanke: „Der ist aber dreckig. Wir sind doch in Amerika, warum putzt den denn keiner?“ Natürlich ist das vollkommener Unfug, aber mich würde hier ja ohnehin gar nichts mehr wundern. Als ich mich später im Hostel mit einem Mädel unterhalte, dass für den „Forest Service“ arbeitet, erzählt sie mir, dass sich tatsächlich schon einige Touristen beschwert haben. Aber Gletscher putzen ginge zu weit. Stattdessen hat sie den ganzen Tag damit verbracht Moos auf Steine zu legen. Beim Räumen und Arbeiten wurde das von den Steinen gekratzt und damit es wieder schön aussieht, kam ein großer Laster mit Moos. Ach ja: Felsen anmalen kommt auch hin und wieder vor, wenn etwas abgeplatzt ist oder so… Schon klar… dann will ich auch nen sauberen Gletscher… diese Amerikaner sind schon komisch, ich fasse also zu recht sämtliche Steine an!
Ein weiteres Kleinod auf meiner Reise durch Alaska. Wrangell ist wirklich nicht schön, aber es hat einen unglaublichen Reiz. Wrangell ist eine echte Kleinstadt. Hier gibt es keine Diamanten zu kaufen, im Gegenteil, wer Samstags Milch kaufen will hat keine Chance. In Wrangell merkt man noch, dass Alaska sehr nah an Russland liegt. Dass es in Geschäften irgendetwas nicht mehr gibt liegt an der Tagesordnung und die Menschen hier haben sich damit arrangiert. Normalerweise gibt es in Wrangell ein großes Angebot an Touren etc., alles entsprechend naturverbunden und spannend, denn wer sich als Tourist hier her verirrt, kommt nicht mit dem Kreuzfahrtschiff. Allerdings merkt man auch hier, dass die Saison vorbei ist, denn trotz diverser Telefonate und einem Besuch im Tourismusbüro gibt es für mich nichts zu tun.Wäre ich eine Gruppe, ließe sich noch etwas arrangieren, aber so… Außer den beiden Sehenswürdigkeiten des Ortes: Petroglyph Beach – einen Strand mit Stein-Inschriften der Ureinwohner- und einen Park mit Totempfählen gibt es einfach nichts zu tun. Das Wetter ist mies und es regnet in der ganzen Zeit wirklich nur einmal… Das frustriert mich zunächst ein wenig, schließlich ist meine Zeit in Alaska ohnehin knapp bemessen. Am Ende muss ich aber doch sagen, dass mir zwei Tage ohne allzuviele neue Einrücke erstaunlich gut tun. Ich unterhalte mich ziemlich lange mit der Besitzerin des Bed & Breakfast und freue mich, dass sie mir mein Gefühl bestätigt, dass sich die Menschen in Alaska nicht unbedingt als Teil der USA fühlen. Eher als Teil Kanadas. Wenn überhaupt. Es ist eine andere Lebensweise. Naturverbundener und rauer. Hier weiß man noch, wie man Fische fängt oder ein Tier erlegt. Wer Beeren will, pflückt sie, statt sie im Supermarkt zu kaufen, jeder kennt jeden und die Nähe zur Natur mit all ihren Gewalten ist allgegenwärtig. Eine Art zu leben, die mir (und vermutlich einem Großteil der westlichen Welt) absolut verloren gegangen ist. Meiner Beobachtung zur Folge sind die Menschen hier aber keineswegs unglücklicher, als in anonymen Großstädten. Im Gegenteil…
Viel zu schnell ist meine Zeit in Alaska vorbei. Hier muss ich definitiv wieder hin und dann auch weiter in den Norden, das „richtige“ Alaska erkunden. Trotz der rauen Bedingungen ist Alaska einfach eine Gegend zum Wohlfühlen. Es hat sich definitiv gelohnt, dass ich mich im Rest der USA ein wenig beeilt habe. Als ich auf die Fähre komme, begrüßen mich zwei ältere Damen, die ich bereits einige Tage zuvor beim „Landgang in Sitka“ getroffen habe. Um diese Jahreszeit kommen wirklich nicht mehr viele Menschen nach Alaska., man kennt sich eben. Auf der ersten Fahrt habe ich erzählt, welches Hostel ich in Prince Rupert gebucht habe und die Damen (insgesamt drei), haben sich daraufhin für die gleiche Unterkunft entschieden. Wir essen zusammen, aber mich zieht es wieder zu meinem Puzzle, dass ich gleich zu Beginn der Fahrt angefangen habe. Ich habe nicht gepuzzelt seit….. vermutlich seit ich das Wort „Zeitverschwendung“ kenne, aber hier auf der Fähre ist es genau das, was ich machen möchte. Und es fesselt mich. Vielleicht auch, weil das Motiv der von mir so hochgeschätzte Grand Canyon ist. Vielleicht aber auch einfach nur, weil ich auf dieser Fähre ohnehin nichts wirklich sinnvolles zu tun habe und außerdem offensichtlich entspannt genug bin, mich einer solch sinnlosen Tätigkeit hinzugeben. Zuerst freue ich mich darüber, dann muss meine Selbstkontrolle aber doch noch durchgreifen, bevor mich das Puzzle vollkommen um den wohlverdienten Schlaf irgendwo zwischen den Sitzen eines Aufenthaltsraumes bringt. In Prince Rupert angekommen geht es erst einmal durch die Zollkontrolle, ein paar Fragen und ich bin durch. Dann kommt lange Zeit niemand und irgendwann ein Mädel, das um einiges kleiner ist als ich, dafür aber einen viel größeren Rucksack. Plus zwei Taschen. Mary ist Franco-Kanadierin und der Grenzbeamte war bei ihr offensichtlich weniger gnädig. Zumindest den kleinen Rucksack hat er von oben bis unten durchsucht. Vielleicht ist es doch von Vorteil, beim Reisen nicht allzu alternativ auszusehen? Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Glück. Nach einiger Zeit kommen auch die drei älteren Damen (Caroline, Lynn und Ethel) durch den Zoll und sind nicht nur dazu bereit, sich mit mir ein Taxi zu teilen, sondern adoptieren mich gleich. Da mein Zimmer noch nicht fertig ist, ziehe ich für ein Nickerchen bei ihnen ein. Wir frühstücken zusammen, dann gehe ich meinen eigenen Weg, der zugegebenermaßen ein Umweg in die Stadt ist, mir dafür aber einige schöne Ecken zeigt und später treffen wir uns wieder im Hostel. Die Damen mit zwei Flaschen Wein, Crackern und Dip, ich mit einer Riesenportion Weintrauben. Einen festlicheren, lustigeren Nachmittagssnack kann man sich gar nicht vorstellen. Die drei freuen sich, dass ich meine ‘Jugend’ nutze, um die Welt zu bereisen, ich freue mich, dass sie in ihrem Alter zusammen solche Reisen machen und ihr Leben genießen. Am Abend spielen wir Scrabble. Aber eine neue Variante, in der man dreidimensional spielt, das macht es spannender. In der ersten Runde bekomme ich noch hin und wieder Hilfe, weil ich den „Englisch ist doch gar nicht meine Muttersprache“-Joker ziehe. Das ändert sich aber schlagartig, als ich Zweite werde. Nur geschlagen von Ethel, die ohnehin immer gewinnt. Eigentlich dachte ich, ich hätte viele neue Worte gelernt, aber bei näherer Betrachtung habe ich die auch gleich wieder vergessen. Lustig war es aber in jedem Fall und so folgt ein äußerst herzlicher Abschied aus einer Stadt, die sonst wirklich keine Reise wert ist.
Die Tage in Vancouver sind irgendwie eine Art Urlaub vom Reisen. Ich besuche meine Cousine Tini und wir sind – wenn sie nicht gerade arbeiten muss – extrem faul. Wenn sie arbeiten muss, bin ich einfach alleine faul. Die „bei schönem Wetter wird draußen gespielt“-Regel werfen wir einfach über Bord, vergammeln die Zeit, gehen spazieren, schauen Filme und lassen es uns rundherum gut gehen. Es ist schon schön, sich mal wieder mit jemandem zu unterhalten, dem man sich nicht erst vorstellen muss… einmal nicht die üblichen Fragen nach Name, Alter, Herkunft, weiteren/bisherigen Reisezielen etc. beantworten. Einmal nicht gefragt werden, wie man für ein ganzes Jahr packt und was man in Deutschland so tut… An einem Tag, ich hab schon vergessen wann, machen wir uns auf nach Whistler. Zu meinem großen Ärgernis befinden wir uns gerade mitten zwischen der Sommer- und der Wintersaison. Ich bin offensichtlich das „Out of season girl“. Außerdem regnet in Strömen. Ich kann also weder die Ziptrack-Tour mitmachen, noch gibt es sonst irgendetwas Spannendes zu tun oder zu sehen. Super. So bleiben mir nur die Souvenir-Läden und Starbucks. Aber dafür findet Tini am gleichen Tag ein Zimmer für die Wintersaison und so lohnt sich der Ausflug doch noch. Trotz übertriebener Faulheit sehe ich einige schöne Ecken der Stadt, schaue mir einen Film beim Filmfestival an und fahre nach North Vancouver. Hier gibt es eine Hängebrücke. Genauergesagt zwei. Eine kostet Geld, eine nicht. Ich entscheide mich für die kleinere, kostenfreie und finde im Sea-Bus außerdem drei Ozeanier, die aber so oft zwischen Australien, Neuseeland und Kanada hin und hergezogen sind, dass ich den Faden verloren habe woher sie kommen. Einer ist übel verkatert, was einen solchen Ausflug für alle anderen Beteiligten nur noch lustiger macht. Die Jungs haben nichts dagegen, dass ich mich ihnen anschließe und so gehe ich mit dieser munteren Truppe zur Hängebrücke am Lynn Canyon und wir machen noch einen kleinen Spaziergang durch den Regenwald zu den Twin Falls. Unglaublich schöne Wasserfälle in unberührter Idylle. Nur wenige Minuten von Vancouver entfernt. Das begeistert mich schon irgendwie. Vancouver ist glaub ich ein Ort, an dem man gut leben kann. Für einen kurzen Städtetrip super, für längeren Urlaubs-aufenthalt wohl eher langweilig, aber für den Alltag ideal.
Ach nee… wat schön. Mir fehlt leider das Vokabular um wirklich in Worte zu fassen, wie schön es hier in den Rocky Mountains ist. Ich wusste gar nicht, dass ich Berge so schön finden kann. Und hier gibt es so viele. Und die sehen alle anders aus. Und sagte ich schon, dass sie verdammt schön sind? Hinzu kommt, dass Sonne und Wolken offensichtlich nichts besseres zu tun haben, als die Berge in ein möglichst gutes Licht zu rücken und das macht sie nur noch schöner. Hier und da ein bissi Schnee oder ein kleiner See und fertig ist der atemberaubende Ausblick. Vermutlich kann es nicht mal nach Monaten oder Jahren langweilig werden, die Berge anzustarren und sich über die Farben und Formen zu freuen. Man kann hier wirklich keine 10 Meter laufen oder fahren, ohne wieder irgendetwas wunderschönes zu entdecken. Ich fühle mich wie ein Kind an Weihnachten, dass unzählige Pakete auspacken kann, in jedem genau das, was es sich gewünscht hat und die Päckchen werden nicht weniger. Da ich noch nicht im Hostel einchecken kann, gehe ich erst einmal zur Touri-Information. Die hat zwar noch zu, dafür kommt mir der übergroße Rucksack doch irgendwie bekannt vor. Kurze Zeit später taucht auch schon Mary auf. Die Franco-Kanadierin, die bei der Einreise nach Kanada so gefilzt worden ist. Man trifft sich offensichtlich immer zweimal. Mein Hostel ist schon ausgebucht und so ist sie noch auf der Suche nach einer Unterkunft, während ich erst einmal losziehe, um meiner ersten kleinen Wanderung zum „Pyramide Lake“ nachzugehen. Der namensgleiche Berg hat mich schon von Beginn an angezogen, weil er so schön bunt ist. Gleichzeitig ist die Strecke relativ belebt und direkt neben der Straße, also ideal, wenn man alleine unterwegs ist, hier begegnet man so schnell keinem Bären. In dieser Gegend wird man wirklich für jeden Schritt, den man macht belohnt. Sobald man denkt, man hätte das „Highlight“ der Strecke erreicht, gibt es wieder etwas, in diesem Fall eine kleine Insel, von der aus man noch mehr Berge sehen kann, was ein Paar auch gleich zum Anlass genommen hat, dort zu heiraten. Leider gibt es hier nicht so viel Laubwald, die Farben der Bäume sind also eher unspannend, wobei… wenn man mal genauer hinschaut, kann auch ‘grün’ verdammt schön sein. Wieder zurück im Ort, mache ich noch ein paar kleine Einkäufe und dann geht es ab ins 7 km außerhalb gelegene Hostel. Hier gibt es übrigens doch Strom und Wasser. Das hatte ich mit einem anderen, noch etwas weiter abgelegenen Hostel verwechselt. Schon im Shuttle hierher wäre ich fast eingeschlafen, was zur Folge hatte, dass ich beim Einchecken weder Tage, noch meinen Namen noch sonst irgendetwas in einen sinnvollen Zusammenhang bringen konnte. Und wie sollte es auch anders sein, beschäftige ich mich in den folgenden Tagen damit, den Ruf der Verpeiltheit zu verteidigen. Selten so schön meine Sprache verloren. Nach langer Zeit ohne ein Bett, ist der ausgiebige Schlaf schon sehr erholsam und dann geht’s auch schon los auf einen Tagesausflug zur „Columbia Icefield“. Die Eisfläche ist ungefähr so groß wie Vancouver. Leider ist Murphey an diesem Tag mein Reisepartner und – wie sollte es auch anders sein, wenn ich mir einen Gletscher ansehen möchte – es ist grau, verregnet und alles andere als angenehm. Dafür geht es mit dem Buses ca. 100 km den „Icefield Parkway“ entlang. Eine Straße durch die National Parks, die nur dafür da ist, dass man sich die schöne Landschaft ansehen kann und von einem schönen Ort an einen noch viel schöneren kommt. Erster Halt sind die „Athabasca Falls“. Wiedereinmal Wasserfälle, die relativ unspannend wären, gäbe es nicht auch noch einen dazu passenden Canyon mit türkisfarbenem Wasser und herrlich rund abgeschliffenen Felsen. In regelmäßigen Abständen muss ich mich selbst daran erinnern, meinen Mund zuzumachen, der vor Begeisterung ständig offen steht. Nach nur kurzem Aufenthalt geht’s auch schon weiter zum Athabasca Gletscher. Da fährt man mit lustigen ‘Bussen’ hoch, deren Räder nur unwesentlich kleiner sind, als ich. Eine Firma, die normalerweise Equipment für die Ölindustrie baut, hat sich irgendwann auch dem Gletschertourismus angenommen. Die Gefährte können Hügel mit über 30% Steigung hochfahren und das tun wir auch. Oben angekommen wagen wir uns aus dem Bus, obwohl es so windig und nass ist, dass man leider nicht allzuviel sehen kann, dafür wird man aber innerhalb kurzer Zeit ordentlich nass. Memo an mich: Regenhosen funktionieren nicht, wenn sie im Hostel im Backpack liegen. Vielleicht hätte ich doch die Tour am Vortag nehmen sollen… aber da steckt man leider nicht drin. Ich versuche also aus den Fotos so viel herauszuholen wie möglich, was beim ständigen Nasswerden und Beschlagen der Kamera nicht allzu einfach ist und trinke einen Schluck Gletscherwasser. Davon soll man angeblich 10 Jahre jünger aussehen. Als ich mich später mit der Busfahrerin unterhalte und sie frage, ob ihr das denn nicht auffalle, sagt sie „Oh yes… you look like… 10“. Offensichtlich hätte ich das Wasser also gar nicht gebraucht. Trotz des fiesen Wetters und der großen Mengen an Gletscherwasser, die ich vermutlich noch durch Osmose aufnehme, ist es die Tour aber in jedem Fall wert. Auf dem Weg sehe ich endlich Elche (wenn auch nicht in der Größe, in der wir sie in Schweden nicht gesehen haben) und überhaupt ist es einfach ein schöner, lustig-nasser Tag. Gekrönt wird dieser von meinem ersten Thanksgiving. Hier im Hostel gibt es zu diesem Anlass ein großes Abendessen, zu dem etwas beisteuern kann, oder eine kleine Spende macht. Ich entscheide mich dazu Brot zu backen (an dieser Stelle meinen Dank an Callin für die Backmischung). Schließlich kann es nichts wirklich deutscheres geben. Kurze Zeit überlege ich noch, ob ich mir den Truthahn schönrede, bei so vielen internationalen Beilagen muss es dann aber doch nicht sein. Da angeblich die Statistiken für häusliche Gewalt in Kanada an Thanksgiving extrem in die Höhe gehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Feiertag allgemein mag, aber hier im Hostel mit so vielen Leuten aus diversen Ländern (naja, man spricht entweder Englisch, Französisch oder Deutsch) ist es wirklich eine Feier wert. Hier hätten wir uns aber auch einfach einen Feiertag ausdenken können. Jasper und das Hostel gefallen mir, also beschließe ich, meinen Aufenthalt um zwei weitere Nächte zu verlängern. Bisher war mein Reisestil ja doch eher japanisch und das sollte sich irgendwann einmal ändern. Und so geht es dann am nächsten Tag auf meine erste ernstzunehmende Wanderung. Nicht unbedingt in Sachen Entfernungen, aber in Sachen „Berge erklimmen“. Wandern klingt so nach alten Leuten mit dreiviertellangen Hosen und Stricksocken, vor allem im Zusammenhang mit „Bergen“, aber „hiking“ und „mountains“ sind ziemlich verlockend und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man hier von der Natur enttäuscht werden kann. Also erklimmen wir in einer Gruppe von 8 Leuten einen Berg mit atemberaubender Aussicht auf den Maligne Lake. Oben gibt’s ein keines Picknick im Schnee und wir können Dan, einen Neuseeländer, der aus Prinzip in Shorts wandern geht, weil er das in Neuseeland auch immer macht, davon überzeugen, dass er unbedingt ein Foto in Shorts, T-Shirt und Barfuß braucht. Inselmenschen… Auf dem Weg zurück folgen wir unseren eigenen Fußspuren, jeder nach mir kann aber auch einfach die Spuren meines Hinterns verfolgen… Doc Marten’s sind einfach keine Schnee-Schuhe. Zum Glück bin ich aber nicht die Einzige, der es so ergeht… Oh, ich glaube, ich bin doch mehr Outdoor-Mädchen,als ich dachte. Diese Rocky Mountains haben mich einfach mit ihrer Schönheit gefangen. Und so geht’s am nächsten Tag zum Mt Edith Cavell. Eine der letzten Gelegenheiten, denn Ende der Woche wird die Straße gesperrt. Es wird Winter. Leider müssen wir unsere Tour ca. 15 Minuten vor dem Gipfel abbrechen, da es über der Baumgrenze dann doch ordentlich weht und außerdem nicht unwesentlich anfängt zu schneien. Trotzdem eine grandiose Aussicht auf zwei Gletscher (keine Angst, auch an diesem Tag gibt es natürlich keinen blauen Himmel). Es ist so schön, sich langsam auf Augenhöhe mit diesen „Eisklumpen“ zu arbeiten, wenn sich die Landschaft Stück für Stück verändert… aber mit Schnee ist nicht zu spaßen und bevor er unsere Spuren verdeckt (wir waren die ersten dort oben seit dem letzten Schneefall), ist es dann wohl doch besser, einfach umzukehren. Wieder unten angekommen betreten wir dann doch noch die touristisch ausgeprägteren Pfade und werden auch hier für jeden Schritt belohnt: ein halb gefrorener See mit Eisbergen und schließlich eine Eishöhle… absolut atemberaubend. Nein, es gibt einfach keine Worte um diesen Anblick zu beschreiben. Vollkommen unmöglich. Keine Chance. Auch meine Fotos zeigen es nicht im Geringsten. Ihr müsst wohl selbst herkommen und euch die Canadian Rockies ansehen. Wann auch immer man auf den geschwungenen Straßen um die nächste Kurve kommt, sieht wieder etwas so unfassbar Schönes, dass irgendjemand im Auto ein x-beliebiges Geräusch der Freude machen wird. Nach 3 Tagen Wandern merke ich, dass es in meinem gesamten Körper Muskeln gibt, diese aber nicht unbedingt ausgeprägt sind. Also lieber mal einen Tag langsam machen. Heute Abend geht es ohnehin weiter nach Canmore. So ganz ohne Bewegung an der frischen Luft geht es aber doch nicht und so ziehe ich mit einer Kanadierin los, die auch nur eine kleine Runde laufen mag. Wir entscheiden uns für den Wanderweg (wieder so ein doofes Wort) zum „Old Fort“. Wirklich viel sieht man von dem Fort nicht, lediglich ein paar Steinreste, aber natürlich gibt es auch hier einen wahnsinnigen Ausblick. Diesmal auf Jasper. Wir stehen also an einem Abhang und freuen uns für ca. eine halbe Minute, als wir eine Bergziege oder was auch immer das für ein gehörntes Tier ist, entdecken. Während ich sie fotografiere, fällt mir auf, dass ich keine Ahnung habe, was diese Tiere so tun und wir treten spontan, aber trotzdem so ruhig wie möglich den Rückzug an. Die Bergziege, die eben noch faul und friedlich den Ausblick genossen hat entscheidet sich derweil, auf uns zuzukommen. Es braucht keine Raketenwissenschaften, um festzustellen, dass diese Viecher den unschätzbaren Vorteil zweier riesiger Hörner haben. Außerdem sind sie größer als unsere Ziegen. Viel größer. Würde ich mich draufsetzen, würde sie es nicht nur überleben, sondern auch meine Beine kämen gewiss nicht mehr auf den Boden. Und das liegt nicht daran, dass sie kurz sind… Die Kanadierin und ich sind uns also schnell einig, dass wir keinen Kampf mit der Ziege aufnehmen wollen, sie bewaffnet sich trotzdem mit einem Stein (das macht bei mir keinen Sinn, weil jede Ziege lachen würde, könnte sie mich beim Werfen beobachten) und wir laufen weiter unseren Weg zurück. Als wir sie nicht mehr sehen, drehen wir um, in der Hoffnung, den Rundweg fortsetzen zu können. Die Ziege ist nicht mehr wo sie war. Gut. Wir laufen erleichtert weiter, da schneidet uns das Mistvieh den Weg ab. Ja, Erinnerungen verschwimmen schnell, aber ich glaube, sie hat uns angegrinst. Und ich sage euch… auf einem Berg in den Rockies von einer riesigen Bergziege verfolgt zu werden ist schon irgendwie ein wenig angsteinflößend. Und im Gegensatz zu Hangpferden haben Bergziegen vier gleichlange Beine und können in beiden Richtungen um den Berg laufen… man kann sie also nicht einmal austricksen, indem man die richtige Richtung wählt. Wir gehen also wieder ein Stück zurück und warten eine Weile, bis die Ziege irgendwann etwas Spannenderes findet und davon läuft. Endlich können wir unseren Weg fortsetzen, natürlich immer mit dem Blick nach hinten, ob wir nicht vielleicht doch verfolgt werden. In halbwegs sicherer Entfernung treffen wir dann einen Mann mit Kamera, der auch prompt fragt, ob es dort oben Bergziegen gibt. Ich sage „Ja“ und warne ihn, dass wir gerade von einer verfolgt wurden. Er meinte, er wäre in jedem Fall schneller als die Tiere. Das wage ich ja zu bezweifeln… Vielleicht sollte ich morgen mal eine Zeitung kaufen…

Hawai’i (Big Island) ist die vielseitigste aller Inseln. Es gibt diverse Wetterzonen und überhaupt, bekommt man hier angeblich alles. Also will ich auch alles sehen, oder zumindest viel. Laut diverser Erzählungen scheint außerdem auf der anderen Seite der Insel alles besser zu sein. Da bin ich zwar skeptisch aber durchaus neugierig, daher muss ein Tagesausflug natürlich sein und so setze ich mich in den Bus nach Kona. Eine Busfahrt quer über die Insel ist auch wirklich eine gute Idee. Die Unterschiede sind faszinierend. Eben noch im Regenwald, sind wir plötzlich in der Wüste, dann in einer Gegend, die auch in Norddeutschland sein könnte und plötzlich wieder in einem Trümmerfeld, das hier offensichtlich einmal einer der Vulkane hinterlassen hat. Und das alles auf einer nicht wirklich langen Strecke. Drei Stunden Busfahrt vergehen wie im Fluge und das nicht nur, weil ich inzwischen daran gewöhnt bin, sondern auch wegen der faszinierenden Landschaft, die wiedereinmal an meinem Fenster vorbeizieht. Kona an sich ist hingegen relativ unspannend. Es gibt viele Touristen, daher auch mehr Touristen-Geschäfte, als in Hilo. Sonst aber nichts wirklich Spannendes, (angeblich kann man hier gut feiern, aber ich bin ja nur tagsüber da) also schlendere ich einfach ein Wenig durch die Gegend und versuche ca. eine Stunde lang herauszufinden, wo der Bus hält, der mich wieder zurück nach Hilo bringt. Das ist leider nicht so einfach, wie es scheint, denn Bushaltestellen gibt es nicht und da nur ein einziger Bus zurück fährt, möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass dieser einfach anhält, wenn ich nach ihm winke… die Aussagen aller Befragten sind ziemlich widersprüchlich und erst, als ich ca. drei Hinweise auf den gleichen Haltepunkt bekomme, versuche ich mein Glück und… habe es auch. Wie schnell man hier zu einem kleinen Nervenkitzel kommt… Weil ich den Vulkan und den dazu gehörigen National-Park gerne von alles Seiten sehen will und außerdem gerade in einer Phase stecke, in der ich nicht alle zwei Tage an einem anderen Ort sein möchte, habe ich mir für die „Big Island“ etwas mehr Zeit genommen. Im Prinzip keine schlechte Idee, allerdings hab ich da die Rechnung ohne die öffentlichen Verkehrsmittel gemacht. Wie in allen Reiseführern etc. beschrieben, existieren diese zwar, aber zu unmöglichen Zeiten. Mein Ausflug nach Kona (und zurück) ging ja nochmal gut, aber zu diesem Vulkan hinzukommen scheint nahezu unmöglich. Die Entfernung ist ca. 30 Meilen. Natürlich viel bergauf. Also nichts für mich und ein Fahrrad. Selbst, wenn ich mir meine Kondition noch so schön rede… ich habe den Schweizer nach der Rückfahrt gesehen und da ging es logischerweise hauptsächlich bergab. Diese Möglichkeit scheidet aus. Per Anhalter fahre ich gewisslich nicht… da bleiben mir wohl nur Touren. Neben gescheitem deutschen Brot vermisse ich tatsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel meiner Heimat. Mein Hostel bietet ja prinzipiell Touren an, aber das ist wohl nur theoretisch so. Da einfach nicht genug Backpacker im Hostel sind, leben wir wenigen in ständiger Hoffnung, die dann wieder enttäuscht wird. Die erste Absage kommt natürlich zu spät, um eine alternative Tour zu buchen, also beschließe ich, stattdessen einfach Schnorcheln zu gehen. Das soll ja auch schön sein. So leihe ich mir alles, was ich brauche und laufe ca. 1,5 Stunden bis zu dem ersten mir empfohlenen Strand, an dem man die Unterwasserwelt beobachten kann. Die Stände in Big Island haben gar nichts mit dem zu tun, was man von diversen Postkarten etc. erwartet. Hier gibt es, zumindest im Osten, ausschließlich Lava-Fels Strände, die Suche nach einem Fleckchen, an dem ich irgendwie sitzen kann, gestaltet sich daher recht schwer, aber nicht unmöglich. Nach kurzem Sonnengenuss schnalle mir dann auch die lustigen Flossen an die Füße und die muntere Brille vors Gesicht und schwimme los. Laufen ist ohnehin unmöglich (ja… rückwärts geht, muss man aber auch erst mal drauf kommen in dem Moment). Schwimmen mit Flossen ist definitiv lustig und auch das Atmen durch den Schnorchel sollte man von der humorvollen Seite betrachten. Das ich allerdings alles sehen kann, über das ich normalerweise gewissenlos laufe bzw. hinwegschwimme, finde ich gewöhnungsbedürftig. Die Unterwasserwelt ist komisch, kantig und gruselig. Vielleicht liegt es daran, dass das Wasser extrem flach ist und ich quasi direkt über allem hänge, aber neon leuchtende Fadenviecher und lange, dünne Fische, die mit ihrem Kopf im Grund stecken und vor sich hin wackeln, finde ich äußerst unangenehmen. Schnellst möglich bewege ich mich wieder Richtung Ufer, Schnorcheln ist wohl einfach nichts für mich…Auf dem Weg ans rettende Land, entdecke ich dann aber zwei muntere Streifenfische, die um einen Stein herum und in Ritzen hinein und wieder rausschwimmen. Äußerst beruhigend. Das muss ich schon sagen. Das gefällt mir, hier bleibe ich, vielleicht ist Schnorcheln ja doch nicht so schlimm. Nach erstem Unmut und darauf folgender Freunde ist nun meine Neugier geweckt und ich schwimme wieder weiter hinaus. Hier soll es auch Wasserschildkröten geben… Aber will ich denen wirklich begegnen? Die Panik holt mich zwar nicht nochmal ein, schön ist es aber nicht, so nahe am Meeresgrund mit all den komischen-gruseligen Formen vorbeizuschwimmen. Nein, das reicht, ich habe es versucht, ich will wieder an Land und zwar schnell. Als ich es mir gerade auf einem Stein „gemütlich“ gemacht habe, kommt eine Frau, die von ihrem Mann überredet wurde Schnorcheln zu gehen und der es genauso geht, wie mir. Wir sind uns einig, dass es wirklich nicht schön ist, alles zu sehen, dass es aber bestimmt auch schönere Orte gibt, vielleicht haben wir einfach nur Pech. Wir unterhalten uns eine Weile, bis sie und ihr Mann los wollen (Vulkane erkunden) und ich mich frage, ob die vulkanstein-geprägten Dellen jemals wieder aus meinem Hintern verschwinden. So entsteht also Cellulite… Schnorcheln kann ich also auch von meiner To-Do-Liste streichen. Naja, noch nicht wirklich, diese Aktivität braucht wirklich eine zweite Chance, alles andere wäre unfair. Aber zunächst steht ja noch der Vulkan bei Tageslicht auf dem Programm. Es gelingt mir, den Waliser und den Chinesen (und damit ca. 80 % der Hostelgäste) zu überzeugen, am nächsten Tag früh aufzustehen, um den Bus um 5.00 Uhr zu nehmen, der uns zum National Park bringen soll. Es gelingt uns allen, rechtzeitig aufzustehen und zu frühstücken, was uns allerdings nicht gelingt, ist früh genug das Hostel zu verlassen. Als wir kurz vor der Bushaltestelle stehen, sehen wir den Bus vorbeifahren. Wir rennen noch ein Stück, aber es ist zu spät. Die einzige Möglichkeit, einige Stunden im National Park zu verbringen ist somit an uns vorbeigezogen. Ich kann es nicht fassen.Wie kann man denn so bescheuert sein und um kurz nach 4.00 Uhr aufstehen, um sich dann im Hostel zu verquatschen und den einzigen Bus zu verpassen? Gleichzeitig freue ich mich ein Wenig, zum ersten Mal (soweit ich mich erinnere in meinem Leben), ein Verkehrsmittel verpasst zu haben (abgesehen von Anschlüssen, aber die zählen ja nicht, weil ich ja nix für Verspätungen kann). Offensichtlich klappt das mit der Entspannung und dem Ablegen des Kontrollzwangs. Das sollte ich mir zwar nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber es ist immerhin eine neue Erfahrung. Allerdings bringt mich diese nicht dem Vulkan näher, was mich wiedereinmal in diese komische Zwischenstimmung aus Frust und über mich selbst lachen bringt. Nach einer Runde Schlaf und einem zweiten Früstück, versuchen wir den Hostel-Manager davon zu überzeugen, uns zum Park zu fahren. Der hat allerdings zu viel zu tun (warum auch immer, gestern saß er den ganzen Tag vorm TV). Taxis sind zu teuer, uns bleibt wohl nur, den Nachmittagsbus zu nehmen, der uns ca. 1 Stunde Zeit lässt, den Vulkan zu erkunden. Arrrgggggg. Langsam habe ich das Gefühl, dass Vulkane ähnlich verflucht sind, wie Gletscher. Keine Ahnung was dann doch noch das Blatt wendet, aber der Hostelmanager bietet uns irgendwann doch noch an, die Tagestour zu machen. Die Zeit reicht und so machen wir uns auf. Allerdings fängt es natürlich pünktlich mit der Abfahrt an zu regnen. Also das behaupten die anderen. Ich bleibe relativ standhaft in meiner Behauptung, dass es sich nicht um Regen, sondern um hohe Luftfeuchtigkeit handelt. Zuerst geht es in zwei kleine Ausstellungen (es gibt zwei Formen von Lava, die eine heißt Aa und sieht auch so aus), dann können wir den Krater nicht sehen, weil natürlich eine Wolke drin hängt. Ich bin definitiv verflucht. Die dampfenden Erdlöcher sind allerdings sichtbar, das ist schonmal was und dann geht es in eine „Lava Tube“. Sieht aus wie eine Höhle, ist aber keine (weil von Lava gemacht, nicht von Wasser). Hammer, wenn man sich vorstellt, welche Massen an geschmolzenem Stein da mal durchgeflossen sein müssen. Zwischenzeitlich konnte ich auch klären, dass diese munteren Erdplatten ein riesiges Recycling-System sind und eingeschmolzen werden. Meine Angst, die Erde bricht irgendwann zusammen, weil die Vulkane das ganze Erdinnere ausgespuckt haben, ist somit vollkommen unbegründet. Glück gehabt. In Sachen Vulkanen hab ich offensichtlich Lava geleckt, daher will ich unbedingt in den Krater. Da gibt es einen kleinen Hike, ca. zwei Stunden. Das Wetter ist fies, aber das ist mir egal. Zum Glück lassen sich auch die Jungs überreden (zu memmen, wenn das einzige Mädel überzeugt ist, scheint auch nicht so einfach) und so laufen wir in den Krater und stehen plötzlich in einer Art Mondlandschaft. Also zumindest stelle ich es mir den Mond so vor. Irgendwie hat es aber auch etwas von aufgeplatztem Straßenbelag, aus dem sich zahlreiche Pflanzen, herauskämpfen und mich dazu bringen die Melodie von Löwenzahn vor mich hinzusingen. In diesem Moment hätte ich tatsächlich gerne mal Deutsche um mich gehabt. So ein Vulkankrater hat etwas unglaublich Ursprüngliches. Extrem unberührt und verlassen. Es fühlt sich so an, als wäre man noch weiter von jeglicher Zivilisation entfernt, als man es ohnehin schon ist. Und was für ein Steins-Chaos hier überall rumliegt. Es ist wirklich faszinierend und wenn ihr jemals die Gelegenheit habt: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Warum auch immer sonst keiner Regenjacke und gescheite Schuhe für den Hawaii-Urlaub eingepackt hat. Wiedereinmal schaffe ich es also doch, alles zu sehen, was ich möchte. Meine Mission „Big Island“ ist erfüllt, jetzt muss ich nur nach das Paradies auf O’ahu finden.
Eine Stadt, an die ich keinerlei Erwartungen stelle, denn egal wohin ich auch höre, so sonderlich toll findet sie keiner. Für mich ist sie ein guter Ausgangspunkt auf dem Weg nach Alaska und daher der Ort meiner Wahl für organisatorische Belange aller Art. Bereits bei meiner ersten Erkundungstour stelle ich fest, dass ich die Stadt mag und erwische mich bei dem Gedanken „hier scheint wenigstens nicht die Sonne“. Da fängt es natürlich auch gleich an zu regnen. Schnell lerne ich, dass man Touristen daran erkennt, dass sie Regenschirme mit sich führen. Einheimische tragen GoreTex. Um neben Wäsche waschen, Schlafsack kaufen und Hostels buchen doch noch etwas von der Stadt mitzubekommen, schließe ich mich der „Dead Guys Tour“, die vom Hostel aus organisiert wird. Zuerst geht es zum Grab von Bruce und Brandon Lee. Und ich sage euch: diese Amerikaner fahren mit dem Auto tatsächlich überall hin. Sogar auf den Friedhof gibt es quasi einen „Drive in“ und so parkt unser kleiner Bus direkt neben den Gräbern. Im Anschluss geht es noch zum letzten Wohnort von Kurt Cobain, zu seiner Lieblingsbank, dann zu einem verlassenen Blaubeerfeld und schließlich zur Gedenkstätte von Jimi Handrix. Eine sehr lustige Tour. Irgendwie absurd. Die Space Needle ist laut diverser Aussagen nur von weitem schön, daher mache ich mich gar nicht erst auf den Weg dorthin. Dafür erkunde ich die Märkte – so viel frische Meeresfrüchte sieht man selten – und erfreue mich daran, wie wenig aufgeregt diese Stadt ist. Im Gegensatz zu den meisten Städten, die ich bisher in den USA gesehen habe, ist Seattle angenehm uneitel und unaufgeregt. Absolut zum wohlfühlen. Abgesehen davon hat „Grey’s Anatomy“ wirklich einen gewissen Wahrheitsgehalt: es gibt eine überdurchschnittlich hohe Quote an gutaussehenden Männern. Und habt ihr schon mal über den Zusammenhang zwischen dem ersten Starbucks und dem Film „Sleepless in Seattle“ nachgedacht?
Auf dem Weg von Jasper nach Canmore verbringe ich wieder einmal eine Nacht im Bus und frage mich, ob ich das nicht vielleicht irgendwann vermissen werde… Am Morgen werde ich neben einem Tschechen wach, dessen Beine viel zu lang zum Greyhound fahren sind, weshalb er den eher kurz geratenen Asiaten vor sich darum bittet, die Rückenlehne nicht herunterzuklappen. Kurze Beine sind wirklich von Vorteil auf diesen Busreisen… Als ich ziemlich verschlafen nach Links und Rechts schaue, begrüßt mich besagter Tscheche mit einem extrem freundlichen „Good Morning“. Habe ich im Schlaf gesprochen? Gesabbert? Oder mein Nickerchen auf seiner Schulter ausgetragen? Sollte mir irgendetwas davon peinlich sein? Fragen über Fragen, aber noch bevor ich mir darüber weitere Gedanken machen kann, kitzelt die Sonne meine Nase und ich schaue aus dem Fenster. Was ich sehe sind noch viel beeindruckendere Berge, als die, die mir bisher begegnet sind. Alles ist rauer und kantiger mit schärferen Ecken. Dazu wieder einmal strahlend blauer Himmel. Diese Rockies sind einfach der Hammer. Und zu allem Überfluss verwöhnen sie mich an meinem ersten Tag in Canmore nicht nur mit ein Wenig dekorativem Sonnenschein, sondern mit T-Shirt-Wetter! Und so laufe ich durch die Gegend, teste die innerörtlichen Hiking-Wege und erinnere mich an die Selbstauslöser-Funktion meiner Kamera. Zeit für ein paar alberne Selbstportraits! So schön, so warm, so sonnig! Ach ja… wieder so ein Tag, an dem ich eindeutig feststellen muss, das mein Leben gerade äußerst beschwerlich ist… diese Rocky Mountains… ich glaube, ich habe mich verliebt. Nein, meine Blicke kann nun wirklich kein Berg mehr bösartig erwidern, das wäre unfair. Trotzdem lerne ich bereits am nächsten Tag die raue Seite der Gebirgswelt kennen: Die Wetterumschwünge. Als ich wach werde klingt es nach Regen, aber als ich aus dem Fenster sehe ,ist alles weiß… Moment mal… Habe ich nicht gestern noch im T-Shirt auf der Wiese gelegen? Was macht denn das ganze weiße Zeug dann bitte überall? Es ist Mitte Oktober und ich bin in den Bergen… wer hat hier wohl mehr Daseinsberechtigung: der Schnee, oder ich, die eigentlich dem Sommer hinterher reisen wollte? Also gebe ich mich geschlagen und freue mich darüber, dass dieser Umschwung stattfand, als ich in meinem mollig warmen Bettchen lag, das – abgesehen von dem Kissen, dass sich anfühlt, als schlafe man auf einer Plastiktüte – ziemlich bequem ist und nicht, beim Wandern oder was auch immer. Und so ziehe ich los und fotografiere einige Orte einfach erneut. Diesmal mit Schnee. What a difference a day makes… Ach ja: auch hier bin ich natürlich zwischen allen erdenklichen Saisons und so ist mein Hostel fast leer. Die wenigen, die dort sind, sind auf der Suche nach Jobs oder nehmen an Workshops teil. Keine Chance, jemanden zu finden, der mit mir wandern geht… und alleine wandern ist langweilig und keine gute Idee von wegen Bären und so… Aber dafür finde ich etwas Spannendes, das ich gerne machen möchte: Caving. Im Prinzip eine Höhlen-Tour, aber nicht so, wie ich es bisher kenne, mit Treppen, Wegen und Geländern, sondern in einer naturbelassenen Höhle. Kann ich das? Ich lasse das Schicksal entscheiden und als noch ein Platz für mich frei ist, buche ich. Dann überkommt mich aber doch ein Wenig die Angst. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Caving anstrengend ist und man über eine „good physical fitness“ verfügen sollte. Aber was bitte schön ist das? Und viel wichtiger: habe ich das? Immerhin klang die Beschreibung meiner Muli-Tour im Grand Canyon ähnlich und das war nicht wirklich schlimm… allerdings saß ich schon mal auf einem Pferd und hatte daher eine gewisse Vorstellung… Am nächsten Morgen mache ich mich also zugegebenermaßen extrem nervös auf den Weg zum Treffpunkt. Irgendwann erinnere ich mich auch, dass ich immer mal wieder davon träume, irgendwo stecken zu bleiben… mir scheint, ich bin der perfekte Kanditat, für so ein Höhlen-Abenteuer…. Unser Guide ist auch entsprechend durchtrainiert, ziemlich groß, passt aber trotzdem in Lücken von 7 Inches. Alles eine Frage der mentalen Stärke und der Körperbeherrschung… während ich die „letzte zivilisierte Toilette“ aufsuche schüttle ich einmal mehr den Kopf über mich selbst…diese Anna… überrascht sich immer wieder selbst… Wie schon bei der Muli-Tour muss ich unterschreiben, dass ich niemanden verklage, sollte ich bei der Tour verletzt werden oder sterben… Warum genau bin ich nochmal hier? Dann erscheint endlich die erste von insgesamt sechs Mitcavern und sie ist einfach eine normale Frau. Keine durchtrainierte Extremsportlerin, sondern einfach normal. Das gibt mir Hoffnung. Und als der Rest der Gruppe (alles in allem sind sie eine Familie) erscheint, verlassen mich sämtliche Bedenken: 2 Herren irgendwo in den 50ern, ein Mädel Anfang 20, ein Teenager und ein weiterer Anfang 20 jähriger, der später erzählt, er hätte die Tour schon einmal gemacht, als er noch 100 Pfund weniger wog. Jetzt bin ich endgültig beruhigt. Und dann geht es los. Nach einer kurzen Autofahrt bekommen wir unsere Ausrüstung und dann geht’s zu Fuß eine halbe Stunde bergauf zur Höhle. In der Tat befinde ich mich nicht am hinteren Ende der Fitness-Kette, steckenbleiben werde ich wohl auch nicht als Erste… es verspricht ein schöner Tag zu werden. Nach kurzer Einführung rutschen wir an Seilen oder einfach nur so Felsen herunter, klettern über Steine, seilen uns ca. 18 Meter ab, kriechen durch Löcher und sehen wunderschöne Tropfsteine. Wer mag kann durch den sogenannten „Laundry Chute“ einen gewundenen Gang klettern, der so heißt, weil er ungefähr die Größe und Form einer Wäscheklappe hat… da ich bisher noch nirgends steckengeblieben bin und zu denen gehöre, die es laut unsere Guides körperlich schaffen, will ich es versuchen und es geht erstaunlich gut. Wobei es wirklich seltsam ist, mit den Füßen zu erst in einem Gang, in dem man sich kaum umdrehen kann bergab zu rutschen, bis man an der nächsten Weggabelung ist… vor allem, weil es in so einer Höhle ziemlich dunkel ist… aber es macht zugegebenermaßen extrem viel Spaß! Nach diesen Strapazen geht es noch ein bisschen hoch und ein wenig runter und wir kommen in die „Grand Gallery“, dekoriert mit Tropfsteinen in allen erdenklichen Formen. Danach geht es weiter über Steine unter Felsen, bergauf, bergab zur „Grotte“. Wieder wunderschön behangene Wände und ein kleiner Teich… irgendwie faszinierend, diese Unterwelt… was Wasser so alles tun kann… Danach geht es dann fast nur noch bergauf, bis wir wieder am Eingang angekommen sind. Ca. 5 Stunden waren wir in der Höhle und haben dabei nur einen winzigen Teil gesehen. Insgesamt sind ca. 4,5 km Höhle erforscht. Unser Guide schafft es in ca. 50 min. durch einen Großteil der gesamten Höhle. Schwierigkeiten hat er bei einem Gang, der „Sucks“ heißt. Warum? „Because it sucks if you have to go through“. Und es gibt unter anderem einen „Raum“ der sich „A nun’s nightmare“ nennt. Hier gibt es Stalagmiten in allen Größen und Formen… Nach so langer Zeit ist es schön, das Tageslicht wieder zu sehen und mir ist klar, dass ich am nächsten Tag meinen ganzen Körper werde spüren können. Jede einzelne Faser. Vermutlich noch andere Gegenden, als nach dem Wandern. Außerdem habe ich diverse blaue Flecken, den schönsten am Schienbein, denn der hat nicht nur die Größe eines Hühnereis, sondern auch dessen Dreidimensionalität. Dreckig, müde und hungrig laufen wir den Berg wieder herunter und alles, was mir jetzt noch zum vollkommenen Glück fehlt, ist eine heiße Schokolade.
Eigentlich wollte ich Banff ja vermeiden. Wenn einem sämtliche Reiseführer und Bekanntschaften schon darauf hinweisen, das es ein reiner Touristen-Ort ist (genaugenommen wurde Banff sogar als Resort gebaut), mache ich ja normalerweise einen großen Bogen. Da wir uns aber (wie bereits mehrfach erwähnt) außerhalb der Saison befinden, vermute ich hier doch noch den einen oder anderen Backpacker und mache Banff daher trotzdem zu meinem nächsten Ziel. Die Rocky Mountains möchte ich schließlich so schnell noch nicht verlassen. Auf dem Weg zum Hostel findet mich auch gleich eine Australierin (Claire – Sommercamp mit anschließender Reise) und irgendwie kommen wir auch zu unserer Unterkunft, natürlich nicht ohne einen kleinen Umweg, denn eine Wegbeschreibung funktioniert einfach nur halbsogut, wenn es kaum Straßensschilder gibt… und der Nachteil an Gebirgen ist einfach, dass es ständig bergauf geht, so ist der Weg mit Gepäck nicht gerade unbeschwerlich. Dafür zeigt er mir einmal mehr, wie viel schöner es ist, mit einem Rucksack unterwegs zu sein, als mit einem Rollkoffer… mit ein bisschen Jammern schaffen wir aber auch dieses kleine Abenteuer, stellen unser Gepäck ab und begeben uns recht bald wieder bergab in Richtung Stadtmitte. In Banff gibt es wirklich alles, was das Touristen-Herz begehrt. Eine Souvenir-Laden-Dichte, die ich selten in dieser Form gesehen habe, Kleidung, Kaffee, Essen und natürlich Sportausrüstung im Übermaß. Trotzdem ist es bei weitem nicht so schlimm, wie von mir befürchtet. Das liegt mit aller Wahrscheinlichkeit aber vor allem an der Zwischensaison, denn die Hiker sind weg und die Skifahrer noch nicht da. Dafür gibt es extrem viele Deutsche auf der Suche nach Jobs. „Work and Travel“ in Kanada scheint in diesem Jahr ganz oben auf der Liste der „Was machst du denn nach dem Abi“-Antworten gestanden zu haben. Wer nicht deutsch ist, kommt aus Australien. Der Rest der Welt scheint dieses Fleckchen Erde noch nicht entdeckt zu haben. Das tut mir Leid für alle. Mein derzeitiger Aktivitätsdrang ist nicht nur befremdlich, sondern auch anstrengend und so nutze ich diesen Fakt und nerve Claire so lange, bis sie zustimmt, am nächsten Tag mit mir wandern zu gehen. Am nächsten Tag ist sie dann allerdings krank… Also mische ich mich durch dezentes Dazustellen in das Gespräch eines weiteren Australiers (Aaron, Urlaub) mit der Hostelinformation ein, der herausfinden möchte, was er denn am besten heute tun soll. Man muss nur aufmerksam genug herumstehen und schon wird man gefragt, was man selbst tut und ob man nicht einfach mitkommen möchte. Ja, genau darauf war ich aus. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die Entscheidung fällt schließlich auf die „Radium Hot Springs“ und da kann auch Claire mitkommen. Perfekt. Und vielleicht auch gar keine so schlechte Idee, wenn man bedenkt, dass ich meine Arme dank meines kleinen Höhlenabenteuers immer noch nicht ganz heben kann und auch meine Beine durchaus noch einen kleinen Muskelkater mitsichbringen. Aber ob Bikini eine gute Idee ist… meine Arme und Beine sind gerade alles andere als einfarbig… notfalls kann ich mir ja eine lustige Geschichte ausdenken, warum ich am ganzen Körper mit blauen Flecken überseht bin. Passt schon. Die Hot Springs sind im Prinzip ein kuschelig warmes Schwimmbad und ein Wirlpool, dessen 39 bzw. 40 Grad warmes Wasser direkt aus einer heißen Quelle kommt, also mal eben irgendwo im Erdinneren umweltfreundlich aufgeheizt wird. Wunderbar entspannend und so legt sich mein Aktivitätsdrang auch mit der Sekunde, in der ich das Wasser betrete. Somit ist es egal, dass das kühlere Schwimmbecken geschlossen ist. Schwimmen möchte ich ohnehin nicht mehr. Um nochmal darauf zurück zu kommen, dass sich die Menschen vom anderen Ende der Welt zu jedem Mist überreden lassen: Ich musst nur einmal sagen „guckt mal, man kann sich hier sogar historische Badeanzüge leihen“ und schon trägt der Australier einen Badeanzug aus den zwanziger Jahren. Schick mit einer Art Röckchen dran. Nicht nur zu unserer Belustigung, sondern auch zum Spaß der anderen Badegäste, die diese Mode zu einem Großteil vermutlich noch aus ihrer Kindheit kennt. Am nächsten Tag kommt Claire dann nicht mehr drumherum und wir fahren mit dem Bus zum Sulphur Mountain (ja… auch das erklärt die ganzen Heilbäder in dieser Region). Von dort aus geht es knapp 6 Kilometer bergauf. Und wenn ich bergauf sage, meine ich auch bergauf. In den ersten 500 Metern wird man noch beruhigt, in dem es zwischendurch gerade Strecken gibt und wenn man gerade Spaß am Laufen hat, hört es auf. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass dieser Aufstieg zu jeder Zeit ein Vergnügen ist, aber der Ausblick ist wiedereinmal atemberaubend, die Tortur ist vergessen und man wird für jeden Schritt und jeden Tropfen Schweiß belohnt. Wie klein Banff auf einmal wirkt… Und wie klein erst der Hügel ist, den wir am Tag unserer Ankunft hochgekrochen sind… Wie sich die Welt doch mit der Perspektive verändert, die man selbst einnimmt. Faszinierend. Außer uns sind auf dem Berg ca. 4 Busladungen Asiaten, die sich lustig von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt wuseln, Fotos machen, sich von uns fotografieren lassen und auf ein Foto soll ich gleich mit drauf. Juhu ich bin eine Touristen-Attraktion. Oder so. Wenigstens weiß man, dass die schnell wieder weg sind und man selbst ein Foto machen kann. Bergab geht es dann mit der Gondel. Unsere Knie werden es uns irgendwann danken und außerdem kostet es nichts. Ganz schön steil. Und wenn man sich so langsam wieder bergab bewegt, weiß man erst, wie weit oben man eigentlich war. Da sind wir wirklich hoch gelaufen? Ich muss zugeben, Banff ist wirklich nicht so schlimm und so überlege ich ein Weilchen, ob ich den nächsten Touristen-Hot-Spot „Lake Louise“ als Tagestour machen möchte oder mit Übernachtung. Es ist nicht weit, trotzdem liegt es ohnehin auf dem Weg nach Vancouver… also doch Nachmittags hin und am nächsten Abend weiter. Das passt, so lange ist mein Greyhound-Ticket noch gültig. Ich komme in Lake Louise an und die Sonne strahlt. Was auch sonst. Leider ist die Vorhersage für den nächsten Tag nicht so gut, ich könnte es aber noch vor Einbruch der Dunkelheit schaffen, zum See zu laufen. Je mehr Sonne, desto schöner die Farben. Das ist in jedem Fall ein Versuch wert. Die Strecke dauert ca. eine Stunde und angeblich ist es auch ein guter Weg, um sie alleine zu gehen. Also mache ich mich auf. Nach nicht allzulanger Zeit sehe ich ein Tier, das entweder ein Wolf ist, oder eine Mischung aus Wolf und Fuchs. Schönen Dank, hier gehe ich mal lieber nicht alleine weiter. Da riskiere ich doch lieber schlechtes Wetter am morgigen Tag, als die Gefahr eines kleinen Kampfes mit einem Tier dessen Namen ich nicht einmal kenne. Und was, wenn es seine großen Brüder ruft? Neee… da bin ich raus. Doofe Natur. Spaßverderber. Etwas frustriert gehe ich zurück zum Hostel. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Grrrrrrr…. Die Verteilung in meinem Zimmer ist – ganz nach den allgemeinen Touristenraten – 3 Deutsche zu 1 Australierin. Und die eine Deutsche (Madeleine – reist nach dem Studium) schafft es auch tatsächlich, mich davon zu überzeugen, eine Fahrradtour zum Moraine Lake zu machen. Fragt mich bitte nicht, warum ich einwillige, denn das Wetter ist unschön und grau, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % werden wir im Laufe des Tages nass, der Fahrradverleih in einem solchen Touri-Ort ist unverschämt teuer und außerdem liegt der See in ca. 14 km Entfernung, plus einen buckeligen Hikingweg am Anfang, dessen Entfernung ich nicht genau weiß, der aber den schwierigsten Teil der Strecke und auch einige Kilometer einnimmt. Das wäre nicht weiter schlimm, würden wir uns nicht nachwievor in einem Gebirge befinden… ihr wisst schon, da gibt es Berge und so. Ziemlich viele sogar. Und so ist der Hinweg ein Kampf. Zugegebenermaßen ist es aber eine nicht unwesentliche Motivation, als wir irgendwann das Päärchen überholen, das den buckeligen Hikingweg nicht mitgenommen hat und mit dem Auto bis zum Beginn der Straße gefahren ist, von dem es „nur“ noch 14 Kilometer sind. Die beiden fanden es vermutlich nicht so gut und wir überlegen uns, wie sehr die Frau, die von Anfang an nicht so glücklich auf dem Fahrrad war, ihren Mann zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon verflucht. Die ganze Strecke mit dem Auto zurückzulegen ist jedoch nicht möglich, denn die Straße ist wegen des nahenden Winters bereits gesperrt. Mit dem Fahrrad darf man aber noch durch. Warum auch immer. So hilft es also nichts. Wer den See sehen möchte, muss sich quälen. Und das tun wir. Das letzte Stück geht es bergab auf den See zu und als wir anhalten sehen wir dieses strahlende Blau, für das die Seen hier bekannt sind. Zum größten Teil ist das Blau zwar bereits zu Eis erstarrt, aber trotzdem so wunderwunderschön, dass sofort sämtlicher Schweiß trocknet und wir es irgendwie noch schaffen, die Stufen zum Aussichtspunkt heraufzukriechen. Genau in dem Moment kommt auch die Sonne ein klein Wenig durch den wolkenverhangenen Himmel. Ganz offensichtlich weiß da jemand unsere Anstrengungen zu schätzen… Danke, liebe Sonne! Der See hat einen gewissen Zauber, bestimmt auch, weil in der gesamten Zeit, in der wir dort sind nur noch vier weitere Personen dorthin kommen (inkl. dem bereits erwähnten Päärchen). Viel kann von der Besonderheit aber nicht mehr übrigbleiben, wenn all die Parkplätze und Bushaltestellen besetzt sind… mich gruselt’s bei der Vorstellung. Aber es ist ja ohnehin bald Halloween. Aber auch so währt der Zauber nicht lange, denn kurz darauf schiebt sich eine Wolkenfront über die Berge, die uns nicht nur eine Eiseskälte beschert (danke Madeleine für die Handschuhe!!!!!), sondern auch ziemlich nach den 30% aussieht, auf die wir so gar keine Lust haben. Also schnell über den einen Hügel und dann rollen lassen. Und das auf einer gesperrten Straße mit wunderbarem Bodenbelag. Ja so macht Fahrradfahren Spaß! Da nehmen wir doch auch noch den kleinen Umweg in Kauf, und fahren (naja, schieben) zum Lake Louise. Schließlich kann ich nicht heute Abend wieder aus Lake Louise verschwinden, ohne den Lake Louise gesehen zu haben. Weit auffälliger als der See ist allerdings der riesige Hotelkomplex und hier gibt es auch um diese Jahreszeit mehr Touristen. Wir müssen zwar nicht gerade Schlangestehen, um den See zu fotografieren, viel fehlt aber nicht. Was fehlt, ist allerdings die Sonne. Diese veranstaltet mit den Farben des Sees nämlich für gewöhnlich ein ganz ausgesprochen schönes Spektakel, das ich leider nicht erlebe. Hätte mich auch gewundert, im Hintergrund ist schließlich ein Gletscher… Erst bei meiner Abreise fällt mir auf, dass der Ort „Lake Louise“ eigentlich hauptsächlich aus Parkplätzen besteht. Nicht nur an den Seen direkt, sondern auch im „Zentrum“. Der Platz ist so groß, dass kein Nordamerikaner die Strecke als „walkable distance“ bezeichnen würde. Und darüber hinaus gibt nicht viel, außer zwei Cafés, zwei Restaurants, zwei Souvenir-Läden, einem Sportausrüster, einem „Supermarkt“, einer Tankstelle, der Touristeninformation und einem Laden, der gleichzeitig Post, Suvenir-Laden und Greyhound-Centre ist. Achja und einen Schnapsladen gibt es noch. Schon irgendwie seltsam. Mit ordentlicher Verspätung kommt irgendwann mein Bus und ich verlasse die Rocky Mountains wieder. Schon schade… aber schön war’s… Ach ja: nicht nur ich habe mich in die Rockies verliebt, meine Liebe wurde erwidert. Schaut mal genau hin.
Lange habe ich mir nichts sehnsüchtiger gewünscht, als Obst und jetzt liegen sie vor mir: zwei wunderschöne, tiefgelbe Bananen mit ein paar vereinzelten braunen Fleckchen. Und wie praktisch die sind. Der Öffner ist integriert und selbst ich kann sie beim Essen anfassen, ohne dabei eine Schweinerei zu veranstalten. Perfekt. Ich habe ja wirklich einen „süßen Zahn“, vermutlich sogar mehrere, aber in diesem Moment, nach all dem frittierten Zucker in Niagara Falls, gibt es wirklich nichts perfekteres, als diese geballte Ladung echten Geschmacks mit Vitaminen, Mineralstoffen und überhaupt allem, was das Schwein so braucht. Und diese Konsistenz… anfangs bissfest und schon im nächsten Moment schmilzt die Banane in meiner Schnauze zu einem wunderbar süßlichen, aber nicht zuckrigen Brei. Keine Arbeit mit dem Kauen und trotzdem wird alles perfekt für die Verdauung vorbereitet… Danke Natur, hier ist dir eine absolute Glanzleistung gelungen… es macht schon Sinn, dass die Ostdeutschen dafür 1989 auf die Straße gingen.
Eine intensive Studie der örtlicher Speisekarten zeigt, dass „Key Lime Pie“ ganz offensichtlich das Dessert ist, das ich hier probieren muss. Ok. Ein Blick in den „Lonely Planet“ hätte gereicht, aber das tut hier nichts zur Sache. Ich habe eine Mission. Und die ist süß und kuchig. Wie gut, dass ich nach nur wenigen Wochen des Ekels auch wieder Süßspeisen zu mir nehmen kann. Der große Nachteil von Desserts ist ja, dass man vorher unnötig Zeit damit verschwendet, etwas zu Essen, dass einem den Magen so sehr füllt, dass man das, was man eigentlich haben möchte, gar nicht mehr richtig genießen kann. Zwar sind Nachspeisen deshalb im Allgemeinen weich und suchen sich ihren Platz in den verbleibenden Ritzen, es besteht aber immer die Gefahr, dass der Genuss durch Magendrücken übertönt wird und das will doch wirklich keiner. Ich entscheide mich daher für den Kuchen als Hauptmahlzeit. Macht auch weniger Speck am Schinken und keiner Stellt einem die Frage, ob man den Kaffee dazu oder danach möchte. Der „Key Lime Pie“ wurde einer Legende nach Ende des 19. Jahrhunderts erfunden, weil ein Seemann nach einer Variante suchte, Eier und allerhand anderes gescheit zu transportieren und zu etwas Schmackhaftem zu verarbeiten, das auch gegen Skorbut hilft. Vielleicht stimmt die Geschichte auch gar nicht, aber die Vorstellung, dass der Pie auch noch gesund ist, gefällt mir. Es ist ja auch egal. Irgendjemand hatte irgendwann die geniale Idee, einen knusprigen Teig mit einer Limonencreme zu bedecken und dann zu allem Überfluss auch noch Eischnee darauf zu streichen. Bereits der erste Biss haut mich fast vom Stuhl. Noch nie in meinem gesamten Schweineleben habe ich so einen leckeren Kuchen gegessen. Zart schmelzend, leicht säuerlich-süß und knusprig. Der Key Lime Pie hat einfach alles, was man sich wünschen kann. Am liebsten würde ich mit der Schnauze voran direkt in die Creme tauchen und sollte ich darin ertrinken, sterbe ich in Frieden… und der Saumagen hätte eine ganz besonders gute Füllung. Aber ich bin ja unter Menschen… da lasse ich das besser, außerdem: je schneller ich esse, desto schneller ist mein Teller (ok, meine Plastikbox) leer und der Geschmack verflogen. Das muss ich unbedingt vermeiden. Ganz gegen meine Gewohnheiten genieße ich jeden einzelnen Happs. So können sich die einzelnen Komponenten des Kuchens in meiner Schnauze zu einer unbeschreiblich leckeren Masse vereinigen und ich freue mich bei jedem Bissen auf den nächsten, während ich gleichzeitig den Letzten fürchte… Wenn es das Wort „Genuss“ noch nicht gäbe, hätte ich es genau in diesem Moment erfunden… wie kann ein einziger Kuchen so gut sein???? Viel zu schnell habe ich das Stück leider doch verputzt und mein Magen ist voll. Wie gut, dass ich vorher keinen Platz verschwendet habe… Wenn doch nur alle Medizin so süß und lecker wäre… Ok, die Gefahr an Skorbut zu erkranken ist für mich ohnehin gering, aber Vitamin C ist bestimmt auch gut gegen Schweinegrippe.
Das „Must Eat“ in San Francisco ist „Clam Chowder“. Eine Creme-Suppe aus Muscheln (und vermutlich allerhand Resten diverser Meeresfrüchte), serviert in einem Sauerteig-Brot. Am Fischermen’s Wharf gibt es „Clam Chowder“ an jeder Ecke und dazwischen hat man noch mehr Möglichkeiten, ihn zu erstehen. Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie man herausfinden soll, welcher der Beste ist. Einige Touristen probieren an diversen Ständen, bevor sie sich entscheiden, ich weiß aber gar nicht, woran ich Qualität erkennen solle, also ich stelle mich einfach irgendwo an, wo vorher eine lange Schlange war und jetzt gerade nicht. Bewaffnet mit der riesigen Brotkugel, in der die reichhaltige Creme suppt, suche ich mir eine Bank, damit ich mein Mittagessen im Sitzen genießen kann und weiß jetzt schon, dass die größte Aufgabe darin besteht, mein Essen gegen die Seemöven zu verteidigen. Bis ich zwischen all den Chowder essenden Touristen einen Platz gefunden habe, vergeht eine Weile. Prima, verbrenne ich mir wenigstens nicht die Schnauze. Ich nehme ein Stück Brot und tunke es in die weiße Masse… das ist gut… oh ja, ich möchte mehr, greife zum Löffel und erfreue mich an der cremigen Konsistenz der Suppe. So lecker und warm und weich… Moment mal… sollten da nicht irgendwie Stückchen drin sein? So als Beweis, dass die Suppe aus Muscheln gemacht ist? Nach langem Suchen finde ich welche… offensichtlich eine Sparmaßnahme… egal… die Suppe schmeckt auch so… und die Schüssel erst… Diese Amerikaner haben ja wirklich keine Ahnung von Brot, aber dieses hier ist wirklich gut. Besonders da, wo die Suppe den Teig leicht aufgeweicht hat, so dass man ihn mit dem Löffel herauskratzen kann…. und das fluffige Zeug, das ich retten kann, bevor es aufweicht… und die Kruste, die ist auch gut. An diesem Brot gibt es wirklich nichts, das ich nicht mag. Viel zu schnell bin ich satt, aber ich gebe nicht auf. Soweit kommt es noch, dass ich das einzig anständige Brot, dass ich seit langem esse irgendeiner riesigen Seemöve zu Gute kommen lasse. Nix gibt’s. Die Suppe ist schnell leer und das Brot muss rein. Ich kämpfe und gewinne… lecker… und bestimmt nicht mein letzter „Clam Chowder“. P.S.: Auf der anderen Seite der USA behaupten sie, dass ihr „Clam Chowder“ der Echte wäre. Irgendeine Tomatenbrühe… ich weiß ja nicht…
Nachdem ich mittlerweile drei Monate unterwegs bin und selten mehr als zwei Nächte am gleichen Ort verbracht habe, fühlt es sich seltsam vertraut an, wieder nach Vancouver zu kommen. Hier war ich schon, hier weiß ich, wie ich wo hinkomme und ab wie vielen Fahrten sich eine Tageskarte für den ÖPNV lohnt. Es ist fast ein Wenig, wie nach Hause kommen. Seltsam schön. Trotz Regen. Die Tage in Vancouver sind irgendwie übrig, eine Zeit zwischen den Rocky Mountains und Hawaii, in denen ich nicht wirklich das Bedürfnis habe viel zu unternehmen oder Menschen kennezulernen. So laufe ich durch die Gegend, nehme an einer Führung durch den Stanley Park teil und nehme Abschied von Kanada. Schön war es hier. Definitiv. Traumhafte Natur, nette Menschen… einfach eine wunderschöne Zeit. Danke Kanada, wir sehen uns gewiss wieder!
Hawaii ist kaputt. Vermute ich jetzt mal, denn keiner hängt mir zur Begrüßung eine Blumenkette um den Hals (für die Wortspieler unter uns: „I didn’t get lei’d“), nirgends sind die sanften Klänge einer Ukulele zu hören und außerdem regnet es. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt… Wenigstens trägt mein Busfahrer ein Hemd mit Palmen drauf und auf einige Straßenschilder sind Blumenranken aufgemalt. Irgendjemand legt also doch noch Wert auf die guten alten Stereotypes… aber ob dies wirklich das Paradies ist? Mein Hostel liegt in Waikiki (ja… ich muss auch immer kichern, wenn ich das sage) und ich gehe nicht davon aus, dass ich die Ecke besonders mag. Touri-Hochburg eben, aber gerade hätte ich gerne zwei Tage Klischee-Hawaii und dann auf nach „Big Island“, Vulkane gucken. Jetzt aber will ich ersteinmal einen großen Cocktail. Mit Schirmchen. Das sollte ja wohl kein Problem sein, denk ich mir. Pustekuchen! Soviel zu meinem jugendlichen Leichtsinn… Das Einzige, was es hier wirklich überall gibt, sind Schmuck und Klamottenstände, Fastfoodläden und ABC-Shops, in denen es alles von Souveniers bis Lebensmittel gibt. Hallo Hawaii??? Was soll denn das??? Oder muss ich sagen „Aloha Hawaii“, damit du meinen Unmut verstehst? Einen wegen mangelnder Genießbarkeit nur halben Veggie-Burger später kehre ich ins Hostel zurück und versuche es erst einmal mit Schlaf. Dunkel ist es ohnehin schon seit sechs Uhr. Da hat mal wohl mehr von den lauen Sommerabenden… komisch. Mal sehen, wann es wieder hell wird. Vermutlich früh… ja, es ist früh, allerdings nicht ganz so früh, wie meine Mitbewohnerinnen wach werden. Da ist es nämlich noch dunkel, aber ich bin dann auch wach und frage mich, wie spät es denn sein könnte. Reisen verwirrt, schließlich machen Tag und Nacht überall etwas anderes. Mal beginnen sie früher, mal später und selbst, wenn man sich um lange Zeitverschiebungen drückt, ist es doch immer wieder spannend. Sobald sich die Sonne durchkämpft, höre ich neben Sturm und Regen vor meinem Fenster ein Rudel Vögel, das den Anfang der „Königin der Nacht“ trällert. Und wenn ich vom Anfang spreche, meine ich „Dadada da da da da“ und da bricht es ab und geht von vorne los. Sowas kenne ich eigentlich nur von nervigen Kindern im Zug, die lediglich die erste Strophe diverser Weihnachtslieder kennen… Ich bin irgendetwas zwischen genervt und amüsiert… vielleicht sollte ich meine Stimmung mal genauer analysieren. Das Gute am erneuten Wechsel in eine andere Zeitzone ist, dass ich wach und fit bin, obwohl es erst sieben Uhr ist und so beginne ich kurzerhand den Tag. Auf Hawaii merkt man ganz eindeutig, dass hier nicht nur vor einigen Jahren die Japaner auf die Amerikaner getroffen sind, sondern sich ganz allgemein die amerikanische „Kultur“ mit der asiatischen Kultur vermischt. Besonders deutlich wird das in den Souvenier-Läden. Warum auch immer ich diese an jedem Ort besuche… vermutlich quäle ich mich gerne selbst. Mittlerweile habe ich den gleichen Flaschenöffner und die gleichen Schnapsgläser schon von mindestens zehn verschiedenen Orten gesehen, aber jede Region und jede Stadt hat darüber hinaus doch wieder ihre Besonderheiten, die man mit einem kurzen Blick in diese Geschäfte sieht. Hier sind natürlich überall Blumen drauf. Spontan fällt mir nichts ein, was es hier nicht in geblümt gibt. Hier vermischt sich amerikanische Sportlichkeit mit Blumen und asiatischem Plastikgeruch der Billigprodukte… Dass man hier nicht noch Geld dazu bekommt, wenn man T-Shirts kauft, wundert mich schon fast. Warum erscheint das vermeintliche Paradies denn so billig? Es ist eigenartig… mein Bild von Hawaii war irgendwie anders… paradiesischer, aber was ich hier sehe sind Hotelburgen, Kitsch, Strandabschnitte, die erahnen lassen, dass sie bei schönerem Wetter überfüllt sind, groben Sand, grauen Himmel und Regen. Immerhin Palmen gibt. Zwar liegt ein Hauch von Glamour über schicken Hotels und den teuren Boutiquen, aber schon alleine die „Vorsicht, nasser Boden“-Schilder (aufgestellt wegen des Regens, nicht weil hier gerade frisch geputzt ist) lassen diesen nur allzuschnell verfliegen. Was die Insel-Amis offensichtlich beherrschen, ist Marketing, denn neben mir scheinen einige desillusioniert. Mit meinem Unmut über meine nicht erfüllten Erwartungen gehe ich mir relativ schnell selbst auf die Nerven, also laufe ich noch ein Wenig durch die Gegend, freue mich, dass es einen Berg im Hintergrund des Strandes gibt (Diamant Head, Vulkan) und konzentriere mich darauf, hier eh bald weg zu sein.
Ich fühle mich diskriminiert. Als weiße Westeuropäerin mittleren Alters passiert einem das zwar äußerst selten, heute aber ist es soweit: Um hier von einer Insel auf die nächste zu kommen (in meinem Fall O’ahu nach Hawai’i), bucht man am besten einen Flug, denn die Fähren gibt es nicht mehr und Schwimmen ist zu weit. Das versuche ich auch, allerdings ist eine online Buchung bei Hawaiian Airlines mit einer Europäischen Kreditkarte nicht möglich. Geht nur mit Amerikanischer, Kanadischer, Philipinischer, Japanischer und keine Ahnung was sonst noch für einer Karte. Die kleineren Flugunternehmen sind – warum auch immer – an diesem Tag teurer und man muss außerdem noch für’s Gepäck zahlen. Was tue ich also? Richtig. Ich fahre früh genug zum Flughafen und will mir hier ein Ticket kaufen. Last Minute, billigste Option, die Flieger gehen fast stündlich, da sollte ja was für mich dabei sein… denk ich in meinem offensichtlich nicht mehr ganz so jugendlichen Leichtsinn. Und hier kommt die Diskriminierung ins Spiel: Man kann hier zwar Tickets für die Hawaiian Airlines kaufen, die kosten aber ohnehin mehr als online und darüber hinaus kommt seit noch nicht allzulanger Zeit noch eine Service Gebühr von 35 Dollar hinzu, wenn man ein Ticket am Schalter kauft!!! Aloha Hawaii, das kann man doch nicht machen!!!!! Ohne eine Kreditkarte aus den genannten Ländern habe ich damit ja gar keine Chance, ein günstiges Ticket zu bekommen… Ich bin doch in den USA, kann ich den Konzern nicht wegen Diskriminierung verklagen? Ich hab nen Puls von 200… bald…. unverschämt ist das… Sowas geht doch nicht… Also bitte… Nennt es doch gleich Europäer-Gebühr. Ich hab vielleicht nen Hals… der sprengt bestimmt gleich mein eigentlich recht großzügig ausgeschnittenes Shirt… arrrgggg ufffrechen könnt ich mich…. Natürlich nehme ich mich zusammen, als ich der netten Dame hinterm Schalter erkläre, dass sie da ja wohl für eine absolut hirnverbrannte Firma arbeitet und es ja verdammtnochmal wohl nicht sein kann, dass ich einen nicht verflucht hohen Betrag draufzahlen muss, nur weil ich Europäer bin… Sie hat auch tatsächlich Verständnis für meinen Unmut und meint, dass sie es auch für unfair hält und das Schild mit der Service-Gebühr am liebsten verbrennen würde, das aber leider nicht tun kann… Schade. Außer mir ein überteuertes Ticket verkaufen, kann sie allgemein leider nix für mich tun. Na super. Internet gibt es hier auch nicht, also keine Chance doch bei einem kleinen Anbieter zu schauen, ob ich trotz Gepäckgebühr vielleicht doch noch günstiger davon komme… Um zurück in die Stadt zu fahren, mir dort Internet zu suchen und dann wieder her zu kommen, reichen auch weder Zeit, noch Motivation, noch macht es dann unbedingt finanziell Sinn von wegen Bus und so. Arrgggggg aufregen könnt ich mich. Also bisher hält dieses Hawaii echt nicht, was sein Ruf verspricht. Vielleicht hab ich aber auch nur Pech. Hoffe ich. Leben… du schuldest mir etwas… wenn ich jetzt nicht wenigstens neben einem wahnsinnig gutaussehenden Mann sitze…. ach nee… so wirklich schulden tust du mir nun wirklich nichts, hatte ja schon einer extrem gute Zeit in den letzten Monaten… seh ich ja ein… wäre trotzdem schön… würdest du vielleicht…. Wohl nicht… Meine Nachbarn sind ein hässlicher Mann und ein Kind. Und der Mann setzt sich auch noch auf meinen Fensterplatz und ignoriert mich, als ich ihn darauf anspreche. Ich denke kurzzeitig darüber nach, meinen Frust über das überteuerte Ticket an ihm auszulassen, aber bevor die Leier mit dem „Mein Kind möchte aber so gerne aus dem Fenster gucken“ kommt und ich wie ein Drache dastehe, halte ich meine Klappe dann doch bevor Feuer herauskommt und hoffe, dass sich das Kind wenigstens benimmt. Tut es natürlich nicht. Erstens hat es ein Spielzeug in Größe eines modernen (oder wahlweise recht alten) Handys, das nervige Töne von sich gibt. Zweitens will es nicht sitzen bleiben und bewegt sich ständig von seinem Platz auf den Schoß des Vaters und zurück (natürlich nicht, ohne sich damit mit den Füßen von meiner weißen Hose – ja… die macht keinen Sinn – abzustoßen). Ich brodele vor mich hin und frage mich, ob ich irgendwann doch noch platze. Als das Flugzeug dann mal ruckelt hab ich auch gleich ein ängstliches Patschehändchen auf meinem Arm, dass sich an mir festklammert und garantiert klebrig war. Wie gut, dass dieser Flug nicht ewig dauert. Ich bin kurz vorm Überkochen, während sich gleichzeitig mein Grinsen über meine schlechte Laune zu einem albernen Kichern verfestigt. Würde ich mich selbst ernster nehmen, hätten hier jetzt einige Leute ein Problem…. aber so grinsekichere ich vor mich hin. Als ich an nervigem Kind und dem hässlichem Mann vorbei aus dem Fenster sehe und den schönsten Sonnenuntergang meines Lebens erblicke, formen sich meine Lippen dann aber doch zu einem glücklichen Lächeln. Nein, Fotos gibt es natürlich keine, hab ja meinen Fensterplatz wegen Diskussionsunlust aufgegeben. Grrr….. aber soooo schön. Hammer. Stellt euch vor: unten eine Schicht fluffigster Wolken, dann ein Streifen strahlendes Orange mit zwei Miniwölkchen drin und dann wieder eine Schicht Fluff-Wolken. Absolut traumhaft. Schöner geht’s nicht. Danke Leben, hattest du etwa doch ein schlechtes Gewissen?
Am Flughafen angekommen rufe ich – wie mir gesagt wurde – im Hostel an, um abgeholt zu werden. Ja, gar kein Problem, aber eigentlich dürfte er mich nicht holen, wenn mich also jemand fragt, warum er das tut, bin ich eine Freundin… Worauf hab ich mich denn hier bitte eingelassen? Während ich auf das mir beschriebene Auto warte, schwanke ich, ob ich nicht doch ein anderes Hostel suchen soll… aber am Ende ist es alles gar nicht so dramatisch: Das Hostel ist lediglich neu und die Shuttle-Genehmigung fehlt noch. Damit kann ich Leben. Wir sammeln noch einen Schweizer auf, der vergeblich versucht hat, den Vulkan zu sehen und weil auch die von ihm gebuchte Lava-Tour wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht stattfinden kann, lädt ihn der Hostel-Besitzer zu einem Bier ein. Und weil ich grad da bin bekomme ich auch eins. Da hab ich ja nichts dagegen und kann nun bezeugen „es gibt doch Bier auf Hawaii“. Also nicht mal das Vorurteil stimmt, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Wir landen bei der Eröffnung einer Kneipe. Hier gibt es zu allem Überfluss auch noch kostenloses, echt hawaiianisches Essen, Live-Musik und Promo-Chicks, die uns Schnaps bringen. Eine Amerikanerin checkt auch noch im Hostel ein und schließt sich uns an, so dass der eigentlich doofe Tag doch noch ein schönes Ende findet. Vielleicht liegt das paradiesische Hawaii ja einfach auf einer anderen Insel? An meinem ersten Tag in Hilo ziehe ich mit dem Fahrrad los und schaue mit die „Rainbow Falls“ und die „Hot Pots“ an. Die Reizüberflutung einer langen Reise lässt einen leider etwas abstumpfen und so sind die Fälle zwar „ganz nett“, aber nicht so spannend, wie sie vor einem Jahr gewesen wären. Neben den Rainbow-Falls gibt es allerdings diverse Banyan-Trees und ich sage euch: wenn ich jemals eine Phobie vor Pflanzen entwickle, dann vor diesen Bäumen. Sie faszinieren mich ungemein, gleichzeitig finde ich sie gruselig und es wundert mich gar nicht, dass es in diversen Filmen Bäume gibt, die Menschen angreifen (oder gibt es das gar nicht und ich bilde mir das nur ein?). Bei Banyan Trees möchte ich gar nicht wissen, was die alles tun, wenn keiner hinschaut… So denke ich also darüber nach, ob ich mir eine ausgeprägte Angst zulegen sollte, freue mich über die vielen schönen Pflanzen, fahre weiter mit dem Fahrrad bergauf, lasse mich nassregnen, finde die Hot Pots langweilig, fahre extrem viel bergab, lasse mich weiter nassregnen und habe irgendwie einen schönen Tag. Bei den vielen schönen Bäumen und Pflanzen habe ich auch langsam Verständnis für den Regen. Und außerdem ist Hilo die regenreichste Stadt der USA. Noch vor Seattle. Da gibt es also wirklich keinen Grund zu meckern. Und warm ist es auch noch. Und diese Pflanzenwelt hat etwas für sich… ja… ich nähere mich doch dem Paradies. Abends geht’s dann doch zur Lava-Tour, obwohl wir nach wie vor nur zu zweit sind. Das verstehe, wer will. Mit Taschenlampen bewaffnet geht es los. Bis zu der Stelle, an der die Lava in den Ozean fließt sind es ca. 1,5 Stunden über erkaltete Lava. Wir betreten Land, das es vor wenigen Wochen noch nicht gab. Das ist schon irgendwie komisch, wenn man bedenkt, dass wir uns sonst auf millionen Jahre altem Boden bewegen… Ich bin froh, dass ich mir mit der Taschenlampe ohnehin den Weg leuchten muss, denn auch sonst wäre mein Blick fest auf den Boden gehaftet. Niemals hätte ich gedacht, dass kalte Lava so schön ist. Silbrig glänzend und in den unterschiedlichsten Strukturen. Manchmal wirkt es grob, manchmal wie in Falten gelegte Seide… ich nutze jede Gelegenheit, die Steine anzufassen und bin jedes Mal wieder erstaunt, wie etwas so weich aussehen und trotzdem so hart und rau sein kann. Über relativ frisch erstarrte Lava zu laufen, hört sich an unterschiedlichen Stellen auch recht verschieden an. Mal ist es, wie durch Kies zu laufen, mal wie Holzkohle auf den Grill schütten und manchmal klingt es, wie trockene Kellog’s Frosties essen, während man sich die Ohren zu hält. Wir kommen an einen Strand aus schwarzem Sand, auch der war vor Kurzem noch nicht hier. Wow. Es glitzert und der Sand ist rau und glasig. Ich glaube, mein Mund steht vor erstaunen offen und da geht es auch schon weiter. Es ist wirklich stockfinster und das Einzige, was man außer unseren Taschenlampen sieht, ist der glühend rote Wasserdampf am Lava-Strom und unendlich viele Sterne am Himmel. Auch das habe ich noch nie gesehen. Es sind so viele, dass sie fast ineinanderzufließen scheinen und trotzdem kann man noch jedes einzelne Funkeln erkennen. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber es scheint, als würde es immer wärmer werden, je näher wir dem Lava-Strom kommen. An einigen Stellen kommt durch die Ritzen in der erkalteten Lava heiße Luft und manchmal kann man sogar das Glühen in der Tiefe sehen. Und dann sind wir auch schon nahe genug an der Lava, um zu sehen, wie sie sich langsam zum Meer bewegt und in gigantischen roten Dampfwolken endet. Ein wahnsinniges Spektakel. Wir gehen noch ein wenig näher ran und unser Tour-Guide sagt nur: „Ich beobachte das Wasser und wenn ich sage „zurück“, dann geht ihr zurück. Sofort!“ Zugegebenermaßen kitzelt das die Nerven doch ein wenig, aber was wir sehen können ist einfach magisch. So müssen die Menschen auf die Vorstellung von der Hölle gekommen sein. Was die Hölle eigentlich zu einem wunderschönen Ort macht… Jetzt steht mein Mund vor Begeisterung garantiert offen. Ich brauche endlich mehr Worte für „atemberaubend“.
Wieder zurück im Touristenjungle buche ich ein anderes Hostel, das zwar auch nicht schöner ist, dafür aber aber ein wenig besser gelegen. Genaugenommen ist es überhaupt nicht schöner und auch alles andere als sauberer, daher nutze ich bei jeder erdenklichen Gelegenheit die Toiletten im naheglegenen Hotel-Einkaufszentrum. Erstaunlicherweise scheinen die meisten Hostelgäste hier für länger gestrandet zu sein. Keiner ist auf der Durchreise, keiner im Urlaub (da bucht man wohl die schicken Hotels) und kaum jemand weiß, wie lange er bleibt und was er eigentlich tut. Vermutlich wissen viele nicht einmal, was sie sind (ich selbst habe eine ganze Weile gerätselt, ob die Person, mit der ich mich den Abend über unterhalte mein Mitbewohner, oder meine Mitbewohnerin ist. Erst bei der Geschichte von zwei Taxifahrern, die diskutiert haben, ob sie Mann oder Frau ist und ihrem Entsetzen darüber, ist dann auch mir klar, dass es sich offensichtlich um eine Mitbewohnerin handelt.) Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen, oder egal zu sein. Das hat ja schon was. Diverse Aussagen deuten darauf hin, dass ich im Norden der Insel das Paradies finde. Paradiesisch sind hier in jedem Fall die Busverbindungen und so mache ich am nächsten Tag eine kleine Inselumrundung. An einem der Strände an der North Shore findet ein Surfwettbewerb statt und so verbringe ich ziemlich viel Zeit damit, die riesigen Wellen und natürlich auch die dazugehörigen Sportler zu beobachten. Schon irgendwie faszinierend. Zwar verstehe ich nicht so ganz, was die wann und wie zu tun haben, aber lange stehen bleiben ist wohl gut. Ja, es ist schön, hier zu sitzen und auf das Meer zu starren, aber das Paradies ist es nun wirklich nicht. Oder ist meine Vorstellung vom Paradies einfach übersteigert? Zurück in Honolulu mache ich einen ausgiebigen Spaziergang über die Strandpromenade. Hier versammeln sich um diese Zeit wohl sämtliche Touristen, es gibt Straßenkünstler- und Händler, alles ist mit Fackeln beleuchtet und dieses Licht ist nicht nur für alternde Frauen, sondern auch für Strände und Hotelburgen äußerst schmeichelhaft. Ja… so hatte ich mir dieses Hawaii schon eher vorgestellt… Urlaubsfeeling pur. Vermutlich lässt sich das Bild vom Paradies schon alleine daher aufrecht erhalten, weil die zahlreichen Hochzeitsreisenden die Hotelanlagen vermutlich einfach nicht verlassen. Vielleicht spricht sich das einfach herum und es ist doch keine riesige Marketing-Kampagne der Vereinigten Staaten, die mir überhöhte Erwartungen eingepflanzt hat. Vielleicht sollte man hier einfach auf den Touri-Pfaden wandeln und machen, was alle tun, um zu sehen, was man erwartet? Ok, einen Versuch ist es wert und so nehme ich am nächsten Tag wiedereinmal den Bus und fahre zur Dole Ananasplantage. Hier kommen sämtliche Touren hin, die ich irgendwo gesehen habe. Warum das so ist, wird mir allerdings nicht wirklich klar, denn die „Plantage“ ist ein riesiger Souvenir-Laden, ein winzingkleiner Botanischer Garten und ein überteuertes Labyrinth. Naja, dann weiß ich das jetzt auch. So mache ich mich schnellstmöglich wieder zurück und lasse mich erneut auf das Urlaubsflair der Hotelsiedlungen ein. Es ist mein letzter Abend in Hawaii, da sollte ich doch endlich zu meinem Cocktail mit Schirmchen kommen. In meinem Hostel ist es leider vollkommen ausgeschlossen, jemanden für so eine Schickimicki-Aktivität zu gewinnen, also suche ich mir alleine die ansprechendste Strandbar und bestelle einen Cocktail. Der ist zwar äußerst lecker, aber leider ohne Schirmchen. Irgendwie ist hier nichts so wie ich dachte. Trotzdem genieße ich dieses Stückchen Luxus in einer Hotelbar, direkt am Strand von Waikiki Beach. Mein Flug ist erst am Abend und eine Aktivität steht mir noch bevor, schließlich ist auch O’ahu vulkanischen Ursprungs. Mit meiner Mitbewohnerin und einem Deutschen mache ich mich daher auf, den „Diamond Head“ zu erklimmen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist, dafür ist die Aussicht wunderschön, das Wetter ist traumhaft und so kann ich endlich einmal die Ausmaße und den fast perfekten Kreis sehen, der sich Krater nennt. Ja, von dieser Seite gefällt mir dieses Hawaii und als wir nachher am Strand sitzen, den Sonnenuntergang anschauen und „Frozen Joghurt“ essen, (aus einem unglaublichen Laden, in dem man sich sämtliche Sorten wild zusammenstellen kann, die dann auch noch mit allerhand Kram von Obst bis Keksen dekoriert werden), frage ich mich, warum ich mich nicht einhundertprozentig über diese Inseln freuen kann. Habe ich einfach die falschen Ecken entdeckt, bzw. die Richtigen übersehen oder sind es einfach die Erwartungen, die ja bekannt dafür sind, einem so manchen Spaß zu verderben?










Ca. drei Monate war ich nun in Nordamerika unterwegs und es wird Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Allen US-Patrioten kann ich nur ans Herz legen, an dieser Stelle einfach nicht weiter zu lesen, denn es handelt sich hier um meine persönlichen Eindrücke, die äußerst subjektiv sind und meine Sicht der Dinge ist von meinem Blick geprägt, der sich natürlich auf das richtet, was ich sehen will. Ich denke, ich habe viel gesehen, aber natürlich nicht alles, habe viel erlebt, aber natürlich nicht alles Mögliche und ich habe viele Menschen kennengelernt, aber auch nicht alle. Meine Meinung kann sich also nur aus dem zusammensetzen, was meine letzten Monate geprägt hat. Ich finde, es ist eine ganze Menge und ich kann mir nun ein Urteil erlauben. Und selbst, wenn nicht, würde ich es natürlich trotzdem tun Warum ich ein kleines Vorwort schreibe? Ganz einfach, weil ich in Neuseeland bei einer Amerikanerin extrem angeeckt bin, weil ich nicht vor Begeisterung (nicht einmal für Hawaii) gesprüht habe. Offensichtlich bin ich der erste und einzige Mensch, dem es so ergeht und bevor mich jemand bei der Patrioten-Behörde anzeigt… Aber nun genug des Kleingedruckten: So sehr ich mir auch angewöhnt habe, Kanada und die USA als Nordamerika zusammenzufassen, so sehr bestehe ich doch darauf Nordamerika in vier Teile zu teilen. Kanada (ja, da unterscheide ich nicht wirklich zwischen dem französischen und dem englischen Teil), USA, Alaska und Hawaii. Die USA müssen geteilt werden, denn die beiden genannten US-Amerikanischen Staaten behaupten zu Recht von sich, dass sie anders sind, als das „Mainland“. Aber beginnen wir mit Kanada. Die Unterschiede auf dieser Welt zu entdecken war und ist ein wichtiger Punkt auf meiner Reise. Dass ich in Québec nicht einmal das Gefühl hatte, Europa entkommen zu sein, fand ich daher extrem erstaunlich. Erst mit Verlassen der Städte Montréal und Québec City und der damit verbundenen Entdeckung extremer Weite, wurde mir klar, wie anders mein Heimatkontinent doch ist. Für mich ist es normal, dass man mit einem Fuß in einem Land und mit dem anderen im Nächsten sein kann. Ja, man kann sogar noch seine Hand in ein Drittes setzen und keiner ist erstaunt (wobei man dann zugegebenermaßen albern aussieht). In Kanada gleicht es einer Weltreise, wenn man die andere Seite des Landes besucht – und kaum einer scheint es zu tut. Dörfer sind hier noch wirkliche Dörfer und man kann Ewigkeiten durch das Land fahren, ohne der Zivilisation zu begegnen. Und dabei befinde ich mich fast ausschließlich in den dicht besiedelten Teilen des Landes. Die unglaubliche Größe und die Landschaft sind atemberaubend. Wunderschön und gigantisch. Gleichzeitig gehen hier von der Natur die unterschiedlichsten Gefahren aus. Stark wechselnde Witterung, wilde Tiere etc. Etwas Neues für mich, denn in weiten Teilen meines Landes scheint die Natur schon lange nicht mehr mächtiger als der Mensch. In Kanada hingegen kann man sich so wunderbar klein fühlen. Mir scheint, als sollte man besser immer auf alles vorbereitet sein… seltsam, denn auf unseren Autobahnen bekommt man ja schon fast Panik, wenn es bis zur nächsten Tankstelle noch 50 km sind. Wie lächerlich das hier erscheint… Irgendwie widersprüchlich zu dieser Ursprünglichkeit, der Naturverbundenheit und dem Leben in und mit der Natur, sind die starken Einflüsse aus Europa (Kultur und Historie) und den USA (Modernität und Konsum), die einem überall begegnen. Ich kann es schlecht beschreiben, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich diese Einflüsse teilweise nicht richtig zu einer Gesamt-Identität verbunden haben, sondern vieles scheinbar hin- und hergerissen zwischen diesen drei Welten schwankt. Ich habe natürlich keinerlei Vorstellung davon, was es bedeutet, Teil eines verhältnismäßig jungen Landes zu sein. Aber manchmal scheint es mir, als wäre das Land ein Teenager auf der Suche nach sich selbst. Dies alles gibt Kanada zwar etwas verwirrtes, aber gleichzeitig eine erfrischende Jugendlichkeit. Mir scheint, als wären hier Entwicklungen und Veränderungen schneller und einfacher möglich als zu Hause. Es ist wirklich ein interessanter Kontrast zu der Millionen Jahre alten Landschaft, der rauen, harten, gleichzeitig aber unberührten und unglaublich schönen Natur. Wie ein Großvater, der seine Enkel auf sich herumturnen lässt. Als typische Europäerin habe ich mir von den Städten und Ortschaften mehr erwartet, was bei näherer Betrachtung natürlich völliger Unfug ist. Die Natur aber hat mich umgehauen und immer wieder in ihren Bann gezogen. In Falardeau mit dem wohl entspannendsten See der Welt, auf sämtlichen Busreisen und während denen mich das kilometerweite „Nichts“ gelehrt hat, was Entfernung bedeutet. Aber auch mit den Niagara Fällen, die unglaublich sind und mir ihre Dominanz über die Touristen erst einmal beweisen mussten. Nicht zuletzt sind aber auch meine geliebten Rocky Mountains in Kanada und prägen meinen Eindruck von diesem Land natürlich sehr stark. So wunderbar vielseitig, rau und gleichzeitig herzlich… und es gibt noch so vieles mehr, was ich noch nicht gesehen habe… das muss sich irgendwann ändern! Wenn ihr mich fragt (oder wahlweise einige Einwohner), sollte Alaska zu Kanada gehören. Nicht nur, weil es dort geographisch besser hinpasst, sondern weil das, was ich an Kanada ohnehin schätze (Naturverbundenheit, eine gewisse raue, herzliche Härte etc.) hier noch ausgeprägter vorhanden ist. Und das passt nicht in mein sonstiges Bild der USA, das ich nicht wegen eines einzigen Staates verändern möchte. Hier erscheint es mir zwar auch seltsam, dass man bei Walmart Waffen kaufen kann, aber es macht wenigstens noch Sinn. Wie mir der Taxifahrer in Haines, der mich davor bewahrt hat, zig Kilometer mit meinem Rucksack zur Fähre zu laufen, bestätigt, weiß man hier noch, wie man Fische fängt, Wild erlegt und wo es die besten Beeren zu sammeln gibt. Leben hängt hier noch viel mehr mit Überleben zusammen, als ich es mir vorstellen kann. Und ich bin nicht mal ein echtes Stadtkind. Hier gibt es Orte, die man nur mit dem Flugzeug erreichen kann, im Winter eingeschneit zu sein, ist normal. Wer seine Milch nicht Anfang der Woche kauft, hat eben am Wochenende keine und soweit weg von der Wichtigkeit von Statussymbolen muss man auch erst einmal sein… Zumindest der kleine Teil von Alaska, den ich gesehen habe, scheint mit diesem Sonderstatus wunderbar leben zu können. Die Uhren ticken hier nicht nur langsamer, sie haben vor allem andere Prioritäten. Die viel gepriesene „Hawaiian Time“ hingegen ist nicht wirklich meine Zeit. Meine Erwartungen an diese Inseln waren einfach zu groß, als dass sie von einem Staat erfüllt werden könnten, der einerseits vor Touristen-Massen überquillt und andererseits keine Lust auf Fremde zu haben scheint. Viel zu oft fühle ich mich fehl am Platz, weil ich entweder einer von Millionen Touristen bin, die möglichst viel essen, trinken und konsumieren sollen oder aber ich bin alleine unter Blicken die „was macht die denn hier?“ zu sagen scheinen. So faszinierend meine Vulkan-Ausflüge auch waren, Hawaii ist für mich definitiv nicht das Paradies. Dafür scheinen mir die Menschen auch einfach zu angestrengt cool und zu unausgeglichen entspannt. Manche Gebiete sind extrem hochglanzpoliert, während viele andere vor sich hingammeln und keinerlei Aufmerksamkeit zu erhalten scheinen… wie ein armes Land mit einer aufgedonnerten Strandpromenade. Mein liebes Hawaii, es war schön, dich kennengelernt zu haben, aber wir passen einfach nicht zusammen. Ich mag deine vulkanische Herkunft und finde es faszinierend, dass du nach wie vor Feuer spuckst und mir ein unvergessliches Naturspektakel vorgeführt hast. Aber darüber hinaus bist du mir einfach viel zu oft auf die Nerven gegangen, als dass ich dich ernsthaft in mein Herz schließen könnte… Damit bleiben noch 48 Staaten der Weltmacht USA, von denen ich ziemlich viele bereist bzw. durchreist habe. Tausende von Kilometern im Bus, die mich nicht dazu gebracht haben, meine ausgeprägten Vorurteile abzubauen. Im Gegenteil. In diesem Land habe ich bekommen, was ich erwartet habe… nein, meine Erwartungen wurden teilweise sogar noch übertroffen. Um meiner subjektiv-extremen Sicht noch einen kleinen Hauch von Fairness zu geben, muss ich dazu sagen, dass ich mit dem Greyhound-Bus unterwegs war. Diese Entscheidung ist vermutlich maßgeblich dafür, dass ich die USA eher als Entwicklungsland, denn als reiche Industrienation wahrgenommen habe. Was ich sehe kann nicht mehr viel gegensätzlicher zu dem Bild sein, das Hollywood mir seit Jahren versucht hat zu vermitteln. So ein Greyhound-Bus ist ja prinzipiell nichts schlechtes. Relativ gutes Netzwerk, viele Ortschaften gut erreichbar, ziemlich billig und (das ist mir allerdings nur einmal passiert) manchmal gibt es sogar WiFi im Bus. Soweit klingt es ja nicht schlecht. Warum entgleisen also den meisten Menschen (außerhalb der Busse und Busbahnhöfe) die Gesichtszüge, wenn ich ihnen erzähle, dass ich mit dem Greyhound unterwegs bin? Wer mit dem Greyhound unterwegs ist, ist arm. Und arm sein ist schlecht. Prinzipiell und immer. Wenn es sich also irgendwie vermeiden lässt, fährt man hier nicht mit dem Bus. Da bewegt man sich lieber gar nicht fort. Wer es nicht vermeiden kann, hat guten Grund dazu. Meinen Schätzungen nach, saßen ca. 60% der Greyhound-Passagiere in den letzten zwei Jahren irgendwann im Knast, oder werden es laut meiner Prognose in den nächsten zwei Jahren tun. Allein über den Geruch im Bus könnte ich mich eine geschlagene halbe Stunde auslassen. Dieser ähnelt – und ich vermute, dass die Busgesellschaft daher ihren Namen hat – dem Gestank von nassem Hund und kriecht in alles, was man hat und ist. Manchmal reicht nicht einmal eine ausführliche Dusche, um sich nach einer nächtlichen Reise wieder frisch zu fühlen. Davon, dass mein Rucksack vermutlich nie wieder angenehm riechen wird, brauche ich wohl gar nicht sprechen. Aber – und irgendwie hat schließlich alles etwas Gutes – nach meiner Mindener Ghetto-Wohnung erscheint mir das alles gar nicht mehr so schlimm… Wie kann ich euch sonst noch ein Bild vom Greyhound-Fahren vermitteln, ohne zu weit auszuholen und ohne damit die nächsten drei Seiten zu füllen? Ich könnte euch von meiner Theorie erzählen, dass man mit dem Fingernageldreck aller Reisenden den Grand Canyon auffüllen könnte. Oder davon, dass es immer ein Glücksspiel ist, wer sich neben einen setzt. Der eklige Typ, der vermutlich schnarcht und dessen Kopf vermutlich im Schlaf auf meine Schulter sackt, oder die gewichtige Dame, die zwei Plätze braucht und es geschafft hat meine Schokolade aus dem Automaten zu befreien, oder vielleicht die schreienden Kinder, die ihre Mutter ziemlich gut im Griff zu haben scheinen… Am besten teile ich einfach meine Lieblingsanekdote, erfahren in Tallahassee, dem einzigen Ort, von dessen Besuch ihr bisher noch nichts erfahren habt: In Tallahassee bin ich nur für einen Tag und das auch nur, um mir zwischen zwei Nachtbussen ein wenig die Füsse zu vertreten. Das Einzige, was ich dort tue ist ein Besuch im Einkaufszentrum. Mittagessen, Frisör, Starbucks und zurück zum Busbahnhof. Dort wimmelt es – wie üblich – vor Security, definitiv ein beruhigender Fakt. Um mir die Zeit zu vertreiben lese ich. Das scheint hier allerdings nicht allzu selbstverständlich zu sein, denn die Tatsache, dass ich ein Buch vor meiner Nase habe, ist für diverse Menschen Grund genug, mich anzusprechen. Zuerst ein mittelalter Mann, der mich extrem nervt, dann aber verschwindet, als ich ihm mehrfach mitteile, dass es mich keineswegs beeindruckt, dass auch er manchmal Bücher liest und dass ich mich wirklich gerne meiner eigenen Lektüre widmen möchte. So einfach lässt sich das mir aufgezwungene Gespräch mit einem extrem tätowierten Weißen im Unterhemd und einem Dunkelhäutigen mit Frontvergoldung dann leider nicht unterbrechen. Während der frontvergoldete Typ mir (natürlich mit der Vor- bzw. Nachsilbe „Lady, Honey, Sweety…“) versucht klar zu machen, dass ich unwahrscheinlich gut aussehe (klar, ich trage schließlich meine besten abgegammelten Jogginghosen und einen schwarzen Fleecepulli, der nach Greyhound riecht), versucht der andere es mit einem Gespräch, das in folgendem Dialog gipfelt: Er: „Du bist also aus Deutschland… bist du mit dem Greyhound hierher gefahren?“ Ich: „???????????“ Was soll ich dazu sagen? Vielleicht: „Nein, das ging leider nicht, da die Busse aufgrund des Salzwassers im Getriebe kürzlich Probleme bekommen haben!“ oder „Nein, Schwimmflügel werden in Busgröße leider nicht mehr hergestellt!“ oder einfach „Ja, klar!“ Noch bevor ich antworten kann, merkt er, dass er wohl etwas Dummes gesagt hat und meint: „Das ist wohl zu weit, oder? Das würde vermutlich drei Tage dauern oder so!“ Genau. Drei Tage. So ungefähr. Und das ist auch das Einzige, was dagegen spricht. Vollpfosten. Kann ich jetzt bitte endlich weiter lesen? So viel zu meinen Mitreisenden. In meiner ganzen Greyhound-Zeit habe ich vielleicht 10 andere Backpacker im Bus getroffen und ein paar vereinzelte Studenten. Dafür aber viele Menschen, die bereitwillig ihr Leben mit mir, anderen Passagieren oder dem ganzen Bus geteilt haben. Und damit meine ich Geschichten über Gefängnisaufenthalte, Bewährungsstrafen, Adoptionen, Entzüge, Gerichtstermine etc. Es ist faszinierend, wie viele Menschen Müllsäcke statt Koffern verwenden und wie viele unterschiedliche Grau- und Drecktöne Kleidung annehmen kann. Ferner von der Glamour-Welt der Hochglanzmagazine kann man gar nicht mehr sein… Genau dieser extreme Unterschied zwischen Arm und Reich lässt die Vermutung in mir aufkommen, dass die USA eigentlich ein Entwicklungsland sind. Natürlich nicht nur im Bus, sondern auch in vielen der kleinen Orte durch die wir fahren, in denen leerstehende Häuser vor sich hingammeln und vieles einfach nur trostlos aussieht. Auf der einen Seite ist alles hochtechnologisiert, es gibt bombastische Städte, alles scheint möglich und es herrscht eine „höher, schneller, weiter“- Mentalität, die ihres Gleichen sucht. Gleichzeitig gibt es so viel Hoffnungslosigkeit und fehlende Motivation. Das ganze Land scheint voller Gegensätze und ich frage mich, wann diese außer Balance geraten. Oder ist es vielleicht schon passiert? Wie kann es sein, dass man sich in einem der reichsten Länder der Welt nicht prinzipiell sicher fühlen kann? Neben der oberflächlichen Freundlichkeit scheint jeder über ein gehöriges Maß an Misstrauen der Menschheit gegenüber zu verfügen. In jeder Stadt gibt es Gegenden, die man auf keinen Fall betreten sollte und das große Aufgebot an Security ist zwar einerseits beruhigend, andererseits frage ich mich aber doch, aus welchem Grund es überhaupt notwendig ist… Immer wieder erscheint mir „Verschwendung“ das einzig passende Wort für so vieles. Alleine der Müllberg, für den ich nach meiner kurzen Reise verantwortlich bin… so viele Bäume kann ich in meinem Leben gar nicht pflanzen, ohne eine Baumschule zu eröffnen. Und – ohne Arrogant wirken zu wollen – es wäre so einfach, den CO2 Ausstoß der USA signifikant verringern. Klimaanlagen nicht so kalt einstellen, dass man in Gebäuden und in Bussen generell einen warmen Pulli braucht. Es muss doch nicht sein, dass mir die Brille beschlägt, wenn ich aus dem Bus steige, oder? Und warum muss man Getränke auf Minusgrade herunterkühlen? Ein Kühlschrank ist doch kein Gefrierschrank und ich persönlich brauche den Schmerz an den Zähnen und in der Magengegend nicht! Außerdem habt ihr lieben Amerikaner doch panische Angst vor Schweiß, also solltet ihr doch verstehen, dass der Körper bei diesen Temperaturschwankungen durchdreht. Oder wie wäre es denn mit etwas kleineren Autos? Da wären auch gleich die Staus kürzer. Und überhaupt, ein klein Wenig mehr Verständnis für Entfernungen. Das muss doch auch möglich sein, wenn man sich nicht dem metrischen System unterworfen hat, oder? Viele Menschen scheinen einfach nicht einschätzen zu können, was Laufentfernung ist und an welcher Stelle der nächste Parkplatz sogar weiter entfernt ist, als wenn man direkt zu Fuß geht. Es ist faszinierend, wie ein Land so auf Autos eingerichtet ist. In vielen Orten kann man zu Fuß zwar Ersatzteile fürs Auto kaufen, aber keine Milch. Vielleicht kann man es als „Gedankenlosigkeit“ zusammenfassen, denn viele Dinge, die uns selbstverständlich sind, scheinen hier noch gar nicht ins Bewusstsein gerückt zu sein. Und dabei meine ich nicht, dass Recycling hier nicht mit Materialien, sondern mit ursprünglicher Verwendung des zu recyclenden Gegenstandes zu tun hat. Wie sonst lässt sich erklären, dass Aluminiumdosen, Glas- und Plastikflaschen in einen Container kommen. Andere Glas und Plastikverpackungen aber in den Restmüll sollen? Was ich meine ist, dass sich ein Großteil der Bevölkerung einfach viel weniger Gedanken zu machen scheint, als in vielen anderen Ländern. Offensichtlich gibt es eine grandiose Elite, wie sonst lassen sie die Universitäten und all die erfolgreichen Konzerne erklären, aber die breite Masse scheint einfach kaum nachzudenken oder wird vielleicht sogar dumm gehalten. Das ist zumindest mein Eindruck. Und was mir wirklich fehlt, ist die Vielseitigkeit. Ich hatte erwartet, z.B. im Supermarkt vor Produkten fast erschlagen zu werden. Aber nein. Es gibt nur relativ wenig Auswahl und dabei kaum etwas, das es bei uns nicht gibt. Und irgendwie schmeckt fast alles gleich (es sei denn, man sucht die Bioläden auf). Überhaupt scheinen sich die Geschmacksrichtungen hier auf „Apfel, Pizza, Zimt, Blaubeere, Ceddar und BBQ“ zu beschränken. Ach ja und natürlich Salz und Zucker. Das steht ganz oben auf der Liste und dass man hier Dinge bekommt, die so stark gesüßt sind, dass sie schon wieder bitter schmecken (inverse Homöopathie quasi), damit habe ich nicht gerechnet. Mir persönlich ist das Land einfach zu flach und oberflächlich. Vieles folgt einem seichten Massengeschmack ohne Höhen und Tiefen. Vielleicht hätte ich länger an einem Ort bleiben müssen, um weitere Schichten zu entdecken. Aber das was ich von der „Kultur“ (im weitesten Sinne) gesehen habe, hat einfach nichts mit dem zu tun, was ich schätze. Was aber wäre, wenn ich das alles ignorieren könnte und meinen Blick einfach nur auf das richte, was schon vor den Menschen dort war? Es bliebe ein riesiges Land mit unbeschreiblicher Natur, unerschöpflich scheinenden Ressourcen, vielfältigen Landschaften und nicht zuletzt mit dem Grand Canyon, der mich so fasziniert hat, dass mich allein der Gedanke an den Moment in dem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, zu Tränen rührt.
Auf meinem Flug nach Neuseeland verliere ich einen Tag. Und das nicht im Sinne von Zeitverschwendung, weil ich im Flugzeug sitze. Nein, dieser Tag existiert für mich einfach nicht, denn ich überfliege die Datumsgrenze. Für mich wird es keinen 6. November 2010 geben und da ich nicht zurück fliege, bekomme ich auch keinen Tag doppelt, quasi als Entschädigung. Wenn ich ausrechne, wie viele Tage ich schon lebe, muss ich von nun an nicht mehr nur die Jahre mit 365 multiplizieren und für jedes Schaltjahr einen Tag hinzuzählen, ich muss auch einen Tag abziehen. Ok, so wirklich verkompliziert dies meinen Alltag nicht. Oder muss ich jetzt meinen Geburtstag verschieben? Ich bin jetzt also quasi ein inverser Phileas Fogg, der ja bei seiner Weltumrundung einen Tag geschenkt bekam und somit seine Wette gewinnen konnte. Ich hingegen gewinne gar nichts. Also vermutlich. Woher soll ich das wissen? Wer weiß, was an diesem 6. November hätte passieren sollen? Vielleicht ist es genau dieser Tag, an dem ich den Mann meines Lebens treffen sollte. Das wird dann wohl nicht passieren. Oder ein Lottogewinn? Definitiv eine vertane Chance, denn der 6. November ist ein Samstag. Vielleicht sollte mir am 6. November aber auch ein Klavier auf den Kopf fallen… Was auch immer, ich werde wohl nie erfahren, was sich der 6. November 2010 für mich ausgedacht hatte.
Ich bin versucht zu schreiben, dass mich dieses Land bereits vom ersten Moment an begeistert, an dem ich festen Boden betrete, aber das wäre glatt gelogen. Denn schon am Flughafen in Honolulu ist mir klar, dass mir mein nächstes Reiseziel gefallen wird. Egal mit welchem Kiwi ich mich unterhalte, mir sprüht eine Freundlichkeit und ein Humor entgegen, wunderbar. Der Lonely Planet schreibt, dass die Neuseeländer alles versuchen werden, um einem eine gute Zeit in ihrem Land zu machen. Und diesen Eindruck bekomme ich schon jetzt (und eigentlich auch schon vorher von den Kiwis, die ich sonst so getroffen habe). Es ist eine angenehme Form von Stolz gegenüber ihrem Land, die nicht in einem „unser Land ist das Beste“ gipfelt, sondern mit der schlichten Beschreibung: „du wirst es mögen!“ Im Flugzeug sitze ich neben einer Amerikanerin, die einen Neuseeländer geheiratet hat. Eine Zeitlang haben sie zusammen in der Mitte (also in Hawaii) gelebt und jetzt ziehen sie mehr und mehr nach Neuseeland. Sie ist mit ihrem Vater unterwegs, der schwerhörig ist und wegen der Flugzeuggeräusche kein Hörgerät trägt. Dass das für Unterhaltung sorgt, überrascht natürlich überhaupt nicht, denn er versteht prinzipiell das Falsche (manchmal glaube ich mit Absicht) und natürlich schreit er alles, was er sagt. Wirklich filmreif. Zum Glück sieht es auch seine Tochter mit Humor. Apropos Humor: Ich scheine mich einem Land zu nähern, in dem sich die Menschen nicht unbedingt ernst nehmen. Oh, wie freue ich mich darauf und schon im Flugzeug erhalte ich die erste Kostprobe: während alle mir bekannten Fluggesellschaften die „Safety“-Videos extrem ernst und… nunja… sicherheitsbedacht gestalten, hat New Zealand Airlines einen Film mit der Rugby Mannschaft gedreht. Und die Jungs benehmen sich wie große Kinder während sie die Schwimmwesten etc. ausprobieren. Die Informationen kommen natürlich trotzdem rüber und außerdem hab ich mich am Ende schlapp gelacht. Selten hab ich den Videos so viel Aufmerksamkeit geschenkt… ja… ich freue mich darauf, mehr von diesen Albernheiten erleben zu dürfen! Zu allem Überfluss sehe ich dann auch noch den schönsten Sonnenaufgang meines Lebens. Zwar habe ich keinen Fensterplatz, kann aber trotzdem sehen, wie sich die Sonne durchkämpft und sich der Himmel von Schwarz über Blau und Grün (das hab ich wirklich noch nie gesehen) in die Gelb- und Rot-Töne verfärbt… mit offenem Mund sitze ich da und frage mich, wie etwas so schön sein kann. Und genau in diesem Moment habe ich Angst, das Land nie wieder verlassen zu wollen. Bei der Einreise gibt es dann ein Problem mit meinem Visum. Das gute alte Null und O-Problem (es gibt keine Os in Passnummern, nur Nullen, aber es führt trotzdem zu Chaos), doch auch hier sind alle freundlich, bitten mich kurz zu warten, damit sie es klären können und kurze Zeit später habe ich den richtigen Stempel im Pass (den, der mir erlaubt zu arbeiten). Mein Rucksack wartet bereits auf mich (ausnahmsweise muss ich also nicht ewig fürchten, dass er nicht mitgekommen ist) und als ich am Geldwechselschalter stehe (irgendwie muss ich meine kanadischen Dollar ja loswerden), lerne ich ein Mädel aus Hawaii bzw. Kalifornien kennen (Jessica), die zum gleichen Hostel möchte, wie ich. So schnell kann es gehen und so erkunden wir gemeinsam Auckland und wägen ab, was wohl die Beste Möglichkeit der Fortbewegung ist.
Nie hätte ich damit gerechnet, dass ich mich einem Reisebus anschließe, aber hier scheint es tatsächlich die beste Möglichkeit zu sein.Zumindest, wenn man alleine unterwegs ist. Da wir uns kurz vor der Sommersaison befinden, gibt es auch ein extrem gutes Angebot und so bin ich plötzlich Teil einer Reisegruppe. Ein Fakt über den ich ungefähr zwei Tage lang meinen Kopf schüttle. Der Stray-Bus ist wie einer der Seniorenreisebusse, mit dem Unterschied, das ich zu den Senioren gehöre. Aber das tue ich beim Reisen ja allgemein. Im Gegensatz zu den anderen Anbietern, gibt es aber doch einige über 25 und es handelt sich nicht um einen reinen „Party“-Bus. Im Gegenteil, zeitweise werden wir so mit Aktivitäten überhäuft, dass wir abends nur noch totmüde ins Bett fallen. Natürlich hat man die Wahl, ob man überhaupt etwas machen möchte und wenn ja, was, aber bei mir steigt zugegebenermaßen mit der Reisezeit auch die Abenteuerlust, da wäre ich ja schön blöd, wenn ich diese Gelegenheiten verstreichen lasse. Ein weiterer Unterschied zur Seniorenreise ist, dass man vom Bus abspringen und einige Tage woauchimmer verbringen kann, bevor man wieder auf den nächsten Bus aufspringt. Ein ziemlich gutes Prinzip, weil man so seine Reise entsprechend der zur Verfügung stehenden Zeit verändern kann. Ich kann es trotzdem noch nicht glauben. Der Bus holt uns im Hostel ab, bringt uns direkt zu den Aktivitäten, hält vor Supermärkten, die erste Nacht im Hostel ist jeweils reserviert und man muss sich nicht einmal darüber Gedanken machen, was man sehen und machen möchte, denn die besten Dinge bekommt man auf dem Silbertablett (naja, ok… in einem abgegrabbelten Plastikordner) serviert. So einfach kann das doch nicht sein! Beim Reisen sind die „Alltagsprobleme“ ja ohnehin reduziert auf „Wohin will ich? Wie komme ich dorthin? Wo schlafe ich? Was möchte ich machen? Was esse ich?“ Die einzige Frage, die jetzt noch offen ist, ist die nach der nächsten Mahlzeit und selbst das relativiert sich schnell, weil wir oft mit ein paar Leuten zusammen kochen, somit nur einer Idee folgen. Das erste Lied, das ich bewusst in Neuseeland höre, ist „Let me entertain you!“ von Robbie. Ok, wenn Neuseeland mich bespaßen möchte, dann soll es das mal tun. Ich lasse mich darauf ein, lehne mich zurück und werde zum Reisebus-Lemming. Eine angenehme Abwechslung und statt länger an einem Ort zu verbringen (wonach mir eigentlich gerade ist), bleibe ich einfach für die gesamte Reise über die Nordinsel im gleichen Bus. So viele Eindrücke, so viele Menschen, so viel atemberaubende Landschaft, so wenig Zeit und Muse einmal aufzuschreiben, was eigentlich so alles passiert. Und das rächt sich natürlich. Mittlerweile bin ich schon seit über einem Monat in Neuseeland, gönne mir ein paar Tage Ruhe und versuche endlich einmal, die Zeit Revue passieren zu lassen. Frisch in diesem Land angekommen, wolle ich eigentlich ein paar Tage in Auckland bleiben, zum eingewöhnen. Weil es sich aber anbietet, ein Weilchen mit Jessica zu reisen und somit den nächsten Stray-Bus zu nehmen, buche ich mein Hostel um und bekomme von Auckland nur einen ersten Eindruck. Dieser aber ist einfach unglaublich positiv. Nicht, dass die Stadt besonders schön wäre, die Geschäfte außerordentlich vielseitig, das Wetter überdurchschnittlich gut oder, dass ich irgendetwas aufregendes unternommen hätte. Nein, es ist einfach nur das Gefühl, dass mich die Stadt (und in diesem Falle ein ganzes Land, ja sogar ein neuer Kontinent) mit offenen Armen empfängt. Solch eine Begrüßung kenne ich bisher nur aus Görlitz und Krakau. Neben dem Auskosten dieses Gefühls tun wir trotzdem noch etwas für unsere kulturelle Weiterbildung und besuchen die Kunstgalerie und im Rahmen einer Stadtführung den Botanischen Garten und das Auckland Museum. Hier bekomme ich erste Eindrücke von der Maori-Kultur, die nach wie vor überall präsent scheint. Die Ähnlichkeiten mit den Ureinwohnern Hawaiis sind dabei nicht zufällig, denn einige sind von dort aus einfach weitergereist, bis sie hier waren. Mein Hightlight im Museum aber ist der Vulkanausbruch-Simulator. Im Prinzip ein Raum, eingerichtet, wie ein Wohnzimmer mit laufendem Fernseher und Blick aus dem Fenster (Leinwand) auf den Vulkan Rangitoto, der vor 600 Jahren zum letzten Mal ausgebrochen ist und irgendwann vermutlich Auckland in Schutt und Asche legen wird. Und genau das wird dann simuliert. Mit entsprechenden Bildern, Wackelndem Boden und abbrechender TV-Übertragung. Schon spannend.. Ob ich ein Erdbeben erleben werde, so lange ich hier bin? So ein kleines, bei dem niemand zu Schaden kommt würde ich ja schon gerne mal mitbekommen…
Morgens um 7.00 Uhr geht es los und wir begeben uns in den orangefarbenen Bus, aka Mr. Scoobs, ein Fahrzeug mit… sagen wir… Charakter. Unsere Busfahrerin heißt Curry und bis ich ihre Durchsagen verstehe vergehen einige Tage. Der Kiwi-Akzent ist mir noch unbekannt, Mr. Scoobs sieht es nicht ein, sein Mikrofon immer problemlos arbeiten zu lassen und Curry benutzt außerdem jede Menge Slang und in jedem zweiten, nein manchmal auch in jedem Satz den Klassiker „Sweet as…“ (übersetzt so viel wie: „super, hätten wir das auch geklärt“ oder „ok“ oder „ähhhm“ oder, oder oder). Der Kiwi-Akzent ist eigentlich recht lustig. Prinzipiell ist er dem Britischen natürlich ähnlicher, als dem Amerikanischen, außer die „rrrr“’s, die kann man nach guter alter westerwälder Tradition ordentlich rollen. Hinzu kommt, dass es nur drei bis vier Vokale gibt. O, U und I. E kann prinzipiell, A manchmal durch I ersetzt werden. „Turn lift“ heißt also, dass man einfach nur links abbiegen soll und hat nichts mit einem Aufzug zu tun. Und das der Ort „Timms“ eigentlich „Thames“ heißt, hätte ich nie herausbekommen, hätte ich es nicht auf dem Fahrplan gelesen. Was mich beruhigt ist, dass Englisch-Muttersprachler anderer Länder mindestens die gleichen Probleme haben und die meisten Fremdsprachler die Durchsagen einfach zu ignorieren scheinen. Der erste Stop ist an den „Hot Water Beaches“. Das heißt keineswegs, dass das Meer hier angenehm warm ist, sondern, dass man am Stand Löcher buddeln kann, bis man eine heiße Quelle entdeckt. Diese muss man dann geschickt mit dem eiskalten Meerwasser mischen und hat einen gemütlichen, heißen Pool, direkt am Strand. Soweit zur Theorie. Ich hatte bereits die idyllischsten Bilder in meinem Kopf, wie ich dort liege und den Tag genieße, als ich den Strand erblicke und ersteinmal lachen muss: Was ich sehe ist ein irrsinniges Menschengewusel in Badebekleidung und mit Spaten in den Händen. Überall hört man (später auch von mir) Schreie, weil jemand gerade einmal wieder durch eiskaltes oder schlimmer noch: extrem heißes Wasser gelaufen ist. Ein komplettes Loch zu buddeln erscheint uns irgendwie nicht sinnvoll, also testen wir bestehende Pools. Stellt euch vor, eine gesamte Busladung Backpacker hüpft durch diverse Sandlöcher und ruft „Too cold, too cold… a bit warmer… too cold, aaahhhhh toooooooo hot!“, während diejenigen, die bereits ein schönes Loch gefunden haben in Entspannung schwelgen und die, die darüber hinaus noch gut vorbereitet sind, außerdem noch ein Glas Wein dazu trinken. Irgendwann entern wir einen extrem großen Pool, in dem ein – ich glaube – schwedisches Ehepaar mit erwachsenem Sohn sitzt, dass sich durch unsere Horde zwar nicht vertreiben lässt, uns aber Platz macht. Und es ist wirklich unglaublich schön. Danke Natur, für diesen wunderschönen SPA-Bereich. Unser Tagesziel ist Hahei, wer möchte, kann dort Kajak fahren gehen, das aber möchte ich irgendwie nicht. Also ziehe ich mit diversen Mitreisenden los und mache eine kleine Wanderung am Strand entlang und durch diverses Gestrüpp zum „Cathedral Cove“. An einem wunderschönen Strand befindet sich eine Art Felsbogen, durch den hindurch man wiederum schöne Felsen sehen kann. Die Sonne geht bald unter, das Licht ist wunderschön und überhaupt, das Meer, der Sand, die Felsen… hatte ich das nicht alles auf Hawaii gesucht? Ganz unerwartet finde ich es hier bereits am ersten Abend außerhalb der Stadt… Neuseeland ist wirklich paradiesisch. Auf dieser kleinen Wanderung lerne ich bereits einige Leute kennen, die mich die nächsten Tage und Wochen begleiten, bzw. denen ich immer wieder begegne. So viele Namen auf einmal bringen mich fast dazu, einfach alle Mädels „Stefanie oder Julia“ und alle Jungs „Mark“ zu nennen, aber am Ende frage ich dann doch einfach wieder nach und meist führt dies zu einiger Erleichterung, weil sich auch meinen Namen keiner merkt. Ach ja, am ersten Abend brauchen wir nicht einmal übers Essen nachzudenken, denn wir haben einfach alle etwas Geld in einen Topf, genauer gesagt Currys Piratenhut, geworfen und es gibt ein riesiges Barbecue, schließlich sollen sich alle kennenlernen. Von einer taubstummen Deutschen lerne ich, meinen Namen in Gebärdensprache auszudrücken (natürlich weiß ich es nicht mehr genau und sage vermutlich etwas furchtbar unanständiges, wenn ich es dennoch versuche) und am Ende spielen wir in wechselnder Besetzung Karten, quatschen und erfüllen somit offensichtlich den Zweck des Abendprogramms.
Schon am nächsten Morgen geht es weiter. Ziel ist Raglan. Hier kann man Surfen. Und weil ich das ja eigentlich noch nie machen wollte und in Hawaii meine Chance nicht genutzt habe, melde ich mich zu dieser Aktivität. Nach einigen Trockenübungen kommt dann Aufgabe Nr. 1: das Anziehen eines Neoprenanzugs. Oh, wie gerne ich körperbetonte Kleidung wie diese trage… egal, frieren mag ich ja auch nicht und nachdem wir alle ausführlich über uns selbst und gegenseitig gelacht haben, wärmen wir uns kurz auf und dann geht es auch schon ins Wasser. So schön das Meer hier auch aussieht, warm ist es nicht… aber dafür haben wir ja die schicken Anzüge und außerdem bewegt man sich beim Surfen doch ziemlich viel. Entgegen aller nicht ganz ernst gemeinten Vermutungen, steckt doch mehr dahinter, als mit möglichst coolem Gesichtsausdruck auf einem Brett herumzustehen… Die Surfschule garantiert, dass man im Laufe des Kurses aufsteht, so ist also das Ziel schon einmal geklärt und das ist auch wirklich erreichbar. Leider haben wir nicht so wirklich viele Wellen, gleichzeitig braucht man sich dann auch vor nichts zu fürchten… aber ich sage euch: es macht verdammt viel Spaß, auf dem Board durch die Gegend zu paddeln, bis einen eine Welle erwischt und wenn man dann im richtigen Moment aufsteht, ist es schon ein schönes Gefühl, so dahinzuschweben… bis man dann – Hintern zuerst – wieder im Wasser landet. Unsere Surflehrer schubsen uns in die richtigen Wellen und so sind die Erfolgserlebnisse recht schnell da, gleichzeitig aber auch der Ehrgeiz, es mal alleine zu schaffen… Nach ca. 2 Stunden ist der Spaß vorbei und wir alle sind ziemlich müde. Meine Nase ist durchs Salzwasser gereinigt und so viel, wie ich geschluckt habe, sind es vermutlich bald auch meine Innereien. Aber es ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich mich auf ein solches Brett gestellt habe. War ja klar, bin ja ein typisches Surf-Mädchen Das mit dem Aufstehen war also erfolgreich… Klassenziel erreicht, denk ich mir… aber dann folgt die schwierigste Aufgabe: aus einem Neoprenanzug herauskommen. Schon mal versucht? Am besten an einem Ort mit dunklem Sand, der sich ganz schlecht abwaschen lässt? Mit viel Gekicher, letztmöglichem Kraftaufwand und doch mehr Sandrückständen als erhofft, schaffe ich es schließlich. Aber ich bin nicht die Einzige, die sich so anstellt… wer hätte gedacht, dass diese Anzüge für so viel Spaß sorgen können? Und das nicht nur wegen ihrer Optik… Neuseeland hat sich offensichtlich nicht nur in den Kopf gesetzt, mich zu entertainen, sondern auch zu verwöhnen. Besonders schön an den Hostels ist, dass es relativ häufig Wirlpools und Saunen gibt, wir Backpacker sollen uns ja wohlfühlen. In Auckland hatten wir bereits vom Pool aus den Blick über die Stadt genossen, heute zieht es uns in die Sauna. Und das war vermutlich eine sehr kluge Idee, denn Surfen ist ein Ganzkörperworkout und so konnten wir dann die Schmerzen am nächsten Tag doch noch halbwegs im Zaum halten.
Um eine Zeitlang keine Eindrücke zu bekommen ist Christchurch gewiss nicht der beste Ort. Allerdings auch nicht der Schlechteste. Die Großzügigkeit, mit der in Neuseeland offenbar das Stadtrecht vergeben wird, wurde ja bereits in Queenstown deutlich. .. Zwar ist Christchurch um einiges größer, dafür aber weniger aufgeregt, nicht ganz so stark von Backpackern durchzogen und irgendwie niedlich. In meiner Rangliste Neuseeländischer „Städte“ steht es schon nach dem allerersten Eindruck weit vorne. Nach dem schweren Erdbeben hatte ich mit stärkeren, allgegenwärtigen Zerstörungen gerechnet, aber zum Glück hielt sich dies noch in Grenzen. Hin und wieder entdecke ich Baustellen oder Abbruchhäuser an seltsamen Stellen und natürlich haben die munteren Kiwis das Beben auch gleich in Werbebotschaften a la „die nächste Erschütterung sollte von Ihnen kommen…“ verpackt, aber darüber hinaus scheint alles wie gehabt und das ist in diesem Falle erstaunlich historisch. Allerdings verbreitet sich während der Tage in Christchurch aus einem ganz anderen Grund eine gewisse Endzeitstimmung: Die meisten mir lieb gewordenen Reisebegleiter, von denen ich mich nicht ohnehin schon vorher verabschiedet habe, treten von hier aus ihre Heim- oder Weiterreise an. Ein wirklich seltsames Gefühl nach so langer Zeit wieder alleine weiterzureisen. Nur Catherine, die Kanadierin werde ich mit etwas Glück noch einmal treffen. Wir unternehmen noch ein paar Kleinigkeiten, laufen durch die Stadt, versuchen dem Regen zu entkommen und gehen abends auf ein Bier, aber so wirklich viel passiert einfach nicht. Überall werden Taschen final gepackt, Einkäufe extrem durchdacht und die Mahlzeiten werden von „ich hab noch… das muss auch noch weg!“ bestimmt. Eine seltsame Atmosphäre, die mich fast vergessen lässt, dass ich ja noch über eine Woche in diesem schönen Land verbringen darf.
Und schon verlassen wir das wunderschöne Hostel in Raglan auch wieder. Ich bin froh, bereits zu Schulzeiten den Leistungskurs „Busfahren“ belegt zu haben, denn so stört es mich nicht wirklich, dass sich unsere Reise in die Länge zieht, weil Mr. Scoobs, unser charakterreicher Bus nicht wirklich gut darin ist, die zahlreichen Berge hinaufzuschnaufen. Er macht seltsame Geräusche, wir müssen hin und wieder anhalten und irgendwann findet Curry heraus, dass der Gute einfach regelmäßig neues Wasser braucht. Das war natürlich nicht nur heute so, sondern schon mehr oder weniger von Beginn. Das Schöne an solchen Zwischenfällen ist ja, dass sie äußerst gut für die Gruppenbildung sind. Gut für’s Rollengerechte Verhalten ist es auch, denn sobald jemand eine Motorhaube öffnet, scheinen sich alle männlichen Passagiere dazu berufen, hineinzuschauen und etwas zu sagen. Und dabei hab ich weder die Worte „schlau“ noch „sinnvoll“ verwendet… Die entschleunigte Form des Reisens gibt mir mehr Zeit, die wunderbare Landschaft anzustarren. Hauptsächlich grüne Hügel. Und wenn ich grün sage, dann meine ich ein strahlendes Grün, dass schon fast in den Augen weh tut. Zur Beruhigung gibt es überall ein paar dekorative Schafe…. schön. Außerdem gibt es hier extrem viele Kühe. Genauergesagt Hangkühe, die sich, wenn oben auf einem Hügel stehend, alle in die gleiche Richtung wenden. Lange habe ich mit meiner Sitznachbarin Caroline diskutiert… es gibt nur eine Lösung: wie auch Hangpferde haben die Kühe wohl zwei lange und zwei kurze Beine. Das erklärt auch, warum die Kälber noch durcheinander laufen: da haben sich ja die Beine noch nicht vollständig entwickelt. Solltet ihr eine andere Lösung haben, mailt mir. Bis dahin glaube ich einfach, was ich möchte. Mache ich ja ohnehin gerne. Das heutige Aktivitäts-Angebot klingt schon wieder spannend, wer möchte sich schon Glühwürmchenhöhlen entgehen lassen? Der Spaß, den ich buche nennt sich „Tumu Tumu Tubing“ und behinhaltet neben Laufen und Schwimmen in der Höhle auch das gemütliche Treiben lassen in einem alten Autoreifen. Natürlich gibt’s auch hier wieder einen Neoprenanzug. Langsam gewöhne ich mich daran und das Anziehen ist schon nicht mehr ganz so kompliziert. Dazu gibt es Gummistiefel und einen Helm mit Licht. Das kann ja munter werden… Unsere Guides sind ein Maori und ein Hobbit. Der klassische Kiwi-Mix und die beiden lassen uns gleich wissen, dass man am besten gar nichts ernst nehmen sollte, was sie sagen. Trotzdem glauben einige, dass wir uns in der Höhle aufpassen müssen, dass uns keine verirrten Schafe auf den Kopf fallen. Daher die Helme… alles klar… Im Gegensatz zu meinem letzten Höhlenabenteuer ist das Tubing nicht wirklich anstrengend, aber ebenfalls ein großer Spaß. Nachdem wir über eine seltsame Leiter in die Höhle geklettert sind laufen wir durch etwa knöchelhohes Wasser und ich denk mir noch: „Mist, ich hab ein Loch im Gummistiefel!“ Wie bescheuert der Gedanke ist, merke ich nach der nächsten Abbiegung, dann stehe ich nämlich bis zum Bauchnabel im Nass und das Wasser sucht sich den einfacheren Weg durch den Schaft direkt zu meinen Füßen. Und ab da ist dann auch alles egal. Wir bemalen uns mit Schlamm, schwimmen, waten, klettern und springen irgendwann rückwärts mit dem Reifen am Hintern ins Wasser. Ineinander gehakt lassen wir uns dann durch die Höhle ziehen, singen alberne Lieder und beobachten dabei den Glühwürmchen-Sternenhimmel. Es ist faszinierend, wie hell die Viecher sind. Die reine Glühwürmchen-Beleuchtung reicht aus, um immerhin unsere eigenen Füße sehen zu können. Von wegen Energiesparlampe, wir brauchen Riesenglühwürmchen! Und das beste ist: die glühen, weil die ihre eigene Sch… Exkremente verbrennen! Das ist doch perfekt. Reproduziert die Tierchen und wir haben ein großes Umweltproblem gelöst! Und auch für den Abend hat sich Stray wieder etwas Besonderes für uns ausgedacht. Eine „Cultural Experience“. Was es genau bedeutet: Ein typisches Essen (regionaler Fisch, Reis und Gemüse), dann sehen wir eine kurze Maori-Show und im Anschluss lernen die Jungs den „Haka“ (Ritualtanz der Maori-Männer, äußerst sehenswert!) und wir einen lustigen Tanz mit Pois (mit Watte gefüllte Plastikfolie an Schnüren). Also lustig war das alles und in gewisser Weise auch interessant, aber schon irgendwie auch seltsam und nicht so ganz das, was ich mir unter einer „kulturellen Erfahrung“ vorstelle. So langsam verbreitet sich eine gewisse Ferienlagerstimmung. Nicht nur, weil wir mit ca. 40 Leuten auf einem Matratzenlager nächtigen, sondern auch durch die Busfahrerei und die Aktivitäten. Sowas hatte ich ja schon seit Jahren nicht mehr…
Zwischen unserer Abreise am Morgen und unser Ankunft in Taupo stehen schon wieder diverse Kleiderwechsel (oder werfe ich hier jetzt Tage durcheinander?). Mein Handtuch wird gar nicht mehr trocken und ich frage mich, in welchem Geruch das einmal enden soll… aber so schlimm, wie der schöne Ort Rotorua (erinnert ihr euch noch, was ich über die „rrrr“’s gesagt habe? Und jetzt alle zusammen: RRRRoturrrua) kann es gar nicht riechen. Dieser Ort riecht nämlich nach Furz. Angeblich wegen der vulkanischen Quellen. Ich vermute ja eher, dass die hier komische Dinge essen. Wobei… die lustigen Mudpools stinken auch und blubbern. Und die warme Quelle in der wir baden (oder war das bereits gestern?) riecht jetzt auch nicht gerade gut, aber auch nicht allzu schlimm… Schon nett, dass einem die Natur hier so kleine Wellness-Tempel vor die Nase setzt, die man kostenlos nutzen kann…. soetwas möchte ich zu Hause auch. Ohne den Geruch und die Touristen natürlich. Einfach schöne warme Quellen zum entspannen…. Ach, ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, dass ich zusammen mit diversen anderen Europäern den Plan habe, Europa näher an Neuseeland und Australien heranzurücken. Die Entfernung ist schließlich der einzige Nachteil an diesen Ländern (was Australien betrifft, kann ich das zwar bisher nur vermuten, aber was soll’s). Allerdings müssten wir dann Europa umdrehen, damit weiterhin Spanien, Italien etc. wärmer sind, als Norwegen und Finnland. Könntet ihr mit dieser Nord-Süd-Umkehrung leben? Wir hätten dann natürlich auch das Problem mit Weihnachten im Sommer, aber vielleicht legen wir einfach ein Sommerjahr ein (so wie früher einmal das Kurzschuljahr) und benennen dann auch hier die kältesten Monate in Januar und Februar etc. um. Dann passt es wieder. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Dieses Problem ist gelöst. Wie wir Europa verschieben wollen? Ganz einfach: so wie auch die Nordinsel zur Südinsel kam: wir suchen uns nen starken Maori-Fischer und der zieht Europa dann an nem Angelhaken hierher. Jemand dagegen? Ach ja, ich war beim Kleiderwechsel. Bereits seit einem Tag habe ich nicht mehr in einem Neoprenanzug gesteckt, also melde ich mich zum Rafting. Das wollte ich auch tatsächlich schon lange einmal machen, aber in Kanada war die Saison vorbei. Durch Zufall ist mein Boot ein reines Mädchen-Boot, was den großen Vorteil hat, dass wir die beiden stärksten Guides bekommen und selbst nicht mehr viel Paddeln müssen. Prima, gibt’s keinen Muskelkater und trotzdem Spaß. Seid ihr schonmal in einem Schlauchboot Wasserfälle heruntergefallen? Macht Spaß, kann ich nur empfehlen. Man wird ziemlich nass, das muss ich schon sagen, aber so fiel mir die Entscheidung nicht schwer, als es die Option der kurzen Schwimmeinlage gab. Was ich allerdings unterschätzt habe, ist die Problematik des wieder-ins-Boot-Kommens. Hätte ich es alleine versucht, hätte es vermutlich ewig lange gedauert, ich hätte mich dumm angestellt und es hätte lustig ausgesehen. Da uns die Guides helfen, verkürzt sich zwar der Zeitraum der Prozedur, alles andere aber bleibt und ich sitze irgendwann falsch herum im Boot, Beine in der Luft und fühle mich wie ein Käfer auf dem Rücken. Schwimmwesten sind der Beweglichkeit an Land aber auch wirklich nicht zuträglich… Jetzt habe ich das mit dem Rafting auch mal gemacht und weiß, dass ich es gut finde. Na super. Genau wie das Surfen kann ich es nicht einfürallemal von meiner To-Do-Liste des Lebens streichen, dafür ist es einfach zu lustig. Es ist wie mit meiner „Orte, die ich gerne sehen möchte“-Liste. Man könnte meinen, dass diese auf meiner Reise schrumpft, schließlich gucke ich mir ja doch so einiges an. Aber nein… ständig kommt etwas Neues hinzu… die Welt ist einfach zu groß, da wünscht man sich doch, man hätte mit dem Reisen gar nicht erst angefangen… obwohl. Nee, das ist auch Quatsch.
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des schönsten „Day-Hikes“ Neuseelands: dem Tongariro Crossing. 7 bis 8 Stunden und die Strecke ist kein Spaziergang, Vulkanlandschaft eben. Wir wandern los und um uns herum siehtschon wieder alles so schön aus, dass in mir die Theorie reift, dass diese Hobbits den Ring nur als Ausrede genutzt haben, mal ordentlich wandern zu gehen. Wir haben erfahrene Guides dabei und bewegen uns in einer großen Gruppe vorwärts. So wirklich schnell sind wir daher nicht, was selbst den Aufstieg, der nicht ohne Grund „Devil’s Staircase“ heißt, nicht allzuschlimm erscheinen lässt. Außerdem habe ich ja in den Rockies gelernt, dass bergauf laufen eigentlich immer durch wunderschöne Aussichten belohnt wird. Da habe ich allerdings meine Rechnung ohne den Neuseeländischen Nebel gemacht. Der zieht sich nämlich ordentlich zu und wir sehen nichts. Der National Park in dem wir uns befinden war eine der zahlreichen Kulissen für „Herr der Ringe“, aber statt Mordor sehen wir Nebel. Und das ist zu dem Zeitpunkt an dem ich überhaupt noch etwas sehe. Nachdem wir an einem geschützten Fleckchen Mittagspause gemacht haben, steht fest, dass wir nicht die gesamte Strecke gehen können, weil das Wetter zu schlecht ist. Wir müssen die selbe Strecke zurück nehmen. Wer möchte kann trotzdem noch zu den Emerald Lakes, die Gruppe wartet. Das möchte ich natürlich. Einen sand-staub-artigen Berg hinunterzulaufen ist schon nicht wirklich schön, aber was muss, das muss. Die Seen sind auch da und ich vermute sie sind wundervoll, wirklich sehen kann ich sie aber nicht. Selbst wenn man am Ufer steht, kann man nur die ersten Meter entdecken, äußerst unbefriedigend. Und dann müssen wir den Berg wieder hoch. Nicht gerade der ideale Untergrund, um es mal zusammenzufassen. Für zwei Schritte vorwärts geht es einen zurück, meine Brille vernebelt und ich sehe nichtmal zwei Schritte weit… Warum mache ich das nochmal? Ach ja, der Ring. Er muss zerstört werden. Irgendwann ist dieser Teil überwunden, wir stoßen wieder auf den Rest der Gruppe und es geht zurück. Hauptsächlich bergab, das ist schonmal was, aber das mit dem „nichts sehen“ nervt mich langsam. Alle zwei Minuten reibe ich meine Brille trocken, um wenigstens meine Füße zu erkennen, wir laufen ja nicht auf einer geteerten Straße. Meine Mühen sind vollkommen erfolglos. Noch nie kam es zu dem Punkt, dass ich ohne Brille besser gesehen habe, als mit, aber jetzt ist es soweit. Und es fühlt sich nicht so wirklich gut an. Hätte ich doch mal meine Kontaktlinsen benutzt. Dummerle, da musst du jetzt durch. Und irgendwie hat das ja auch was. Früher gab’s halt Nachtwanderungen heute halt Bergsteigen im Nebel, man wird ja auch älter. Die Strecke erscheint endlos, wir können ja schließlich nicht sehen, wo es langgeht. Gut ist, dass wir eine extrem nette Gruppe haben und man so immer wieder jemanden zum Quatschen hat. Irgendwann schaffen wir es dann doch zurück und werden im Bus mit Bier begrüßt. Sowas passiert einem auch viel zu selten, soll aber gut sein bei müden Muskeln. Die haben schließlich einiges getan, denn kürzer oder weniger anstrengend wurde unsere Wanderung dadurch nicht, dass wir einen anderen Weg zurück gegangen sind. Aber dafür hat auch dieses Hostel wieder einen SPA-Pool… und so komisch es jetzt auch klingt: es war ein wunderschöner Tag.
Wenn ich so zusammenschreibe, was ich in meiner ersten Woche in Neuseeland so gemacht habe, klingt es gar nicht mehr nach so viel Aktivität, wie es sich anfühlte. Das liegt aber glaube ich weniger daran, dass es wirklich wenig war, als daran, dass mein Gehirn wohl zwischenzeitlich die wichtigsten Informationen herausgefiltert und den Rest zum Vergessen freigegeben hat. Auf dem Weg nach Wellington kommen wir an einem Ort namens „Bulls“ vorbei. Vermutlich würde dort niemand halten, hätten sich die Einwohner nicht in den Kopf gesetzt möglichst viele Wortspiele mit „Bulls“ zu fabrizieren. Kommt fast an die Qualität von Wal-Witzen heran, aber auch nur fast. Irgendwie ist es schon anstrengend, so viel zu sehen, zu tun, so viele Menschen kennenzulernen und immer unterwegs zu sein, daher entschließe ich mich, in Wellington von unserem Bus herunterzuspringen und ein paar Tage länger zu bleiben. Unsere Busbesetzung hat sich in den letzten Tagen zwar schon verändert, trotzdem sind wir der Meinung, in Curry eine super Busfahrerin gefunden zu haben, also bekommt sie von uns ein kleines Geschenk (angeblich, das erste, das sie je von einer Stray-Gruppe bekommen hat). Ganz allgemein erscheint der erste Abend in Wellington ein guter Abend zum Feiern zu sein, also tun wir dies auch. Trudi ist mittlerweile Busbekannt und – wer sie kennt weiß, dass es gar nicht anders sein kann – feiert ordentlich mit. Wie sich herausstellt ist Wellington eine schöne Stadt und so mache ich mich mit Laura und Helen am nächsten Tag auf, um den Botanischen Garten zu erkunden. Wir folgen den Schildern „Tree House“ (die beiden Engländerinnen glauben, es handele sich um ein richtiges Baumhaus, ich dachte eher an ein Gewächshaus mit Bäumen), aber noch bevor wir dorthin kommen, sehen wir einen Spielplatz. Dieser beschäftigt uns einer gute Stunde. Von unserer Albernheit lassen sich dann noch mehr Erwachsene anstecken, so dass wir irgendwann von zwei Jungs (wenn man das so nennen kann, einer hat schon verdammt viele graue Haare) Hilfe beim Anschubsen des Karussells bekommen und ich von dort aus weitere Ausgewachsene auf der Schaukel entdecken kann… beim Vorstellen geraten wir dann doch in die Angewohnheiten von Erwachsenen, schütteln Hände und erwidern „nice to meet you“, sobald wir einen Namen hören. Da es aber nicht wirklich in den Spirit des Tages passt fügen wir dann doch ein „High Five“ an. So machen Kinder das doch, oder? Später entdecken wir einen Kühlschrank-Magneten mit der Aufschrift „There is a direct correlation between the level of happieness in one’s life and the amount of sillyness they allow into it!“ (Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Glück, dass man in seinem Leben empfindet und der Menge an Albernheiten, die man darin zulässt). Schön, wenn der Tag so wunderbar zusammengefasst wird. Das Baumhaus war übrigens ziemlich enttäuschend. Es war einfach nur ein Haus mit Bäumen drumherum und drin waren Büros oder so. Wie gut, dass wir den Spielplatz gefunden haben. Für den folgenden Tag haben wir dann ein Date mit dem Premier-Minister. Naja, fast. Es gibt eine offene Fragerunde im Parlament und da kann man als Besucher teilnehmen. Im Gegensatz zu den Amerikanern sehen mich die Kiwis nicht als Bedrohung. Beim Sicherheitscheck sage ich ihnen vorher, dass ich ein Taschenmesser in meinem Rucksack habe und alles was der Security-Mann sagt ist: „Zeig mal her… steck es am besten wieder in den Rucksack, den musst du ja eh abgeben!“ Dafür bekommen wir für alles, was wir im Parlament machen einen Aufkleber. GT steht dabei nicht für „Gin and Tonic“ sondern dafür, dass ich eine Tour mache und in die Fragerunde gehe. Das zweite T verwässert folglich nicht meinen Drink sondern ist ein vollkommen nutzloser Aufkleber, den mir eine weitere Dame verpasst, vermutlich, weil ihr die Farbe besser gefällt. Und dann sitzen wir da und versuchen zuzuhören. Meine Theorie ist ja, dass es sich um keine Debatte handelt, sondern um ein Theaterstück in dem sich jeder mal anschreihen darf. Abgesehen davon, dass ich kaum etwas verstanden habe, weil sämtliche Politiker durcheinander reden, essen, trinken, Gummibärchen durch die Bänke reichen, klatschen, meckern, brüllen, zustimmen etc. frage ich mich, was das eigentlich bringen soll. Wie gut, dass ich in diesem Land keine Steuern zahle und in meinem Land nicht weiß, wie sich unsere Politiker bei ihren Sitzungen so benehmen… Dann verlassen auch Laura und Helen Wellington und ich widme mich ein wenig meinem Blog und versuche einfach einmal möglichst wenig neue Eindrücke zu sammeln. Als ich dann aber doch einmal vor die Hosteltüre trete und ein paar Meter gehe, treffe ich zwei Französinnen (Salima und Marielle) und eine Holländerin (Liesbeth), die in meinem Bus waren, aber in Roturua ausgestiegen sind (Zum Glück haben sie den Geruch nicht angenommen). Mit ihnen ziehe ich weiter durch die (erstaunlicherweise nicht wirklich zahlreichen) Geschäfte der Stadt, wir trinken Kaffee und verabreden uns für den nächsten Vormittag für’s Te Papa (nein, das heißt nicht „dein Vadder“) Museum. Dort sollte man glaub ich mehrfach hingehen, denn die Ausstellungen sind riesig. Extrem gut gemacht, aber einfach zu viel, um alles in einem Mal aufzusaugen. Dass man dort virtuell Schafe scheren kann, höre ich leider erst später und finde es auch nicht heraus, da mir zu viele Kinder in der Kinderabteilung sind. Da die beiden Französinnen von Wellington zurück fliegen, entscheidet sich Liesbeth kurzerhand, ihren Aufenthalt in der Stadt zu verkürzen und mit mir auf die Fähre zur Südinsel und somit auf den Stray-Bus aufzuspringen. Und schon hat sich das mit dem Alleinereisen auch schon wieder erledigt. Wie schnell das hier geht…
Beim Warten auf die Fähre treffen wir dann auch Jessica, die Amerikanerin, wieder und im Bus sitzt Catherine, Kanadierin. Im Hostel sind dann (wie verabredet) die beiden Engländerinnen Helen und Laura und außerdem überraschenderweise auch die gesamte Meute Holländer und Deutsche, so dass unser erster Bus wieder fast komplett ist. Ihr glaubt gar nicht, wie man sich nach fast vier Monaten darüber freut, Menschen zu begegnen, mit denen man nicht die klassische „Wie heißt du? Wo kommst du her? Wie lange bleibst du hier? Warst du schon in Australien oder fliegst du noch hin?“-Unterhaltung führen muss. Zeitgleich mit Ankunft am Abel Tasman National Park, lernen wir das bisher einzig Negative (abgesehen von den Preisen für Internet) an Neuseeland kennen: Sandflies. Und ich weiß, dass einige von euch sie kennen, hassen und ihre Spuren auch Jahre später noch mit sich herumtragen. Elendige Mistviecher, die hoffentlich Nahrung für irgendetwas unglaublich Schönes sind, sonst möchte ich ihnen hiermit jegliche Daseinsberechtigung absprechen. Die gute deutsche Stechmücke mag mich ja nicht besonders. Das wiederum stört mich nicht, weshalb auch ich sie in Ruhe lasse. Die neuseeländische Sandfliege (das klingt ja noch viel dümmlicher) jedoch beißt auch mich. Sie sieht harmlos aus, klein, schwarz und man denkt sich noch: „Bist du vielleicht eine von diesen…!“ und schon beißt einen das Drecksding. Im Allgemeinen stirbt es danach den Tot durch Hand, Buch oder Badelatschen. Im Folgenden muss man ca. ein bis zwei Tage dem Juckreiz widerstehen, denn aufgekratzt wird alles noch schlimmer. Danke dafür, dass sich die Tierchen auch gerne mal Stellen suchen, an denen Socken und Schuhe den Kratz-Job übernehmen. Da hilft dann auch keine Selbstbeherrschung mehr. Aber selbst, wenn man nicht kratzt, bekommt man wunderhübsche rote Hubbel auf der Haut, die bei mir ca. 3 Wochen brauchen, bis sie wieder verschwinden und bei Anderen auch nicht schneller verblassen. Wenn ihr also in Neuseeland jemanden seht und denkt, er oder sie hätte eine eklige Hautkrankheit, oder zumindest die Windpocken: vermutlich einfach nur Sandfly-Bites. Mir persönlich wird anhand der Bisse die Relativität von Zeit wieder einmal bewusst: Am ersten Abend in Abel Tasman gesellt sich Lucy zu unserer Runde. Nach einiger Zeit munteren Geplauders eröffnet sie uns, dass sie ersteinmal ein Glas Wein und dann all ihren Mut brauchte, um sich auf uns zuzubewegen. Bisher fiel ihr das immer so schwer. Lustigerweise war unser aller Gedanke: „Wow, die geht mal eben auf eine Gruppe Leute zu, die sich offensichtlich bereits ganz gut kennt! Die hat ja gar keine Kontaktschwierigkeiten.“ Da haben wir es wieder: Irgendwie geht es allen ähnlich und es stört wirklich keinen, wenn man einfach hingeht. Was das mit den netten Sandfliegen zu tun hat? Lucy und die ersten Sandfly-Bites fielen auf den gleichen Tag und wie wir so weiterreisen und in unserer kleinen, sich immer mal neu und wiederformierenden Gruppe unterhalten, kommt es einem irgendwann so vor, als würde man sich schon ewig kennen. Wir teilen in kurzer Zeit so viele Geschichten, erleben so viel, sehen unglaublich schöne Dinge, so als würden Wochen und Monate vergehen. Gleichzeitig verschwinden in diesem Zeitraum nicht einmal die blöden Sandfly-Bisse. Um den Abel Tasman National Park zu erkunden, haben wir nur einen Tag, also entscheide ich mich diesen halb auf einem Segelboot und halb in meinen Wanderschuhen zu verbringen. Aus dem Segeln wird dann leider Motorbootfahren, da der Wind an diesem Tag einfach keine Lust hatte, für Antrieb zu sorgen. Die zweite Tageshälfte ist dann aber umso schöner, ein netter Bush-Spaziergang mit nur wenigen Bergen. Wiedereinmal in einer ganz anderen Landschaft, die ich jetzt der Einfachheit halber mal als extrem ursprünglich wirkendes Grünzeug beschreibe. Wiedereinmal ist einfach alles, was wir sehen so unheimlich schön. Wer auch immer sich dieses Neuseeland ausgedacht hat, hatte wirklich einen Sinn für Ästhetik und für Details.
Und weiter geht die Fahrt. Als wir an den „Pancake Rocks“ vorbei kommen, regnet es leider in Strömen, so dass wir nur kurz aus dem Bus hüpfen, den Wanderweg förmlich entlang rennen, einige Fotos machen und wieder in den Bus springen. Eigentlich schade, denn die Felsen sehen schon irgendwie sehr spannend aus. Wobei ich nicht unbedingt sofort auf Pfannkuchen kommen würde. Unser heutiges Ziel ist Barrytown. Ein Ort, an dem man eigentlich nichts machen kann, außer Jade bzw. Knochen schnitzen, Messer bauen und sich eher weniger gepflegt betrinken und zwar in dem einzigen Pub (das zufällig neben dem Hostel ist und noch viel zufälliger Stray gehört). Um Messer zu machen braucht man einen ganzen Tag, die Zeit haben wir nicht (und wenn man jetzt vom Bus runterspringt, muss man diverse Tage in Barrytown – auch Barry No Town genannt – verbringen und das will nun wirklich keiner). Bleiben Schnitzereinen und Alkohol, leider in genau umgekehrter Reihenfolge. Der Stopp in Barrytown dient dem, was man wohl allgemein als „Teambuilding“ bezeichnen würde, da vollkommen klar ist, dass man sich dabei besser kennenlernt: In dem Pub gibt es einen Raum mit alten Klamotten und wir werden aufgefordert, uns zum Thema „I can’t believe you came to my party like this!“ zu verkleiden. Um die Peinlichkeit der Kostümierungen zu verringern, gibt es diverse Alkoholika zum Sonderpreis. Trotz aller Skepsis diverser Mitreisender (gerne angekündigt mit einem „ich will mich aber nicht verkleiden“) wird es ein erwartungsgemäß lustiger Abend mit extrem vielen munteren Fotos und der Erkenntnis, dass ich tatsächlich den Macarena verlernt habe, naja hatte. Jetzt geht’s wieder. Den angekündigten Kostümwettbewerb gewinnt Jessica, es ging wohl doch um’s Haut zeigen… Meine Stimme hätten allerdings Catherine und Christian gehabt. Catherine, weil sie einfach einen verdammt guten, dicken Mann im Hawaiihemd abgibt und Christian, weil er es tatsächlich geschafft hat, zu tanzen wie eine Frau! Warum ich auf den Bildern so bös gucke? Das war mein Auftrag für den Abend, warum weiß ich nicht mehr, aber bös gucken üben hat mir ja noch nie geschadet. Am nächsten Morgen müssen wir dann leider extrem früh raus. Zumindest die fünf von uns, die sich eine Jade-Kette schnitzen wollen. Egal, wo man in Neuseeland hinkommt, diese Ketten gibt es überall, die Idee, mir selbst eine zu machen gefällt mir aber trotzdem. Und gut ist diese Idee trotz des frühen Aufstehens auch noch. Wiedereinmal muss ich feststellen, was für einen großen Spaß es mir doch macht, etwas mit meinen Händen zu tun. Genauer gesagt bin ich irgendwann so vertieft, dass ich nicht einmal mitbekomme, dass alle anderen draußen sind, während unser „Lehrer“ ihre Ketten aus Zeitmangel fix selbst poliert. Bis er damit fertig ist, habe ich auch meine schön blank bekommen und bin zugegebenermaßen extrem stolz auf das Ergebnis… Außerdem habe ich jetzt auch viel mehr Respekt vor wirklich schönem Jadeschmuck – und finde die billigen Touristendinger mittlerweile noch viel schlimmer…
Neuer Kontinent, neues Glück. Wiedereinmal versuche ich es mit dem Besuch eines Gletschers. Nachdem ich einigen von meinem diesbezüglichen Fluch erzählt habe, muss natürlich jeder ersteinmal erwähnen, dass ich doch bitte zu Hause bleiben soll. Diesen Gefallen tue ich aber keinem und so wirklich scheint es auch niemanden zu stören. Mein heutiger Annäherungsversuch an den Gletscher ist ein Tages-Hike. Erst ein Stück den Berg hinauf und dann über’s Eis. Wiedereinmal befinden wir uns auf einer „Herr der Ringe Kulisse“ und entgegen allem bisher dagewesenen strahlt die Sonne. Liesbeth hat Geburtstag und wäre eigentlich wegen eines überfüllten Busses in Barrytown hängen geblieben. Irgendwie fand sich dann aber doch noch ein Weg (man muss sich seinen Geburtstag auf Reisen wohl verdienen) und so haben wir dort oben gleich noch was zu feiern. Also ich muss schon sagen: So ein Gletscher ist bei Sonnenschein etwas unwahrscheinlich Schönes. Die kleinen Höhlen, die tiefblauen Pfützen, marmorierte „Wände“ aus Eis… mein Wortschatz für das, was ich sehe ist langsam aufgebraucht… ich möchte Worte wie „wunderschön“ und „atemberaubend“ ja auch nicht überstrapazieren, aber ich sehe tatsächlich fast täglich Dinge, die mich einfach überwältigen. So sehr ich mich auch über schöne Häuser freuen kann: an die Natur kommt einfach nichts heran! Wenn ein Gletscher quasi über den Berg kippt, entstehen Ritzen, die wunderschön aussehen und durch die man hindurch gehen kann. Natürlich machen auch wir das. Die Ritze unserer Wahl ist so schmal, dass man nur seitlich durchgehen kann und natürlich passiert genau dort das, was nicht passieren sollte: Die Spikes meines einen Schuhes verhaken sich im anderen Schuh und ich falle um. Ja… an Eis kann man sich nicht wirklich festhalten. Hätte ich drauf kommen können…versucht habe ich es trotzdem… geht nicht. Vor mir Jessica, die relativ schockiert ist, mich langsam umkippen zu sehen, hinter mir Lucy, die diese enge Ritze ohnehin nicht gut findet… Ich denke mir, dass das Gute an Ritzen ist, dass man langsam fällt. Kann man sich wenigstens nicht weh tun. Kurzer Check: Kopf, Arme, Beine… alles heile… mir geht es gut, nix passiert. Offensichtlich ist mir wohl nicht wirklich nach Panik, also reiche ich meine Eisaxt und meinen Rucksack an Lucy weiter und rappel mich wieder auf. Patschenass (wer es noch nicht wusste: Eis schmilzt bei Körperkontakt) geht es dann weiter, wenn auch deutlich vorsichtiger und meine Beine so weit wie möglich auseinander haltend. Später erfahre ich, dass die Letzten, die in so einer Ritze umgefallen sind, wohl mit dem Helikopter herausgeholt wurden… wie gut, dass ich in meinem Höhlenabenteuer gelernt habe, dass Ritzen immer größer sind, als man denkt und ich ganz offensichtlich kleiner… und meinen Fluch bin ich offensichtlich auch los!!!
Sechs Wochen in Neuseeland wollen ja irgendwie verbracht werden und weil es im Lonely Planet irgendwie gut klingt (und ich außerdem mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, dass es hier wirklich egal ist, wohin man sieht, weil es ist immer schön ist), hüpfe ich in Wanaka vom Bus. Erfreulicherweise nicht alleine, sondern in einer kleinen Gruppe, allesamt gewillt einige Tage in diesem beschaulichen Ort verbringen. Städte am See sind ja ohnehin schön. Städte am See mit Bergen im Hintergrund sind noch viel schöner und wenn sie dann auch noch Weinberge um den See herum haben, ist es schon fast nicht mehr auszuhalten vor Schönheit. Wanaka ist zwar touristisch, aber sehr unaufgeregt. So verbringen wir die Zeit mit einem Weintasting, gemütlichen Kochabenden, Shopping (ich muss feststellen, dass ich alt bin: alles, was modern ist, gab es in meiner Teenager-Zeit schonmal…), der Puzzleworld (einem Museum mit lauter optischen Täuschungen) und nicht zuletzt mit einem Besuch in dem wohl schönsten Kino, das ich je gesehen habe. Es ist klein, gemütlich, mit alten Sofas und einem aussortierten Auto. Der Raum wird bei jedem Öffnen der Türe mit dem Duft frisch gebackener Cookies durchzogen und es gibt selbstgemachtes Eis. Wir sehen Harry Potter und in der Pause komme ich dann gar nicht drumherum, „Bertie Botts every flavour ice-cream“ zu probieren. Selten hat mir ein simples Speiseeis so viel Spaß bereitet (außer vielleicht der Versuch von Helen und mir, uns in Wellington gegenseitig beim Eisessen zu fotografieren und dabei nicht seltsam auszusehen). Inmitten der kalten Creme finde ich – wie der Name erhoffen lässt – so ziemlich alles. Schokolade, Caramel, Rosinen, Gummitierchen, Jelly Beans, Marshmallows… ein absolutes Highlight in meinen bisherigen kulinarischen Erfahrungen. Auch wenn der Aktivitätsgrad verhältnismäßig gering ist (abgesehen von Catherine, die sich für einen Fallschirmsprung entschieden hat), sind wir uns einig: Wanaka ist definitiv der richtige Ort, um vom Bus herunterzuspringen.
„Adventure Capital of the World“… soso… bin ja mal gespannt… dass sich ein Ort mit 13.000 Einwohnern überhaupt „City“ nennen darf, finde ich persönlich ja schon gewagt, aber dann sogar noch Hauptstadt für irgendwas… diese Kiwis gehen offensichtlich etwas inflationär mit ihren Stadtrechten um. Rein optisch ist Queenstown wie Wanaka, bloß etwas größer: Schöner See, nette Berge etc., der Unterschied ist aber, dass die Einwohnerzahl durch die einfallenden Backpacker mindestens verdoppelt wird. Zumindest gefühlt. Es ist einer dieser Orte, an denen man erstaunt ist, Einheimische zu treffen. Hier kann man alles machen, was den Adrenalin- oder wahlweise den Alkoholspiegel erhöht. Das kommerzielle Bungeejumping hat hier (bzw. in der Nähe) seinen Ursprung und auch sonst sind die Kiwis in Sachen Touri-Bespaßung an diesem Ort äußerst kreativ. Man kann Fallschirmspringen oder sich über eine Schlucht schwingen, es gibt Canyoning, Paragliding und wasweißichnichtnochalles. Aber diese ganzen Extrem-Geschichten sind nicht so wirklich meins. Stattdessen gehen wir feiern, was in Queenstown auch ziemlich gut geht. Diese Party-Nacht hat allerdings zwei längerfristige Auswirkungen: 1. bekomme ich seit dem Country-Karaoke einen Jonny Cash Song einfach nicht mehr aus dem Ohr und 2. verliere ich in dieser Nacht mein Lieblingskleid. Diesen Satz wollte ich unbedingt schreiben… die Geschichte birgt allerdings weit weniger Unterhaltungspotential, als vermuten lässt, denn ich habe meine Klamotten einfach im Bad vergessen und auf wundersame Weise waren sie morgens verschwunden und keiner hat sie gefunden… Danke dafür. Eine weitere Lektion im Umgang mit dem Verlust materieller Dinge… muss ich ja auch mal lernen… Wiedereinmal lässt mich meine neuentdeckte Wanderfreude nicht los und ich mache mit Liesbeth, Lucy und Garry einen kleinen Spaziergang auf den Queenstown Hill. Langsam frage ich mich, ob die Welt von oben betrachtet einfach immer schön ist, oder ob die ganzen Seen und Hügel und Wiesen und Flüsse, die ich in den letzten Monaten aus der Vogelperspektive gesehen habe Schuld daran sind, dass ich mich ständig so freuen muss. Ich erspare euch nähere Beschreibungen, schaut einfach auf die Fotos. Sehr praktisch auch, dass auf dem Berg ein großer Metallkorb ist, in denen sich sämtliche Hühner platzieren und Fotos machen können. Da wundert sich wenigstens keiner mehr über das Gegacker… Wenn man sich schon in einer Stadt befindet, in der der Spaß im Vordergrund steht, sollte man auch etwas Gutes tun und so schließen wir uns einem Pub-Crawl zu Gunsten der Movember-Bewegung an. Im Monat November lassen sich diverse Herren weltweit einen Schnurrbart stehen, um damit auf die Männergesundheit aufmerksam zu machen. Ich bin sehr froh, diese Info bekommen zu haben, denn kurze Zeit hatte ich befürchtet, dass mit den Leggins auch die Oberlippenbärte wieder modern geworden sind. Und das will nun wirklich keiner… Was ich auch nie wollte, ist eine von diesen lächerlichen Personen zu sein, die sich die Augen verbinden und in einer Art Polonäse durch die Stadt (sprich: von Bar zu Bar) geführt werden. Es ist trotzdem passiert, aber wenigstens trage ich einen Schnurrbart. Trotz aller Kritiken finde ich, dass er mir äußerst gut steht. Ich kann es tragen… zumindest hin und wieder… muss ja kein Dauerzustand werden, ist nämlich nicht so wirklich angenehm und wird irgendwie warm… so richtig Stimmung will an dem Abend ohnehin nicht aufkommen… naja, Hauptsache etwas für den guten Zweck getan. Für meinen relativ langen Aufenthalt in Queenstown gibt es eigentlich nur einen Grund: den Routeburn Track. Nachdem ich in den Rockies meinen Spaß am durch die Gegend Laufen gefunden hatte, setzte sich langsam der Gedanke fest, hier in Neuseeland einen der „Great Walks“ zu machen. Als Liesbeth mir dann erzählte, dass sie den Routeburn Track wandern will und sie noch nach jemandem sucht, der mitkommt, war mir relativ schnell klar, dass dies eine Herausforderung ist, die ich angehen sollte…
Ja, ich habe es getan. Ich bin aus einem voll funktionstüchtigen Flugzeug gesprungen. Warum? Der Kontrollfreak in mir sagt „Dann weißt du wenigstens, wie es ist… für den Notfall!“ Der Rest in mir sagt: „Warum eigentlich nicht?“ Am ersten Tag im Stray-Bus erzählte uns Curry, dass die beiden Dinge, die man in Neuseeland unbedingt machen muss „von einer Brücke hüpfen“ und „aus einem Flugzeug springen“ sind. Und ich denke mir noch: „Klar… ganz genau… und ich werde ganz gewisslich keins von beidem tun!“ Wenige Wochen später, kurz vor Wanaka hatte ich meine Meinung dann doch schon zu einem „Vielleicht sollte ich das mit dem Flugzeug in Betracht ziehen!“ geändert. Irgendwie scheint es hier so normal zu sein und all die Videos (ach nee… das heißt ja heute DVDs), Fotos und glücklichen Gesichter, die ich so gesehen habe, ließen dann doch eine gewisse Neugier erwachen. Besonders, weil es mir bei Filmen etc. vom Bungee-Jumping gar nicht so geht. Falls das irgendwie Sinn macht. Irgendwann stand dann für mich fest: „Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie in meinem Leben!“ Und der Gedanke gefiel mir plötzlich ganz und gar nicht. Wäre ja auch irgendwie doof. Und so wird es meine letzte Aktivität in diesem schönen Land, das mich so wunderbar entertaint hat. Über der „Bay of Islands“ soll es außerdem verdammt schön sein. Heute Morgen stand dann leider nicht ganz fest, ob wir überhaupt springen können, wegen des Wetters. Aber die Aussichten waren doch irgendwie ok, also ab in den Shuttle-Bus, zusammen mit einer anderen Deutschen (Lisa), einer Amerikanerin, einem Engländer und einem Schweizer). Es dauert keine zwei Minuten und schon bin ich in eine ausgiebige Kabbelei mit dem Fahrer (Carl) verwickelt. Er ist Engländer und ich bin vor lauter Nervosität „auf Krawall gebürstet“ und außerdem heute irgendwie ziemlich schlagfertig. Klar, dass ich nachher ausgerechnet mit ihm springe… Am Flugplatz angekommen unterschreibe ich wiedereinmal einen Zettel auf dem steht, dass ich niemanden für meinen Tot verantwortlich machen kann. Da mir dies heute sogar ziemlich einleuchtend erscheint, bekomme ich ein flaues Gefühl im Magen und versuche mich dadurch zu beruhigen, dass die Jungs, die mit uns springen ja auch ein Interesse am Überleben haben. Wobei die wirklich abgebrüht sind. Zuerst startet die Maschine mit den Beiden, die von 12.000 Fuß springen. Als sie gelandet sind, legen die beiden Jungs die Fallschirme ab, greifen die nächsten und schon sind wir dran und nach uns gehen sie gleich wieder in die Luft. Auch heute gibt es wieder extrem sexy Oberbekleidung und ein Geschirr, dass mir schon von meinem Höhlenabenteuer bekannt vorkommt, heute aber so fest geschnallt wird, dass ich kurz Angst habe, meine Beine wegen mangelnder Durchblutung zu verlieren. Dazu gibt’s einen schicken Hut und eine nicht weniger muntere Brille. Nachdem Carl also das erste mal mit einem anderen Engländer gesprungen ist, der mit ca. 110 kg eigentlich das Maximalgewicht überschreitet, lässt er mich (immer noch außer Atem) wissen, dass er ziemlich geschafft ist und gibt mir den Auftrag: „Don’t kill me!“ Hatte ich nicht vor, denn das geht vermutlich auch für mich nicht gut aus… (wobei ich kurz vorher noch gelernt habe, dass die Fallschirme eine Art Zeitschaltuhr haben, sollte dem Springer was passieren) Für’s Archiv: „Nicht mit Menschen kabbeln, die zu irgendeinem Zeitpunkt für’s Überleben wichtig sein könnten. Dann bekommt man nämlich keine beruhigenden Worte, sondern nur weitere Sprüche, auf die man kontern muss. Und mir geht gerade der Allerwärteste auf Grundeis… Also los in das kleine Flugzeug, in dem es mit 7 Personen (Pilot, zwei Kameraleute, zwei Springer und wir zwei deutschen Mädels) extrem kuschelig ist. Schon alleine der Flug ist schön, auch wenn wir wegen der Wolken nicht die ganze Zeit etwas sehen. Als wir bei ca. 8.000 Fuß sind, gibt’s noch ein kurzes Interview und dann irgendwann eine Ladung Sauerstoff für alle. Naja fast. Unsere Kameraleute bekommen keinen und das erklärt so einiges…. dann werde ich an Carl festgeschnallt und jetzt habe ich definitiv kein Blut mehr in den Beinen. Eine interessante Form der Nähe. Meine Nervosität ist mittlerweile weg, wie schön, dass ich mich darauf verlassen kann, dass frühzeitiges Aufgeregtsein eigentlich immer dazu führt, dass ich mich gut fühle, wenn’s los geht… Dann geht alles auch irgendwie schnell. Wir sind bei 16.000 Fuß angekommen. Kurze Zeichen zwischen allen Beteiligten, ich bekomme noch einmal gesagt, was ich tun soll und schon geht die Türe auf, mein Kameramann hängt sich raus, wir sitzen in der offenen Türe, Kopf zurück, noch einmal durchatmen und schon fallen wir… Wow… einfach unglaublich… und erstaunlicherweise kein Stück beängstigend. Ich hatte mich extra für die höhere Variante entschieden, um etwas Zeit zu haben, mich nach dem ersten Schock zu sammeln und den Fall dann zu genießen, aber ich habe tatsächlich die gesamten ca. 60 Sekunden, in denen ich den freien Fall bei ca. 200 km/h genießen kann. Der absolute Wahnsinn. Erstaunlicherweise fühlt es sich nicht so schnell an, wie 200 km/h mit dem Auto. Die Sache mit den guten alten Referenzpunkten halt. Wenn man so in die Tiefe rast kann man gar nicht anders, als lachen. Zum einen, weil es so ein wahnsinnig tolles Gefühl ist und zum anderen, weil man vor lauter Luft im Gesicht den Mund ohnehin nicht zubekommt. Meine Kontaktlinsen weht es irgendwann heraus und sie hängen in meiner schicken Brille. Zum Glück sehe ich trotzdem noch genug, um die Aussicht zu genießen, bzw. bin soweit oben, dass meine Kurzsichtigkeit keine Rolle mehr spielt. Dann gibt es plötzlich einen leichten Ruck (auf den Fotos sehe ich, dass es mich in einen 90 Grad-Winkel ruckelt), der Fallschirm geht auf und unsere Geschwindigkeit verlangsamt sich merklich. Das gesamte Empfinden wird plötzlich anders, um mich herum ist alles so leise. Ähnlich, wie wenn man frühmorgens durch frisch gefallenen Schnee läuft. Munter hänge ich in meinem Geschirr herum und freue mich, wie schön die Welt aus dieser Perspektive ist. Selten hatte ich so viel Beinfreiheit, um selbige baumeln zu lassen und plötzlich scheint die Zeit viel langsamer zu vergehen… gemütlich kreisend bewegen wir uns wieder der Erde zu, die Stück für Stück immer größer wird… zur Landung dann die Beine in die Luft und viel sanfter als erwartet kommen wir auf. Was mich wirklich erstaunt: Ich verspüre keinerlei Erleichterung, als ich wieder auf festem Boden stehe. Warum? Weil es einfach nicht notwendig ist. Zwar sehe ich mich eigentlich nicht gerne auf Videos, aber im freien Fall mache ich mich doch ganz gut, finde ich. Das Video gibt’s hier: EMBRACE THE FEAR
Frohe Weihnachten aus dem sonnigen Sydney!
In Neuseeland gibt es die neun sogenannten „Great Walks“: Mehrtägige Wanderungen durch die National Parks. Einer von ihnen ist der Routeburn Track, ein Weg für drei Tage, der durch zwei Parks verläuft (Mt. Aspiring und Fjordland). Die Grenze ist auf dem Harris Saddle, also (wie sollte es auch anders sein) oben auf dem Berg. Da Liesbeth die Idee hatte noch einen Seitenweg zu gehen, hatte sie von vier Hütten die Erste und die Vorletzte gebucht. Da ich wiederum quasi auf die Planung aufgesprungen bin, habe ich das Gleiche getan und so hatten wir eine etwas seltsame Wegeinteilung… Allgemein eigentlich ziemlich gut vorbereitet ziehen wir los. Ein Shuttle bringt uns von Queenstown zum Routeburn Shelter. Ich bin hundemüde und Liesbeth ist hundeelend, vermutlich vom Busfahren, oder vom Busfahrer, der ist nämlich eine ziemliche Plage. Kein wirklich guter Start in die Wanderung, die nicht unwesentliche körperliche Anstrengung verspricht… aber kaum laufen wir los, ist das alles so gut wie vergessen und wir wandern gemütlich durch den Wald, über diverse Hängebrücken, immer in Richtung unseres Tagesziels, das wir bereits nach noch nicht einmal zwei Stunden erreichen. Hier wird uns erst so richtig bewusst, dass wir morgen den gesamten Aufstieg vor uns haben… vielleicht ist es doch keine so gute Idee, heute noch eine weitere Schleife zu gehen, die ca. 5-6 Stunden dauern wird… Die Entscheidung für einen faulen Tag ist daher schnell getroffen… eine erstaunliche Wendung, hatten wir doch gedacht, uns drei Tage lang auszupowern… Die Faulheit schlägt schnell in Albernheit um und wir befinden uns irgendwann in einem Wettbewerb zum längsten Handstand, der schönsten Brücke und dem besten Luftsprung. Die ersten beiden Disziplinen gehen an mich, die Letzte an Liesbeth. Irgendwann stellen wir fest, dass uns der Hüttenwächter beobachtet… Kommt wohl nicht so oft vor, dass hier jemand albern ist. Er lässt sich aber davon überzeugen, es auch einmal zu versuchen… nicht gut… aber verdammt lustig. Zumindest für uns. Später kommt er nochmal zu uns und stellt uns die (in einer Hütte irgendwo im Wald wirklich seltsame Frage) was wir denn zum Abendessen vorhaben. Er hat Besuch von einem Kumpel, außer uns und zwei Arbeitern ist nur noch ein weiterer Wanderer in der Hütte und so lädt er ihn und uns zum Curry-Essen ein. Soetwas passiert einem wohl in dieser Abgeschiedenheit auch nur selten. Das einzig Ärgerliche ist, dass wir unser Essen noch zwei weitere Tage mit uns herumtragen müssen. Während er kocht, spielen wir Karten, Liesbeth gewinnt, es steht 2:2. Beim Essen erzählen wir den Jungs (Hobbitrate: 2:1) von unserem Wettbewerb und sie fordern eine Entscheidung. Der beste Nationale Song mit Performance findet in keiner unserer Ausführungen Anklang, versteh ich gar nicht… Nach langem Hin und Her entscheidet am Ende Armdrücken. Rechts, Links, Rechts. Meine Linke Hand ist zwar motorisch unfähig, dafür aber stark, daher geht dieser Punkt an mich. Die anderen beiden leider nicht, so dass ich den Gesamtwettbewerb verliere. Grrrrr… Der Tag der Albernheiten findet in der lustigen Hobbit-Runde definitiv ein würdiges Ende und lehrreich ist es auch: Streng genommen darf man in National-Parks keine Sandflies töten (und von denen gibt es hier noch mehr, als im Abel Tasman!): es sind Nationale Tiere, daher könnte man eine Strafe von bis zu 10.000 $ bekommen… und wo wir gerade bei der Tierwelt sind: Possums, eigentlich niedliche Tiere, sind in Neuseeland offensichtlich der Staatsfeind Nr. 1. Und das nicht nur, weil sie von den Australiern hierher gebracht wurden. Da die Tiere gerne Vogeleier fressen, sind sie zum großen Teil Schuld daran, dass die Kiwis so selten geworden sind und nur noch auf feindfreien Nebeninseln leben. Und was machen die Neuseeländer (außer sich über jedes überfahrene Possum am Straßenrand (Roadpizza) freuen)? Sie stellen aus Possumfell nicht nur Bauchnabelwärmer (ja… hab ich gesehen…) her, sondern auch kleine Kiwis, die in Touri-Shops verkauft werden. Da sieht man es wieder, die Natur ist immer irgendwie ein Kreislauf… Aber zurück zu unserer Wanderung: Am nächsten Morgen ziehen wir früh los, schließlich haben wir einiges vor und kaum sind wir unterwegs, geht es auch schon bergauf. Die Sonne scheint, was zwar einerseits wunderschön ist, andererseits aber auch zu mehr Schweiß und Extrembenutzung von Sonnencreme führt. So ganz allgemein macht die Hitze die Wanderung nicht gerade einfacher. Die Sonne brennt auf der Haut und – auch wenn ich noch kein Ozonloch gesehen habe – sie ist in Neuseeland wirklich nicht ohne. Warum genau setzen wir uns freiwillig diesen Strapazen aus? Wann auch immer mir diese Frage in den Kopf schießt, brauche ich nur zur Seite zur schauen und ich weiß wieder, warum: Nein, ich mache mir an dieser Stelle gar nicht erst die Mühe, euch zu beschreiben, wie wundervoll die Aussicht ist, denn jeder Blick übertrifft alles bisher dagewesene… So wirklich angenehm ist der Aufstieg natürlich nicht und als wir eine Weile wegen Steinschlag-Gefahr nicht einmal anhalten können, um etwas zu trinken, bin ich nicht gerade begeistert… überraschenderweise ist es aber doch nicht so schlimm, wie erwartet. Vielleicht liegt dies aber auch an der vielen Ablenkun. Die Landschaft um uns herum verändert sich ständig und sobald wir auch nur kurz denken „langsam wird die Aussicht aber langweilig“, gibt es schon wieder etwas Neues. Eben noch sehen wir Wolken im Tal, dann entdecken wir einen See, die Felsen sehen plötzlich auch ganz anders aus und habe ich solche Blumen schonmal gesehen? Gerade als wir anfangen müde zu werden, entdecken wir im Tal einen unglaublich schönen See (Lake McKanzie) mit einer Hütte. Hier werden wir die nächste Nacht verbringen… Ihr glaubt gar nicht, wie gut es manchmal tut, sein Ziel vor Augen zu haben. Auch wenn es noch eine ganze Weile dauert, bis wir im Tal ankommen. An der Hütte werden wir natürlich von diversen Sandfliegen begrüßt. Elendige Mistviecher. Aber der See ist so schön… aber bitterkalt. Da ich zu allem Überfluss neben meinem Rucksack auch noch eine Erkältung mit mir herumschleppe, lasse ich mich lieber nicht zum Schwimmen hinreißen… im Gegensatz zu einer Gruppe älterer Kiwis, die sich für eine kurze Erfrischung ins Wasser wagt und auch Liesbeth dazu inspiriert ein Foto im See zu machen. Den Abend verbringen wir kartenspielend mit den anderen Leuten in der Hütte und warten ungeduldig, bis es endlich zehn Uhr ist und wir uns nicht mehr komisch vorkommen müssen, wenn wir schlafen gehen… wann ändert sich das eigentlich, dass man nicht mehr quängelt, länger aufbleiben zu wollen? Ich schätze, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, ab dem man plötzlich den unteren Teil von Stockbetten bevorzugt… Früh morgens sieht der ohnehin schon wunderbare See noch viel toller aus. So ganz ohne Bewegung spiegelt er die Berge, die Steine und überhaupt… wow…. dass die Natur hier so weit und unberührt ist, alles scheint frisch und klar und ach… es gibt einfach keine Worte. Unsere dritte Etappe ist nicht ganz so „easy“ wie vermutet. Viel zu oft müssen wir wieder bergauf laufen, obwohl wir das doch gar nicht mehr wollten. Nach Aufwärmen am ersten Tag und den gestrigen Klettereien ist das Thema des Tages „Balance“. Immer wieder wird unser Weg von Flüssen durchkreuzt, die wir von Stein zu Stein hüpfend überqueren. Zum Glück laufen wir größtenteils durch den Bush, so dass uns die Sonne nur teilweise zu Schaffen macht. Unglaublich, wie viele verschiedene Sorten Moos es hier gibt. Und überhaupt, die Pflanzenwelt ist der Wahnsinn. So viele verschiedene Farne, gerne auch in Palmenform (so viel zum Thema Paradies), Bäume und anderes Gestrüpp, das ungehindert quer durcheinander wächst. Mittlerweile kann ich verstehen, dass ich in Alaska gefragt worden bin, ob wir Deutschen eigentlich unsere Wälder putzen… Als wir schließlich am Ziel ankommen, sind wir zwar müde, aber nicht vollkommen erschöpft. Vor allem aber sind wir stolz, es geschafft zu haben und freuen uns auf eine schöne große Pizza. Oder doch nochmal zu Fergburger, dem besten Burger-Lokal des Landes (vielleicht sogar der Welt)? Der Routeburn Track ist definitiv das Highlight meines Neuseelandaufenthaltes und steht ganz weit oben im Gesamt-Ranking meiner bisherigen Reise. Ich muss doch immer wieder feststellen, dass mir Wandern einfach gut tut, ich dabei irrsinnig glücklich bin, die Belohnung für jegliche Anstrengung einfach enorm ist und diese angenehme Müdigkeit, wie wenn man als Kind den ganzen Tag draußen gespielt hat, die hat einfach was.
Wie war das noch gleich mit den hohen Erwartungen? Milford Sound kann offensichtlich mit dem ganzen Druck nicht umgehen, der auf ihm lastet. Jeder der dort war erzähl von seiner Schönheit, wie einzigartig, atemberaubend etc. es dort ist und aus Angst, uns zu enttäuschen, entscheidet sich das Fjordland für schlechte Sicht und Regen. Und zwar unaufhörlich, nicht gerade wenig und ordentlich Wind gibt’s gleich mit dazu. Praktischerweise befinden wir uns auf einem Boot. Sagen wir’s mal so: die Aussicht gewinnt nicht, aber wir hatten einen lustigen Tag, da der Frust über das Wetter irgendwann in Albernheit umgeschlagen ist und die ist bekanntermaßen um einiges erträglicher. Ärgerlich ist es trotzdem, wenn man für eine Bootsfahrt so viel bezahlt, natürlich mehr, als selbst ein Heißgetränkeliebhaber wie ich an kostenlosem Kaffee und Tee zu sich nehmen kann. Immerhin hat der Milford Sound auf den Bildern eine ganz besondere Stimmung. Irgendwie düster, schummrig… fast bedrohlich. Hat ja auch was… ach ja, fast hätte ich es vergessen: der Bootstrip beschert mir (abgesehen vom Gletscher) mein winterlichstes Erlebnis: Ich kann einen Pinguin beobachten, der versucht, sich an einem extrem steinigen Ufer fortzubewegen. Natur, du willst doch, dass ich über dich lache, sonst hättest du diese possierlichen Tierchen bestimmt nicht erfunden. Aber wenn ich mal in einem langen, engen Rock mit den Händen in der Tasche (oder sonstwie unpraktisch platziert) über Steine hüpfe und mich dabei auf die Nase lege, dann dürfen die Pinguine (und alle anderen Kreaturen) gerne auch über mich lachen. Die Hütten sind heruntergekommen, aber nicht charmant. Die Betten sind alt, aber nicht antik. Die Küche und der Aufenthaltsraum sind zwar frisch renoviert, haben aber die Atmosphäre eines Krankenhausen und die Sandflies… ja die sind genauso nervig wie erwartet. Zu allem Überfluss regnet es nach wie vor… die ohnehin nicht gerade auf dem Höhepunkt befindliche Stimmung fällt rapide ab. Was bitteschön ist das den für ein Ort, an den uns Stray hier gebracht hat? Und wie bitte: um 22.00 Uhr geht der Strom aus? Obwohl sie vermutlich das Geschäft ihres Lebens machen könnten, vertreiben die Besitzer des kleinen Ladens keinen Alkohol, mit dem man sich das löchrigen Tapeten-Mosaik oder die schäbigen Teppichböden hätte schön trinken können. Da bleibt uns nur noch ein: wir kaufen einen Wochenvorrat Süßigkeiten und Knabbereien, der die nächsten zwei Stunden nicht überstehen wird, setzen uns in unser Zimmer und machen uns einen gemütlichen Mädelsabend. Wie gut, dass ich die Konversationskarten für Dinnerparties aller Art kürzlich gekauft habe. Sonst hätten wir uns über die vielen ausgefeilten Fragen sicherlich nie Gedanken gemacht.
Es gibt Orte, da fragt man sich, warum man sie besucht. Meine einzige Ausrede, warum ich in Invercargill lande ist, dass ich nunmal mit einem Reisebus unterwegs bin und dem Busfahrer einfach mal glaube, dass es keinen Sinn macht, für nur einen Nachmittag/Abend mit der Fähre nach Steward Island zu fahren. Mehr Zeit habe ich leider nicht, also kein Kiwi-Gucken für die Anna (Erfolgsaussichten sind eh schlecht), aber dafür Invercargill. Dass es in diesem Ort überhaupt Gehwege gibt, erstaunt mich, denn sie sind eigentlich den ganzen Tag hochgeklappt… was also tun? Der gute alte Lonely Planet verrät uns, dass man in der lokalen Brauerei ein kostenloses Tasting machen kann. Kostenlos und Bier in einem Satz sind natürlich gleich drei Argumente auf einmal und so genießen wir verschiedene Biere aus Schnapsgläsern, die teilweise mit Dingen wie Honig oder Boysenbeere angereichert sind. Da lob ich mir doch das Reinheitsgebot… aber interessant ist es in jedem Fall, selten hat man ja die Gelegenheit und Fähigkeit sich bei vielen verschiedenen Bieren auf den Geschmack zu konzentrieren… Ewig dauert so ein Tasting natürlich nicht und so stellt sich schon nach kurzer Zeit wieder die Frage nach der nächsten Beschäftigung. Unsere Wahl fällt auf Kino. „Due Date“ ein lustiger Film, aber als wir um 20.00 Uhr aus dem Kino kommen (Spätere Vorstellungen gibt es nicht. Für keinen Film.), ist der Tag noch immer nicht vorbei… das ist vielleicht ein seltsames Gefühl… alle Einkäufe sind gemacht, gegessen haben wir auch schon, die DVD’s bzw. Videos sprechen keinen von uns an und so folgt ein Abend, an dem wir uns mit Kartenspielen die Zeit vertreiben. Irgendwie seltsam, aber doch sehr unterhaltsam. Wie gut, dass ich so viele nette Leute um mich herum habe.
Was ist denn plötzlich mit unserer Reise los? Wir scheinen nur noch im Bus zu sitzen, der Sonnenschein hat uns verlassen und von den vielen schönen Aussichten, die die Landschaft für uns bereit hält, können wir leider aufgrund der Witterung nur noch einen kleinen Teil sehen. Und auch das Timing unserer Aufenthalte an den verschiedenen Orten ist irgendwie nicht mehr stimmig. Was bitteschön bringt es uns, wenn wir zwar die Stadt besuchen, in der „Cadbury’s“ seinen Sitz hat, wir dann aber so spät ankommen, dass keine Führungen mehr möglich sind? Da hatte ich mich schon irgendwie ziemlich drauf gefreut, auch wenn die Schoki hier nicht ganz so gut schmeckt (und zum Glück auch weniger süchtig macht), als in England (dafür ist sie immer noch um Längen besser, als in Nordamerika!!!). In Dunedin befindet sich die angeblich steilste bewohnte Straße der Welt. Aufmerksame Leser meiner seitenlangen Landschaftsbeschreibungen wissen, dass ich in Chicoutimi bereits versucht habe herauszufinden, ob dies wahr ist. Nein, ich weiß es immernoch nicht, denn als ich den Bus verlassen möchte, um mir die Straße genauer anzusehen und ein Bild zu machen, gibt meine Kamera den Geist auf und beschäftigt mich daraufhin für die nächsten 10 Minuten. Später stellt sich heraus, dass mich nur die Batterieanzeige veräppelt hat, aber das kann ich ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Das Rätsel mit der steilsten Straße bleibt also ungelöst. Im Großen und Ganzen ist das auch schon alles, was ich von Dunedin sehe. Es ist Domino’s Day und weil die kleine Küche im Hostel überfüllt ist, machen Nikolien, Liesbeth und ich uns auf zu der Pizza-Kette. Sitzen kann man dort nicht, der Rückweg zum Hostel ist zu lang, als dass wir noch mit warmer Pizza hätten rechnen können und ach ja, es regnet. Also setzen wir uns unter die Überdachung des örtlichen Rugby-Clubs und beobachten ein paar Leute, wie sich sich um den Ball kabbeln. Unsere Aufmerksamkeit wird dann jedoch auf die Seemöwen gelenkt, die uns dabei beobachten, wie wir unsere Pizza essen. Irgendwie sind mir diese Tiere ja unheimlich… zumindest, wenn ich etwas zu Essen bei mir habe. Spatzen, die sich einfach mal auf den Muffin in meiner Hand stützen, kenne ich ja schon aus Berlin, aber so eine Möwe möchte ich wirklich nicht auf meiner Pizza sitzen haben… und hier gibt’s auch noch die fiesen rotäugigen… Ich rede über Möwen, die sich gierig um mein Essen streiten… ihr seht schon, Dunedin war einfach nicht gerade der Hit. Vielleicht lag es daran, dass wir nicht besonders viel Zeit hatten, vielleicht daran, dass Studentenstädte in den Ferien relativ ausgestorben sind… keine Ahnung.
Wie heißt es doch so schön: auf Regen folgt Sonne… und die setzt am nächsten Tag die Landschaft glatt wieder in ein so atemberaubendes Licht, dass die etwas trüberen Tage (und da habe ich auf extrem hohem Niveau gejammert) sofort vergessen sind. Mt Cook ist der höchste Berg Neuseelands und am Lake Taupo haben wir ihn schon einmal aus der Ferne betrachten dürfen. Schon sehr beeindruckend… Was wir von dort noch nicht sehen konnten: Der Berg hat ein Gesicht. Gerade wollte ich euch dazu auffordern, mal genau auf das Foto zu schauen, aber da ist es leider nicht zu erkennen. Ist aber ja eigentlich auch egal, denn dass ich mich gerne mal von Bergen beobachtet fühle, habe ich ja bereits gestanden… aber keine Angst, er guckt nicht böse. Nur einladend. Und was beschließe ich, gemeinsam mit einer relativ großen Gruppe meiner Mitreisenden, zu tun? Richtig. Wandern. Da gibt es einen Weg zu einem See am Fuße des Tasman Glaciers (praktischerweise gehört der längste Gletscher zum größten Berg). Mit Eisbergen. Also der See, nicht der Weg. Dauert nur ca. vier Stunden hin und zurück… ein Spaziergang… das schaffen wir noch vor dem Abendessen. Wie verschoben mein Verständnis von Entfernungen doch mittlerweile ist… und damit bin ich nicht alleine. Sonst klang ein einstündiger Fußweg doch schon lange… Vielleicht sollten Eltern ihre Kinder beim ersten gemeinsamen Spaziergang gleich einen ganzen Tag lang durch die Gegend schleifen, so dass ihnen die kurzen Runden am Sonntag nicht mehr wie eine Ewigkeit vorkommen… ja… ich bin einfach ein Fachmann in Sachen Erziehung. Das seltsame am Reisen ist, dass man unheimlich abstumpft, was die Begeisterung über Dinge, die man sieht und tut betrifft. Besonders deutlich ist es ja schon länger bei den Wasserfällen, die ja bereits in Hawaii an Spannung verloren haben. Neuseeland ist voll von Wasser, dass irgendwo einen Berg herunterfällt und so schön ich es auch nach wie vor finde, zumindest bei Regen denke ich zweimal darüber nach, ob ich für einen Wasserfall wirklich den trockenen Bus verlassen möchte (natürlich tue ich es trotzdem jedes Mal und freue mich am Ende). Eine gewisse Abgeklärtheit hat sich bei mir auch gegenüber Gletschern und Eisbergen eingestellt und so ist mein erster Gedanke beim Betrachten des Eisbergs am Tasman Glacier: „Och, nur einer… der ist ja winzig… selbst, wenn es nur die Spitze des Eisbergs ist… also da hatten Alaska und die Rockies aber mehr zu bieten!“ Noch bevor ich den Satz zuende gedacht habe, muss ich über mich selbst den Kopf schütteln. Mal ganz objektiv betrachtet, stehe ich nämlich gerade an einem wunderschönen Ort, mitten in der Natur am Fuße eines gigantischen Berges (der mich etwas von oben herab ansieht, aber gut), die Sonne scheint und wenn ich mal genau in mich gehe und mein reizüberflutetes Hirn nach vergleichbaren Bildern befrage, ist es doch einer der schönsten Anblicke, die ich in den letzten Monaten hatte. Außerdem freue ich mich über die Farbe des Wassers, die ich hier mal als Zementgrau beschreiben möchte und die ich in dieser Form noch nicht gesehen habe… wobei… so toll ist es jetzt auch nicht, wenn ich an das strahlende Blau von Lake Tekapo denke, den wir heute Mittag gesehen haben… Vielleicht brauche ich einfach einmal ein paar Tage ohne neue Eindrücke…
Irgendwie ist die Spannung aus meiner Reise gerade ein Wenig heraus. Zumindest, was Neuseeland betrifft. Die vergangenen Wochen waren extrem aufregend und es ist fast unbegreiflich, wie viel ich gesehen und erlebt habe. Da mir nicht danach ist, mich allzu lange in den größeren Städten aufzuhalten, lege ich meinen letzten längeren Stopp in Kaikoura ein, um einfach einmal nichts zu tun. Die erste Nacht verbringe ich in einem Hostel mitten in der Stadt, in dem uns der Stray-Bus abgesetzt hat. Relativ schnell ist mir klar, dass dieser Ort nicht als Entspannungs-Oase taugt und ich daher keine weiteren Nächte hier verbringen möchte. Dass alles sehr alt ist.. ok. Dass es etwas müffelig riecht… meinetwegen. Dass in dem Zimmer bereits drei Betten zu viel wären und fünf drin stehen… kann ich vielleicht noch mit leben. Dass ich nachts wach werde, weil im kaum entfernt stehenden Nachbarbett eine alte Asiatin schnarcht, stört mich da schon mehr und dass ich morgens feststelle, dass ich mir in meinem Bett eine nette Kuhle gelegen habe, aus der ich mich ohne größere Kraftanstrengung nicht mehr befreien kann, ist dann doch eindeutig gegen mein Wohlbefinden. Zum Glück habe ich einen Tipp für ein schönes Hostel und dieser ist klasse (Danke an die Dutch-Connection). Hier gibt es nicht nur schöne Aufenthaltsräume und eine Terrasse, sondern auch eine Sauna, einen Wirlpool und – was mich ganz besonders freut – einen ziemlich großen Swimming-Pool. Bisher habe ich noch in keinem Hostel gelebt, dessen Pool groß genug war, um darin ernsthaft schwimmen zu gehen. Und damit ist auch bereits meine einzige Tagesaktivität beschrieben. Neben Lesen, meinen Blog etwas aufholen (das mit der Aktualität schaffe ich irgendwie nicht…), mit anderen Reisenden Sprechen und Schwimmen tue ich nämlich gar nichts. Naja, ausgiebig schlafen… aber sonst… nicht einmal zu dem wohl sehr netten Walk entlang der Küste kann ich mich aufraffen… wo kommt denn diese Müdigkeit auf einmal her? Eigentlich kommt man hierher, um sich Wale anzusehen oder mit Delphinen zu schwimmen… für beides kann ich mich allerdings nicht besonders erwärmen. Wale habe ich ja mittlerweile bereits einige gesehen und fand es so nebenbei von der Fähre aus ohnehin spannender, als bei der organisierten Wale-Watching-Tour und warum ich mit Flipper und seinen Freunden schwimmen soll verstehe ich irgendwie nicht. Zwar wurde es mir von allen, die es so um mich herum getestet haben als unglaubliches Erlebnis geschildert, aber der Reiz wird mir einfach nicht klar. (Bekommt außer mir bei dem Gedanken an Flipper noch jemand Hunger auf Tunfisch?) Mir bleibt – neben der Freude an den ulkigen Weihnachtsdekos der Schaufenster – das frei gewählte Nichtstun. Eine unglaublich wohlige Faulheit hat mich eingefangen und lässt mich nicht mehr los. Und das tut zugegebenermaßen extrem gut.
Dass sich die Kiwis bei ihrem lustigen Akzent auf ausgewählte Vokale beschränken, hatte ich , wenn ich mich recht erinnere, bereits erwähnt. Bei meinem nächsten Reiseziel lassen sie diese sogar ganz weg, so dass aus dem deutsch so schön aussprechbaren Blenheim ganz einfach „Blnm“ wird… immerhin schreiben sie Vokale, sonst würde ich jetzt womöglich der irrigen Annahme unterliegen in Polen gelandet zu sein… wobei… dann müssten es auch andere Konsonanten sein, denn ohne Zischlaute geht dort ja schließlich gar nichts. Dem Wetter nach zu Urteilen bin ich aber wohl eher in England, denn als ich in Blenheim ankomme, regnet es in Strömen. Blenheim liegt in der Marlborough-Region und bei dieser handelt es sich nicht – wie man durchaus vermuten könnte – um ein Tabak-Anbaugebiet, sondern um eine Weinregion. Genauergesagt um „die“ Weinregion Neuseelands. So beschließe ich, etwas für meine kulturelle Bildung zu tun und buche eine Tour durch verschiedene Weingüter. Hier reiht sich ein Weingut an das nächste und bei etwas weniger Regen, wäre die Tour wohl auch zu Fuß, oder zumindest mit dem Fahrrad möglich. Diese Tour wird mir im Hostel empfohlen und so bin ich doch etwas erstaunt, dass sich außer mir und dem Fahrer nur noch ein älteres (und dass meine ich nicht im Sinne von 35+) Ehepaar in dem kleinen Bus befindet. Das Paar ist aus Hawaii und natürlich halte ich mich mit meiner Meinung über diese Inseln dezent zurück. Ich bin ja höflich. Das Wetter ist nun einmal, wie es ist und daher bin ich Teil der Tour. Zuerst denke ich, dass es sich bei dem Ehepaar um Weinkenner handelt und überlege noch, ob ich versuchen soll mit meinem leider nur sehr geringen Halbwissen zu glänzen, um irgendwie den Smalltalk anzuheizen. Alternativ könnte ich mich natürlich auch noch unwissender stellen, als ich ohnehin bin, um den Herrschaften die Gelegenheit zu geben, mir etwas zu erklären und so eine Unterhaltung zu ermöglichen… Sehr schnell wird dann aber deutlich, dass meine Gedanken völlig irrelevant sind, da sie eigentlich gar nicht wirklich gerne Wein trinkt und er die Probiergläser zum Ausgleich gerne etwas voller hätte, dafür aber keinen so großen Wert darauf legt, was er eigentlich trinkt… das kann ja heiter werden… Wo bin ich denn hier gelandet und war es wirklich eine gute Idee, diese Tour zu machen? Zurück in dem kleinen Bus fahren wir zweimal quer durch die ganze Region, weil wir doch noch weitere Teilnehmer abholen. Zwei junge Paare, eins aus Kanada, eins aus den USA. Plötzlich senke ich den Altersdurchschnitt nur noch geringfügig und ich kann nicht wirklich sagen, dass mich das stört. Gleichzeitig bin ich die einzige Deutsche, ja sogar die einzige Europäerin… das ist mir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr passiert! Meine Freude über die Neuankömmlinge währt allerdings nicht allzu lange, denn da das hawaiianische Ehepaar ihnen zwei Weingüter und ich ihnen immerhin eines voraus bin, bleiben wir nach der nächsten Probe noch eine Weile zur Mittagspause, währen die anderen beiden Päärchen zu einem weiteren Winzer fahren. Und da sitze ich nun mit dem hawaiianischen Ehepaar… Wie gut, dass sich meine Konversationsfähigkeiten in den letzten Jahren stark verbessert haben, denn für Amerikaner sind die beiden nicht so richtig gut im Smalltalk… Der Beginn ist ein Krampf, dann testen wir nochmal Wein und irgendwann bricht dann doch noch das Eis und wir unterhalten uns über dies und das und haben eine wirklich schöne Zeit bei einer ausgesprochen leckeren Fischsuppe (bzw. einem äußerst extravagant angerichteten Fleischgericht). Dass nicht nur ich dies so empfinde stellt sich spätestens dann heraus, als wir die Rechnung bekommen und die Beiden mich einladen, weil es so schön mit mir war. Und weil ich die Amerikaner für ein nettes Volk halten soll. Zumindest diese beiden halte ich für äußerst nett und beschließe, den nächsten Amerikaner im Gegenzug auf einen Kaffee oder ein Bier einzuladen und dann geht es auch schon weiter mit der gesamten Gruppe zum nächsten Weingut. Hier jetzt über die einzelnen Weine zu philosophieren wäre vermessen, aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass die Neuseeländer einiges produzieren, dass sich von meiner Warte aus gesehen durchaus trinken lässt und so eine Weintour ist es alleine deshalb wert, weil man leise in sich hineinkichern kann, wenn Menschen der unterschiedlichsten Nationen versuchen, das Wort „Gewürztraminer“ auszusprechen. Probiert es mal, ist zwar nicht so lustig, wie wenn Franzosen sich an dem Wort „Eichhörnchen“ versuchen, aber schon nicht schlecht. Und findet außer mir noch jemand, dass es ohnehin weniger nach einer Rebsorte, als nach einer Pferderasse klingt?
Als ich mein Hostel sehe, in dem ich knapp zwei Wochen verbringen werde, um die Jahresendfeierlichkeiten zu begehen, denke ich ganz spontan über Flucht nach… will ich wirklich in diesem siffigen, mit viel gutem Willen als “alternativ” zu bezeichnenden Bunker die Feiertage verbringen? Bei näherer Betrachtung hätte mich der Name „Asylum“ doch irgendwie warnen sollen. Relativ schnell unterbricht mein Verstand mein Entsetzen, denn es würde extrem teuer werden, sollte ich mir wirklich ein anderes Asyl suchen wollen. Über die Feiertage zahlt man in dieser schönen Stadt mal eben gut das Doppelte, muss mindestens zehn Nächte buchen und im Voraus bezahlen… da hilft wohl alles nichts, da muss ich jetzt durch. Ein Wenig Schonzeit bleibt mir noch, an der Türe hängt ein Schild, dass die Rezeption gerade Pause macht. Gut, dann laufe ich jetzt halt noch eine Weile mit meinem Gepäck durch die Gegend. Wo kommt denn da eigentlich die ganze Zeit meine gute Laune her? Die ist ja schon nervtötend präsent, die hab ich wohl aus Neuseeland mitgebracht… Trotz der objektiv nicht gerade rosigen Situation bringt sie mich nur kurz zum Kopfschütteln über meine grandiose Hostelwahl (immerhin hatte es extrem gute Bewertungen bei Hostelworld, da musste ich mich ja fehlleiten lassen) und schickt mich mit meinem Rucksack bepackt in Richtung Park. Da ist es bestimmt schön, ich kann mal einen Eindruck von Sydney bekommen und außerdem ist doch heute Weihnachten. Schon vergessen? Auf dem Weg zum Park stelle ich fest, dass ich um diese Zeit (ca. 16.30 Uhr) in diesem Stadtteil wohl die Einzige bin, die nicht unter Alkoholeinfluss steht. Und als ich so über ein Mädel lache, dass ohne die Hilfe des Typen an ihrer Seite schon längst von ihren hohen Schuhen gefallen wäre und beim Überqueren einer roten Ampel einen Autofahrer dazu verleitet zu rufen „bring dein Mädchen lieber mal nach Hause“, erklärt mir der Kerl, der mit mir an der Ampel wartet, dass er Kings Cross so gerne mag, weil die Leute hier so herrlich verrückt sind. Wieder ein gut gelauntes Kopfschütteln meinerseits. Kurze Zeit später finde ich eine Kirche und davor sowohl einen Weihnachtsbaum, als auch eine Krippe. Wenn das nicht genügend Hintergrundmotive für ein 1A Backpackerweihnachtsfoto sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Fast meine gesamte Wartezeit verbringe ich mit albernen Selbstaufnahmen und dem Ausschlagen zahlreicher Angebote, dass man gerne ein Foto von mir machen könne. Nein, sich seltsam hinstellen, einen Arm ausstrecken und debil in die Linse grinsen ist Teil des Spiels. Als ich endlich zufrieden mit meinem Werk bin, gehe ich zurück zum Hostel, checke ein und stelle fest, dass die Außenansicht eigentlich noch ganz nett ist. So im Gegensatz zum Interieur. Mein erster Gedanke ist: Hier wäre aber mal eine Putzkolonne in Armee-Stärke notwendig. Mein Zweiter: Vielleicht sollte man das Gebäude mal grundsanieren… mittlerweile bin ich mir sicher, dass außer Abriss und Neuaufbau nichts mehr hilft. Der Teppichboden hat nur dort keine Flecken, wo Löcher sind (was immerhin zu einem recht großen Anteil an Fleckfreiheit führt), der Türrahmen im Bad hat irgendwie die Schwerkraft überlistet, denn oben existiert er, während er unten schon weggefault ist. Der Aufenthaltsraum ist ein Kellerloch mit einem Fenster durch das kein Licht kommt und ich kann euch sagen, als ich aus Versehen in die Sofaritze fasse, habe ich plötzlich ein extrem ausgeprägtes Bedürfnis, mir die Hände zu waschen… In meinem Zimmer herrscht Chaos und es riecht nach Jungs. Ihr wisst schon, der Gestank, über den sich Mütter von männlichen Teenagern immer so schön aufregen. So schlimm war es ja noch nichtmal in Wellington! Dafür gibt es einen Balkon. Dass dieser abends um 10.00 Uhr zugeschlossen und morgens um 7.00 Uhr geräuschvoll wieder aufgeschlossen wird, bekomme ich natürlich erst mit, als ich abends zu meinem Handtuch möchte, wir aber leider nicht mehr zusammenfinden können, weil eine Kette mit Vorhängeschloss den Weg versperrt. Gut, das ist dann also vorerst einmal mein zu Hause. Immerhin gibt es kostenloses Internet an in unregelmäßigen Abständen funktionierenden Computern und billiges Wi-Fi. Auch im Hostel bin ich eine der Wenigen, die noch Blut im Alkohol haben und hoffe kurz, dass es daran liegt, dass Heiligabend ist. Um jetzt noch einzusteigen ist es zu spät, also mache ich mich hinter meinem Computer unsichtbar, schreibe ein Wenig und freue mich, dass meine Tarnung so gut ist, dass meine Mitmenschen belauschen kann. Irgendwie ist hier eine extrem angenehme Atmosphäre und wenn sich die Augen erst einmal an die mangelnde Illumination angepasst haben und die Nase sich an den seltsamen Geruch gewöhnt hat, ist es fast gemütlich… So komme ich später mit Anke ins Gespräch, eine andere Deutsche (und von denen gibt es hier erstaunlich wenige!), die es auch für eine gute Idee hält, den Weihnachtstag am Strand zu verbringen und dann mal zu schauen, was es mit dem Barbecue auf sich hat, dass es von Seiten des Hostels geben soll. Und so machen wir uns am nächsten Tag auf zum Bondi Beach, um das surrealste und gleichzeitig entspannendste Weihnachtsfest zu verleben, das ich je hatte. Ein Weilchen liegen wir gemütlich am Strand herum, gehen Schwimmen, lesen ein Wenig und unterhalten uns prächtig. Würden hier nicht überall Menschen mit Nikolaus-Mützen sitzen, könnte man glatt vergessen, dass es sich um einen hohen christlichen Feiertag handelt. Die Mützen sind aber so gegenwärtig, wie all die Alkohol-Verbotsschilder, die vermuten lassen, was hier in den vergangenen Jahren so los war… Es gibt sogar Bikinis im Santa-Look. Vielleicht findet ihr das normal, mich hat es erstaunt. Als ich feststelle, dass ich meinen Beinen beim Bräunen zugucken kann und jetzt wohl genug Sonne für heute hatte, schauen wir nochmal kurz, was es mit der großen Christmas-Party auf sich hat, entscheiden uns aber, dass 59 Dollar für eine Feier mit Wet-T-Shirt-Contest nicht das sind, was wir gerade möchten und machen uns auf die Suche nach Nahrung. Hin und her gerissen, was wir eigentlich wollen, was es wohl mit dem Barbecue auf sich hat und ob wir etwas kochen sollen, gehen wir zurück zum Hostel, wo natürlich nichts weiter stattfindet. So ein wenig verplant sind die Leute dort ja schon… und das überrascht mich nichteinmal. Dafür entdecken wir ein japanisches Restaurant und es ist ja schließlich Weihnachten, da kann man sich ja auch mal was gönnen, oder? Anke und ich sind uns so schnell einig, dass es schon fast beängstigend ist. Bis das Restaurant öffnet, bleibt noch Zeit zum Duschen und schon sitzen wir dort, genießen die volle Aufmerksamkeit von mehreren Kellnern (ok, von denen ist nur einer wirklich aufmerksam) und freuen uns über das Leben im allgemeinen und unsere im Speziellen. Was für ein wunderbarer Tag. Und dann erst das Essen. Dummerweise komme ich erst beim Nachtisch (Sojabohneneis) auf die Idee, es fotografisch festzuhalten, denn auch meine in Wasabi eingelegten Oktopus-Tentakeln (ja, ich bin heute extrem experimentierfreudig und werde belohnt) und mein Fisch mit Reis-Gedöns sind nicht nur unglaublich gut, sondern auch wahnsinnig schön. Dazu gibt’s Wein… mein Leben ist schon wieder unwahrscheinlich hart. Wie gut, dass ich mich daran immer noch nicht gewöhnt habe und bei diesem Gedanken (der fast täglich auftaucht) immer noch angenehm überrascht sein kann. Später treffen wir uns noch mit einigen anderen aus dem Hostel, Weihnachten will ja schließlich auch gefeiert werden. Das allerdings ist ein ernsthaftes Problem, denn bis auf das Casino ist alles geschlossen… So bleibt uns ein ausgedehnter Spaziergang durch den Darling Harbour (unglaublich schön im Dunkeln) und die Feststellung, dass tatsächlich alle Asiaten (zumindest die männlichen) den Weg zum Casino kennen, während alle anderen Personen unwissend gucken, wenn man sie fragt, wie man dort hin kommt. Probiert es mal aus. Wir haben das ausgiebig und unter relativ undezentem gekicher getestet und ich werde diese Versuchsreihe auch in anderen Städten fortsetzen. Also, ich muss schon sagen, wenn man sich dem ganzen Vorweihnachts- und Jahresendzeitgetue einfach mal entzieht, muss Weihnachten gar nicht stressig sein. Ja, man kann einfach einen wunderbaren Tag haben und es sich gut gehen lassen. Gut, so richtig in Weihnachtsstimmung bin ich natürlich nicht, aber dafür bin ich mir sicher, dass dies der beste Weg war, die Feiertage zu verleben, wenn ich schon nicht zu Hause bin.
In den letzten fünf Monaten habe ich selten mehr als zwei Nächte am gleichen Ort verbracht, wie schön ist es da, einfach einmal eine Weile im gleichen Bett zu schlafen. Was macht es da schon, dass das Bett bereits beim Atmen wackelt, sich die Zimmertüre nur mit Gewalt öffnen und schließen lässt und der Wassersprenkler vor der Küche so eingestaubt ist, dass er im Falle eines Feuers ersteinmal eine ordentliche Ladung brennbaren Materials von sich geben würde? Richtig. Es macht gar nichts. Denn alleine die Tatsache, dass ich diese Feststellungen nicht alleine mache, sondern mit ein paar netten Leuten zusammen, stimmt mich weiterhin fröhlich. Und von denen gibt es hier reichlich. Wegen der Feiertage bleibt ja auch jeder etwas länger und da die Sonne nicht täglich scheint und wenn dann meist auch nicht die ganze Zeit, läuft man sich auf der Suche nach einem trockenen, trotzdem nicht kellerdunklen Sitzplatz auch ständig über den Weg. In meinem Zimmer riecht es mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm nach Jungs, seit das schwedische Bikini-Team mitsamt Freunden und großer Schwester bei mir eingezogen ist. So fühlen sich also sonst alle anderen Nationen, bei der großen Masse deutscher Reisender… schon komisch, wenn eine Nation so dominiert. Und obwohl mir die deutschen Backpacker ja ziemlich auf die Nerven gehen, wenigstens singen sie nicht morgens um halb acht… was mich dann aber doch friedlich stimmt ist, dass sie zumindest das Klischee bestätigen und ABBA-Songs trällern. Bis die Stadt Sydney selbst einen Eindruck in jedwede Richtung auf mich macht, dauert es einige Tage. Fragt mich nicht warum. Vielleicht ist meine Empfindung dadurch verlangsamt, dass ich weiß, dass ich hier länger bleibe, vielleicht liegt es aber auch daran, dass meine Erwartungen sehr hoch waren, während meine ersten Erkundungen mich nicht direkt vom Hocker hauen. Aber statt enttäuscht zu sein, bleibt einfach eine gewisse Spannung, die dazu führt, dass ich mehr sehen möchte, bevor ich mir wirklich eine Meinung bilde… Es dauert lange, Bruchstücke an Eindrücken fügen sich zusammen und wie auch in anderen Städten, die ich bisher besucht habe stellt sich die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu leben. So ganz allgemein, rein theoretisch, denn schließlich ist der Plan, Europa näher an diesen Teil der Welt heran zu rücken noch nicht umgesetzt. Die Frage an sich kann ich nicht so richtig verneinen (wobei die Tendenz doch in diese Richtung geht), ich kann sie aber auch lange Zeit nicht klar mit „ja“ beantworten. Zumindest so lange nicht, bis ich in eine Gegend komme, die mir mit ihren kleinen Geschäften, Restaurants und Cafés auf Anhieb gefällt. Ja doch, hier ließe es sich leben… Erinnert mich irgendwie an Berlin… Moment mal… Der Vergleich hinkt natürlich. Schon alleine deshalb, weil es hier Strände gibt und in Berlin nicht (und jetzt kommt mir nicht mit dem Bundes Presse Strand!). Und auch wenn ich kein großer Freund davon bin, mich den ganzen Tag zu grillen, als wäre ich ein Huhn, so hat das mit dem Meer doch schon etwas… schon alleine, weil die Luft so schön salzig schmeckt. Also manchmal, irgendwie ist das nirgends so stark wie an der Ostsee. Hatte ich mich darüber eigentlich schon ausgelassen, dass das Meer im Rest der Welt gar nicht so stark riecht, wie ich es bisher kannte? Wenn nicht, stellt euch einfach vor, dass ich da eine halbe Seite drüber philosophiere. Das spart uns jetzt allen ein wenig Zeit. Außerdem ist Strand natürlich nur schön, wenn das Wetter stimmt und wenn ihr mich fragt, ist das mit dem heißen, sonnigen Australien genauso ein Gerücht, wie mit dem regnerischen England. Vielleicht provoziere ich aber auch einfach nur gegensätzliches Wetter (sorry, Queensland). Schließlich habe ich bisher auch noch von niemandem gehört, der sich über den ständigen Regen auf Hawaii geärgert hat… Die wenigen Sonnentage zwischen den Jahren gilt es daher zu nutzen und so mache ich mich mit Nadine (die dritte und damit letzte Deutsche im Hostel) auf, um ein wenig an der Küste entlang zu wandern. Zehn Kilometer, Start ist Manly Beach und es sieht nicht so aus, als müssten wir bergauf laufen… Klingt nach einem Spaziergang und ist es auch. Abgesehen davon, dass wir uns zwischenzeitlich in einem Viertel verlaufen, in dem offensichtlich die Oberschicht der Stadt wohnt, ist die Strecke nicht sonderlich aufregend (keine Balance-Akte, keine Flussüberquerungen… wozu trage ich überhaupt meine hässlichen Wanderschuhe?). Die Aussichten, die wir genießen, sind allerdings trotzdem sehr schön, Belohnung ohne etwas dafür getan zu haben… das hat ja auch was… so einfach war das ja noch nie. Das Wasser unglaublich blau, die kleinen Strände erstaunlich gut besucht (wenn auch nicht überfüllt) und überhaupt… der Weg ist es Wert gegangen zu werden und die Sonne scheint ja auch grad’ so schön… da muss man ja auch draußen spielen. Mit dem Bus geht’s dann wieder zurück zum Manly Beach, wo es mittlerweile leider zu kalt zum Sonnen und erst recht zum Baden ist. Nur zur Erinnerung, ich bin nach wie vor im australischen Sommer. Schade eigentlich, aber was soll’s der Strand ist auch so sehenswert. Was an dem „Manly Beach“ besonders männlich sein soll ist mir allerdings schleierhaft, denn gutgebaute Männer mit wenig Bekleidung gibt es in diesem Land schließlich überall… Aber vielleicht bezieht sich das auch auf etwas anderes… Hmmm das habe ich dann wohl nicht bemerkt, war offensichtlich abgelenkt…
So langsam geht meine Zeit in Neuseeland zu Ende und ich muss mich wieder in Richtung Nordinsel bewegen. Und genau jetzt ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine schlechte Stray-Erfahrung mache. Jeder scheint irgendwann und irgendwo eine zu haben und ich eben auf meinem Weg nach Wellington. Mein kurzer Stopp in Blenheim galt einzig und allein dem Wein und so mache ich mich am folgenden Morgen los, um den nächsten Bus zu erwischen. Da ich um 10.00 Uhr auschecken muss, bin ich um ca. 10.30 Uhr am Busbahnhof, mein Bus geht erst um 11.30 Uhr, was soll’s, ich kann ja ein Wenig Lesen. Als der Bus um 12.15 Uhr allerdings immer noch nicht da ist, werde ich stutzig und gehe in das benachbarte Info-Centre. Vielleicht bin ich ja hier falsch, oder es gibt einen weiteren Ort, der so heißt oder was auch immer. Kann ja sein. Ist aber nicht so. Ich bin offensichtlich am richtigen Ort und die – wie irgendwie die meisten Neuseeländer – äußerst hilfsbereite Dame am Schalter bittet mich, noch eine viertel Stunde zu warten und wenn der Bus dann noch nicht da ist, ruft sie bei Stray an. Gesagt, getan, kein Bus, dafür meine Bitte um einen kurzen Anruf, dem sie sofort nachkommt. Es stellt sich heraus, dass ich am richtigen Ort bin, auch alles richtig gebucht habe, allerdings ist der Bus eine Stunde früher losgefahren, weil die Fähren am Wochenende anders fahren und sie konnten mich leider nicht erreichen. Auf meine Anmerkung hin, dass ich doch extra gestern noch meine Mails gecheckt habe, sagt die Dame von Stray, dass sie mir keine Mail geschickt, hat, weil sie erst heute Morgen versucht haben mich zu erreichen und da war die Chance ohnehin zu gering, dass ich sie noch lese… Auf meinem deutschen Handy scheint es auch niemand versucht zu haben und gesehen habe ich den Bus auch nicht, obwohl ich doch ca. eine Stunde vorher ohnehin am Busbahnhof war. Mit dem Gedanken an mich und dem Versuch, mich telepatisch zu einem Gegenanruf zu veranlassen war der Job von ihrer Seite offensichtlich getan… Ich bin erstaunt, wie kurzfristig und ohne weitere Informationsvergabe große Fährunternehmen wohl ihre Fahrpläne ändern… Wie um mich zu beruhigen erwähnt sie dann noch, dass da aber noch ein anderer Backpacker ist, der auch in Blenheim einsteigen wollte. Den haben sie auch nicht erreicht. Wir scheinen also zu zweit hier herumzuhängen. Danke dafür. Meine Optionen sind nun: bis Morgen warten und einfach den nächsten Stray-Bus nehmen, oder mich auf Kosten von Stray in einen Linienbus setzen und eine andere, etwas teurere, Fähre nach Wellington nehmen (was auch bedeutet, dass ich von dem Fährhafen – der natürlich auch weiter entfernt ist – zum Hostel kommen muss, für das ich nicht einmal eine Reservierung habe, weil ich ja nicht mit dem Stray-Bus ankomme…). Da ich bereits für den nächsten Morgen meine Weiterfahrt ins Nordland gebucht habe, bleibt mir nur die letzte Variante. Ich lasse die Dame nochmal alle Daten, die sie mir genannt hat bestätigen und frage mehrfach nach, ob sie sich das nicht doch noch anders überlegen. Das lässt sie erstaunlich geduldig mit sich machen und meint dann, dass ich das Fährticket allerdings selbst buchen muss, im Internet wäre es am billigsten. In diesem Moment atme ich einmal kräftig durch und erkläre ihr, dass ich – wie bereits erwähnt – gerade in einem Info-Centre am Busbahnhof bin, wo ich bereits seit zwei Stunden herumsitze. Öffentliches Internet gibt es hier keines und da ich mein ganzes Gepäck dabei habe, möchte ich auch ungerne zurück in die Stadt laufen, um mir ein überteuertes Internetcafé zu suchen, damit ich mir ein Ticket zu kaufen kann, weil sie es verbockt haben, mich zu informieren. Dass ich einen kompletten Tag meiner Reise verschwende reicht ja wohl schon. Das sieht sie zum Glück sofort ein und plötzlich ist das mit der Ticketbuchung auch kein Problem mehr… Geht doch. Nicht so klug die Gute, aber wenigstens freundlich. Mir bleiben ein paar Stunden am Busbahnhof, dem gegenüber es zum Glück eine Bäckerei gibt. Dann geht’s in den Bus und die Fähre ist dann natürlich auch zu spät, aber darauf kommt es nun ohnehin nicht mehr an. In Wellington bin ich dann erst spät abends, also wirklich nur noch für eine Nacht, ohne noch irgendetwas zu sehen oder erledigen zu können. Aber ich denke mir wiedereinmal „Wenn das das Schlimmste ist, das mir auf meiner Reise passiert, bin ich dabei!“ So habe ich wenigstens endlich einmal Zeit herauszufinden, wer der Mörder in meinem Krimi ist, den ich gerade lese. Es war einer der Museumsangestellten, nur für den Fall, dass ihr es auch wissen wollt.
Meine kurze Nacht in Wellington, ein Tag im Bus nach Auckland und die darauf folgende Nacht sind nicht wirklich einer Erwähnung wert, weshalb ich sie hier einfach nur kurz und lieblos aufzähle. Schön war allerdings, dass ich mich mit Catherine noch einmal treffen kann und zufällig und unabhängig von einander noch zwei Holländern aus meinem Bus begegne, so dass ich Gelegenheit habe, mich von ihnen zu verabschieden. Darüber hinaus vergehen zwei eher belanglose Tage, dann geht es allerdings weiter Richtung Norden zu der Bay of Islands. In meinem Bus befinden sich – neben dem Busfahrer – lediglich acht Backpacker, davon zwei Engländerinnen, eine Schweizerin und fünf Deutsche. Das Wetter ist mies, die Stimmung zäh und dass es im Bus so leise ist, liegt bestimmt nicht nur daran, dass es hier kostenloses Internet gibt (was ja in Neuseeland eine Seltenheit ist). Immerhin geht der Bus nicht kaputt, aber das ist auch schon das Einzige, was an diesem Tag rund läuft. Ach ja, ziemlich guten Kaffee in einem extrem individuellen Café mit Möweneingangstüre bekommen wir noch und das Hundertwasser-Klo sehen wir auch… Aber sonst… Schnorcheln auf Goat Island fällt flach, da vor einigen Tagen jemand in der Region ertrunken ist und die Maoris für einige Tage eine Art Besuchsverbot auf die Insel gelegt haben, bis er Ruhe gefunden hat. Der Besuch im Vogelschutz-Zentrum muss auch ausfallen, da ist heute aus ungeklärten Gründen niemand (die letzte Chance Kiwis zu sehen ist damit auch vorbei) und während der gesamten Fahrt heißt es „wäre es nicht so neblig, könntet ihr hier… sehen!“ Kurz überlege ich, ob ich nicht doch bei jeder sich mir bietenden Gelegenheit aus dem Bus aussteigen und ein weißes Foto machen sollte. Aber ich erspare euch die zahlreichen Bilder mit dem Titel „Was ihr hier nicht seht ist…!“ So vergeht fast ein gesamter Tag hinter einem beschlagenen Busfenster und ich kann nicht einmal das Internet nutzen, da mein Akku leer ist. Nicht einmal die vielen kleinen Inseln die sich vor der Küste Pahias befinden (die Bay of Islands halt) können wir sehen…Hallo Murphey… auch mal wieder da? Ich dachte, ich hätte dich auf Hawaii abgehängt. Naja, hier bleiben wir ja für zwei Nächte, da besteht ja noch Hoffnung, dass sie irgendwann auftauchen. Am nächsten Morgen geht es dann los auf einen Tagesausflug zum Cape Reinga, dem Punkt, der als nördlichste Spitze Neuseelands gefeiert wird, obwohl er es gar nicht ist. Außerdem geht es noch zum „Ninety-Mile Beach“, der gar keine neunzig Meilen lang ist, sondern nur knapp neunzig Kilometer, zum Sandboarden und zu einem „Fish and Chips“-Shop der aus einem mir nicht bekannten Grund zu Ruhm gekommen ist. Auf den letzten Programmpunkt freue ich mich schon sehr, denn laut Berichten anderer Stray-Reisender ist das Essen wirklich gut und ich habe mich in Neuseeland aus diesem Grund komplett von diesem Essen fern gehalten, weil ich ja schon von fast Beginn an weiß, dass es das hier gibt und da sollte man wirklich kein Risiko eingehen, irgendwo schlechte Fish & Chips zu essen. Die Tour wird von einem externen Unternehmen organisiert und wir steigen in einen Bus, der zwar nicht so aussieht, wie der auf unserem Prospekt, aber unsere Tickets akzeptiert und der neben ca. 40 Asiaten noch genug Platz für uns hat. Wir, das sind in diesem Fall zwei Deutsche Mädels und die Schweizerin aus meinem Bus und natürlich ich. Als einzige muss ich mir keine Gedanken darüber machen, was ich nach meinem Aufenthalt in Neuseeland gerne studieren möchte. Das Alter hat doch etwas Schönes… was komme ich mir heute weise vor… Cape Reinga ist einer der, wenn nicht sogar der heiligste Ort der Maoris, denn dort, wo sich der Tasman Sea und der Pazifische Ozean treffen, gehen die Seelen der Toten ins Meer. Der nach wie vor allgegenwärtige Nebel gibt der Gegend definitiv eine mystische Atmosphäre, hält uns aber leider auch davon ab, die angeblich atemberaubende Aussicht zu genießen. Erstaunlicherweise sind wir darüber aber nicht allzu betrübt, denn wir sehen mehr, als wir noch am Vortag vermutet hatten… Erwartungen und wie sie übertroffen oder enttäuscht werden, scheint wirklich ein dominantes Reisethema zu sein… vielleicht sollte ich mir dazu mal eingehende Gedanken machen… vielleicht lasse ich das aber auch einfach. Zurück auf dem Parkplatz, als wir vor den Toiletten stehen, die seltsamerweise auch innen nass sind, obwohl sie ein Dach haben (Nebel? Kondenswasser?), erscheint plötzlich ein Bus der genau aussieht, wie der auf unserem Prospekt und in uns wird langsam der Gedanke wach, dass wir vielleicht im falschen Bus sitzen. Mal sehen, wie das Tagesprogramm so weitergeht und ob wir alles tun, was wir sollen. Zunächst geht es zu wunderschönen Riesendünen. So stelle ich mir die Wüste vor. Wenn auch nicht ganz so angenehm temperiert. Wie perfekt ist das denn? Wunderschöne Sanddünen-Landschaft und trotzdem hat man nicht das Gefühl eine Gans am Weihnachtsabend zu sein. Ich mag dieses Land, habe ich das bereits erwähnt? Aus dem Kofferraum holen wir einige Body-Boards und dann erklimmen wir die Dünen. Oben angekommen erhalten wir noch eine kurze Erklärung und dann geht es auch schon kopfüber abwärts. Kritisch, wie ich extremen Geschwindigkeiten nun einmal gegenüber stehe, bremse ich doch recht viel, ärgere mich aber im Anschluss ein wenig, dass wir nicht genug Zeit haben, den Hügel noch einmal hinauf zu laufen, denn jetzt könnte ich etwas besser einschätzen, was ich eigentlich tue und hätte vielleicht nicht konsequent meine Füßchen im Sand…vielleicht sollte ich einfach mal aufhören so ein Angsthase zu sein. Egal, Spaß macht es in jedem Fall und sandgestralt bin ich jetzt auch. Dass in dieser Tour ein Ganzkörperpeeling inbegriffen ist (und damit meine ich den gesamten Körper und es ist egal, wie viel Kleidung man trägt… glaubt mir) sollten sie als weitere Werbebotschaft in ihren Leaflets integrieren. Und apropos… auch hier taucht der Bus wieder auf, der so aussieht, wie der auf unserem Prospekt… Weiter geht’s zum „Ninety Mile Beach“ und zwar mit dem Bus auf dem Strand entlang. Ich frage mich, ob hier bei schönerem Wetter Badegäste herumlungern, die das vielleicht nicht so toll finden, wenn hier Busse entlangheizen, aber nun gut, ist ja grad eh nicht so sonnig. Es ist erstaunlich, dass dies überhaupt möglich ist, ohne dass wir versinken, aber die Busfahrer wissen offensichtlich was sie tun. Hoffe ich. Im Gegensatz zu einigen Autofahrern, die zwar ihren Weg auf den Strand gefunden haben, wohl aber nicht den Weg zurück, wie diverse Wrackteile bezeugen… Deshalb darf man hier vermutlich auch nicht mit Leihwagen hin… ja, das macht schon irgendwie Sinn. Aus irgendeinem Grund fangen plötzlich alle Muscheln. Also fangen ist zu viel gesagt, denn man muss eigentlich nur die Hände in den Sand stecken und hat eine in der Hand. Nicht, dass ich es selbst probiert hätte, um ehrlich zu sein bin ich zu faul, mir schon wieder meine Schuhe auszuziehen und die Hosen hochzukrempeln, um mich ins Wasser zu stellen. Ja… das erstaunt mich selbst, ihr braucht euch also gar nicht erst darüber lustig zu machen. Das mit den Muscheln stand auch gar nicht in unserem Programm. Nachdem also sämtliche Asiaten stolz ihre Muscheltüten in den Bus geschleppt haben, fahren wir weiter und zwar zu unserem Kaffee-Stop, an dem man praktischerweise auch Möbel und sonstigen Kram aus altem Holz kaufen kann. Und wenn ich alt sage, dann meine ich so richtig Alt, denn die Bäume sind mehrere tausend Jahre alt, irgendwann umgefallen, konserviert und dann bei diversen Bauarbeiten wieder aufgetaucht. Entsprechend selten und teuer sind die angebotenen Waren. Sehen aber genauso aus, als wären sie aus neuem Holz… also entweder werde ich langsam zum Kulturbanausen, oder einfach nur extrem kritisch, denn so wirklich begeistern kann ich mich für diesen Halt nicht. Vielleicht ärgere ich mich auch einfach, dass ich mir keinen der riesigen, wirklich verdammt gut aussehenden Kekse kaufe, weil ich meinen Magen ja schließlich auf die Fish & Chips vorbereiten muss. In der kurzen Zeit, in der wir alle auf Toilette waren und nichts gekauft haben, hat der Fahrer den Bus wieder vom schlimmsten Sand befreit und wir fahren weiter. Mein Magen meldet sich langsam zu Wort und ich beruhige ihn, in dem ich ihm von der Leckerei erzähle, die er bekommt, wenn er sich nur ein ganz kleinwenig geduldet. Und dann sind wir auch schon zurück in Pahia. Ohne Zwischenstopp an dem „Fish & Chips“-Shop. Verdammt. Ich hatte mich doch so gefreut. Und das nicht erst seit gestern. Wir waren wohl doch im falschen Bus. Arrgggggg. Kurzzeitig denke ich darüber nach, ob ich jetzt einfach schlechte Laune bekommen soll, entscheide mich dann aber doch einfach dafür, die Stadt nach einem anderen Etablissement abzusuchen, dass mir in Fett gebratene Meerestiere serviert und werde sogar fündig. Zum Glück werde ich nicht einmal enttäuscht. Vielleicht wäre das Essen von dem ruhmreichen Laden noch besser, aber da ich es nicht kenne, kann ich es auch nicht vergleichen und so genieße ich mein Essen und – hauptsächlich um die gierigen Möwen zu ärgern, die mich schon wieder anstarren – kämpfe ich mich sogar durch die gesamte Portion. Jetzt nur noch zurück ins Hostel rollen und schlafen. Morgen wird aufregend genug.
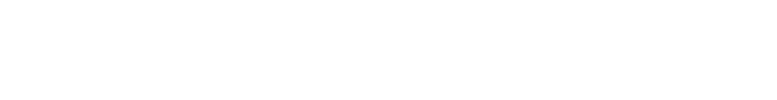
Es ist Heiligabend, kurz nach halb zwölf. Normalerweise schmücke ich um diese Zeit entweder mit meiner Mutter den Weihnachtsbaum oder ich genieße, in einen dicken Wintermantel gehüllt, mit meinem Vater das „Last Minute“-Shopping im winterlich gemütlichen Herborn. In diesem Jahr allerdings sitze ich im T-Shirt am Flughafen und warte auf meinen Flug nach Sydney. Trotz all der Menschen mit Weihnachtsmann-Hüten und dem ein oder anderen zaghaften „Merry Christmas“ kommt bei mir allerdings keinerlei Weihnachtsstimmung auf. Wie auch, so mitten im Sommer? Es ist schon faszinierend, wie wir bestimmte Festtage mit Jahreszeiten etc. assoziieren. Das sitzt einfach tiefer im Hirn, als jeder rationale Gedanke. Vor ca. zwei Wochen höre ich „Stille Nacht“ im Radio und denke mir nur: „Diese Kiwis sind doch bekloppt! Die spielen sogar im Sommer Weihnachtslieder!“ Abgesehen davon, dass es ihnen wirklich zuzutrauen wäre, hat es bei mir tatsächlich einigen Knatterns in den Gehirnwindungen bedurft (ist das wirklich ein Verb?), bis mir klar wurde, dass Dezember und Weihnachtslieder doch ganz gut zusammen passen… ob ich allerdings jemals das schlechte Gewissen loswerde, wenn ich im Dezember Erdbeeren essen, ist fraglich. Nun ist sie also vorbei, meine Zeit in Neuseeland. Und ich gehe rundum mit einem guten Gefühl. Dieser Teil der Reise ist wunderbar abgeschlossen, da ich irrsinnig viel gesehen und erlebt habe. Es gibt kein „Ich muss unbedingt wieder kommen, um dies oder das noch zu sehen.“ Trotzdem ist es ganz bestimmt kein Land, in dass ich nie wieder einen Fuß setzen möchte… Nein, ich wurde mit offenen Armen empfangen und jetzt wieder mit einer freundlichen Geste losgelassen und in die Welt geschickt. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wer weiß. Egal, wie es ist, es ist gut so. Zu allem Überfluss wurden mir am Ende noch einmal im Bus oder zufällig auf der Straße all meine Mitreisenden, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, oder die ich einfach nur nett fand, vor die Nase gesetzt, so dass ich mich ordentlich verabschieden konnte… Perfekt. Hier wird auch wirklich an alles gedacht. Als wäre das ganze Land nur zu meinem Vergnügen erschaffen und mit allem ausgestattet worden, das ich zum wohlfühlen brauche. Da ich mit Stray unterwegs war, betrachte ich dieses Land natürlich von einer ganz anderen Perspektive, als Nordamerika. Die Seite der öffentlichen Verkehrsmittel fehlt mir (bis auf eine Ausnahme), aber mir scheint, als wäre dies hier ohnehin nicht ganz so spannend… Neuseeland hat gehalten, was es mir am ersten Tag mit „Let me entertain you!“ versprochen hat. Nie hätte ich gedacht, dass Reisen irgendwo so einfach sein könnte (und es hat mich in Amerika schon erstaunt, wie leicht es alleine durch ein gewisses Sprachverständnis wird), aber dieses Land scheint einzig und allein für Backpacker gemacht zu sein, über nichts muss man sich Gedanken machen, alles ist einfach und leicht zu organisieren. Gar kein schlechter Schachzug, denn so bleibt genug Abenteuerlust für sämtliche Aktivitäten, die einem hier angeboten werden. Die Touristen-Horden halten einen zwar davon ab, das „wirkliche“ Neuseeland kennenzulernen, aber gleichzeitig wird einem der Eindruck vermittelt, dass genau das das echte Neuseeland ist. Die Kiwis, die ich kennengelernt habe, heißen die Backpacker mit der gleichen Selbstverständlichkeit willkommen, mit der sie selbst die Welt bereisen. Und das durch alle Altersklassen! Trotz all der Aktivität ist Neuseeland ein Land der Ruhe. Vielleicht liegt es an den endlosen Landschaften, die einem den Atem rauben, egal wo man hin sieht. All die Seen, Wälder, Strände, Felsen, Berge und grünen Wiesen mit Schafen und Kühen, die so unfassbar glücklich aussehen, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, ob ich so entspannte Tiere nicht auch essen möchte. Es könnte aber auch daran liegen, dass es hier einfach keine Hektik zu geben scheint. Fern von jeglicher nervraubenden Coolness oder Behäbigkeit, ist hier einfach niemand im Stress. Nicht einmal zwei Tage vor Weihnachten in der Einkaufsstraße in Auckland oder am Flughafen. Es ist kein Wunder, dass die Herr der Ringe Trilogie in diesem Land gefilmt wurde. Nicht nur wegen der unglaublichen Szenerie, sondern auch, weil man die Menschen hier wirklich mit Hobbits vergleichen muss. Relativ klein, irrsinnig freundlich, gut gelaunt, sie lachen gerne und legen Wert auf gute Kekse. Es ist unfassbar, wie schön ein gesamtes Land sein kann. Hier kann man Meer und Berge gleichzeitig im Blick haben, es gibt Seen und Flüsse in unbeschreiblichen Farben und obwohl es ein kleines Land ist, eine unglaubliche Weite. Auch, wenn mich keine Aussicht so berührt hat, wie der Grand Canyon, so gibt es hier einfach nichts, was mich nicht dazu gebracht hat, einen kurzen Moment mit offenem Mund innezuhalten. Manchmal frage ich mich, ob ich in den letzten Wochen überhaupt durch die Nase geatmet habe…
Egal was man liest und wo man hin hört, es scheint, als müsste man sich unbedingt die Blue Mountains ansehen, wenn man schon in Sydney ist. Und warum auch nicht. So ein Wenig Natur kann ja schließlich nicht schaden. Eine Gruppe Freiwilliger findet sich schnell und so wollen wir uns eigentlich mit fünf Leuten ein Auto mieten und die Gegend erkunden. So kurz vor Silvester sind die Preise allerdings so gesalzen, dass wir von unserer ursprünglichen Idee abkommen müssen. Die beiden Franzosen springen ab und so bleiben Nadine, Daniel (Österreicher) und ich. Außerdem gesellt sich noch Dhiren „unser Inder“ hinzu, der eigentlich Südafrikaner ist, aber immerhin indische Wurzeln hat. Statt mit dem Auto, reisen wir mit dem Zug, ist auch viel sicherer, wenn man bedenkt, dass die hier ja alle (naja, ist in dem Fall ja sogar eigentlich zu hoffen, dass es alle tun) auf der falschen Seite fahren. Also schön früh aufstehen, fix frühstücken und los. Obwohl ich mich eigentlich dagegen sträuben wollte, liegen Organisation und Zeitmanagement ein wenig in meinen Händen, um so beeindruckter bin ich, dass sich Daniel selbst zum Kaffee-Beauftragten erklärt und wir so alle mit einem Pappbecher in der Hand und einem kleinen Coffein-Hoch in den Tag starten können. Bis kurz vor dem Ziel ist unsere Bahnreise von Erfolg gekrönt. Dann aber bleibt der Zug plötzlich stehen und ich bin froh, dass ich mich nicht wirklich für den Ausflug verantwortlich fühlen muss. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mein bisheriger Erfahrungsschatz (und der ist ja nun nicht allzu klein) sagt mir, dass stehenbleibende Züge meist keine gute Idee sind… und so vergeht einige Zeit der Konfusion, Menschen steigen aus, um auf einen angeblich fahrenden Bus auszuweichen, steigen dann aber zum Teil wieder ein, laufen hin und her, es gibt unverständliche Durchsagen, der Zug macht Geräusche, hört wieder auf, scheint anzufahren, lässt es doch…. irgendwie ist das alles verwirrend und wir entscheiden uns, erst einmal nichts zu tun und abzuwarten. Wir würden die Blue Mountains ja schon gerne sehen… Aber so eine Zugfahrt ist ja auch ganz nett. Da haben wir doch schon was Schönes gemacht heute. Manchmal ist der Vorteil einer gewissen Lethargie nun wirklich nicht von der Hand zu weisen, denn irgendwann gibt es tatsächlich eine Durchsage, dessen Sinn wir uns zusammenreimen können und auf die folgend der Zug wieder losfährt. Und er fährt nicht nur los, er schafft die letzten Kilometer bis Katoomba ohne weitere Zwischenfälle. Zugegebenermaßen wünsche ich mir recht schnell, dass er es nicht geschafft hätte, denn als wir aus dem Zug aussteigen, befinden wir uns in einer unbeschreiblichen Touristenmasse, die sich in Richtung der „Hop-on Hop-off“-Busse bewegt. Wo bin ich denn hier gelandet? Und das ist nicht nur mein erster Gedanke, sondern auch mein Zweiter bis Achtundzwanzigster und das deckt gerade einmal die ersten zehn Minuten ab. Zum Glück packt auch meine Mitreisenden der Fluchtinstinkt und so verlassen wir schnellstmöglich den Touristenauflauf (und ich hoffe, dass das hier nicht zum Nationalgericht wird), gehen zur nächsten Bushaltestelle und besteigen den erstbesten, erstaunlicherweise nicht mal überfüllten Bus. Hier bekommen wir dann eine Erklärung, wie das Ticket funktioniert. Nein, nicht eine Erklärung, sondern die üblich ausführliche Abhandlung, bei der der Mentor wohl davon ausgeht, dass die angeblichen Zuhörer zu ungefähr gleichen Teilen desinteressiert, der Sprache nicht mächtig, abgelenkt, schlafend oder schlichtweg dumm sind. Nein, das mit der Sprache kann so auch nicht sein, den Punkt müssen wir streichen, denn so richtig gibt sich irgendwie niemand Mühe, einfach einmal den Dialekt im Zaum zu halten. Was wir auch erfahren ist, dass wir uns wohl den schlechtesten Tag des Jahres für unseren kleinen Ausflug ausgesucht haben, denn am 30. Dezember sind auch die einheimischen Touristen gerne mal in den Blauen Bergen (und an dieser Stelle wüsste ich gerne, ob auch nur ein Einziger unter euch gerade nicht am singen ist!!!). Wir sollen uns später auf einen großen Ansturm gefasst machen, es gibt zahlreiche Sonderbusse, aber Wartezeiten sind nicht ausgeschlossen. Grandios. Unsere Freude ist groß, offensichtlich kommt an diesem Tag nämlich keiner von den Blauen Bergen, sondern es zieht jeden hinein. Der große Vorteil an touristisch ausgeschlachteten Regionen ist natürlich, dass man schicke bunte Straßenkarten mit Bildchen bekommt, in denen man auf einen Blick sieht, wo man unbedingt hinmuss. Und wo wir ja nun schonmal da sind, nehmen wir das volle Programm mit. Alternativen gibt es außer sofortigem Rückzug aus dem Kampfgebiet ohnehin keine. Also ersteinmal zu irgendeiner Stelle mit einem schicken Ausblick auf die „Three Sisters“. Offensichtlich nennt man auf dieser Welt gerne Dinge so, da hatten wir doch schonmal nen Berg in den Rockies… und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich noch mehr finde. Diese hier sind auch Felsen und waren angeblich mal drei Schwestern, die von einem Zauberer in Stein verwandelt wurden, um sie von ungeliebten Männern zu beschützen. Dummerweise ist der Zauberer dann gestorben, bevor er sie wieder befreien konnte… Das müssen wirklich arg fiese Typen gewesen sein, wenn eine versteinerte Touristen-Attraktions sein eine Alternative ist… vielleicht hätten sich die Mädels aber auch einfach einen zweiten Zauberer als Backup zulegen sollen. Gerade hier in der Wildnis sollte man doch wirklich auf alles vorbereitet sein! Die Armen sind nun also nach wie vor in ihrer Felsgestalt und müssen sich anschauen, was um sie herum geschieht. Ich hoffe, dass sie es nicht auch hören, denn wir können uns nicht so schnell einigen, welche von den Dreien denn nun die hässlichste Schwester ist. Vermutlich wären ihnen solche Diskussionen aber auch egal, denn was sich vor ihren Nasen (ja… die kann man mit viel Fantasie erkennen… glaub ich), so abspielt, macht auch mir keinen Spaß mehr. Mal abgesehen davon, dass man fast Schlange stehen muss, um ein Foto aus der „besten Touri-Perspektive“ zu machen, trifft mich fast der Schlag, als ich die eigentlich recht schöne Aussicht genießen möchte und plötzlich eine Seilbahn durch mein Blickfeld schwebt. Ist das denn wirklich notwendig? Ja, Menschen gucken gerne irgendwo runter (müsst ihr mal beobachten, das ist genau wie der Drang von Männern bei jeder Gelegenheit Steine ins Wasser zu werfen), aber muss man denn dafür gleich Drahtseile von Fels zu Fels spannen? Ich bin entsetzt und bemühe mich, die Seile und die Bahn nicht auf meinem Foto zu haben. Wie dumm eigentlich, so kann ich euch nicht mal zeigen, warum ich mich hier gerade so echauffiere. Wir sind ja zum Glück nicht versteinert und können diesen gruseligen Ort wieder verlassen und uns auf einen der zahlreichen Wanderwege begeben. Und die sind irgendwie… nunja… wie soll ich es beschreiben… extrem für den Massentourismus ausgelegt, gleichzeitig aber unglaublich heruntergekommen. Überall gibt es Geländer, schicke Treppenstufen aus Metall, alles, was notwendig ist, um dem Besucher das Überwinden des nicht unwesentlichen aber auch nicht dramatischen Höhenunterschiedes zu erleichtern. Gleichzeitig sind die Wege matschig, ausgetrampelt und einfach schlecht gewartet. Man hat also zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Chance, sich an einem metallenen Geländer festzuhalten, das nicht wirklich in die Landschaft passt, ob es einen allerdings aushält, ist mehr als fraglich. Natürlich kann man direkt zu den Schwestern laufen und über eine kleine Brücke sogar in eine der Schwestern hinein, um dort ein Foto zu machen. Zeit zum Aussicht genießen gibt es allerdings nicht, da wollen ja noch mehr Menschen hin, um an dem quasi ausgewiesenen Fotopunkt ein wahnsinnig spontanes Bild zu machen. Um das zu ermöglichen, wurde an den Steinen herumgeschnitzt, wegen denen man überhaupt nur hier ist. Wie grauenvoll ist das denn bitte???? Wie gut, dass ich ja bereits mit den Niagara Fällen meinen Schockmoment in Sachen Tourismus erleben durfte. So muss ich mich zwar immer noch aufregen, es verdirbt mir aber nicht die Laune. Wenn man sich in einer Reisegruppe ersteinmal einig ist, dass man offenbar fehl am Platze ist (schon alleine, weil man mit dem überfüllten Zug und nicht mit einem der zahlreichen Reisebusse angekommen ist) und dass das ja alles nicht wahr sein kann, was man da gerade so beobachtet, hat man ohnehin keine Chance mehr, muffelig zu werden und eine grundsätzliche Albernheit liegt ja seit der unterbrochenen Zugfahrt ohnehin schon in der Luft. Wir erfüllen also unsere touristische Pflicht, laufen noch ein paar Wege ab, fahren mit einer komischen Bahn rückwärts einen Berg hoch, überprüfen bei fast jedem „Lookout“ die Aussicht, rennen kurz durch den Souvenir-Shop, staunen angemessen, als wir uns auf einer riesigen Aussichtsplattform befinden, die für die gute alte Elisabeth gebaut wurde und bitten andere Touristen, ein Gruppenfoto von uns zu machen. Danach ist auch gut und wir gehen Kaffeetrinken. Dass unsere Rückfahrt natürlich auch nicht problemlos verläuft, der erste Zug überfüllt ist, wir wieder herausspringen, uns überlegen, den nächsten zu nehmen und zwischenzeitlich ein Bier trinken zu gehen, keine Kneipe finden, aber dafür den nächsten Zug verpassen, ewig brauchen, bis wir um diese Zeit (ca. 18.00 Uhr oder so) ein Restaurant finden, dass uns ein Abendessen kocht, der Service so schlecht ist, dass wir zur Entschädigung Käsekuchen bekommen, dafür aber die Toiletten abgeschlossen sind, weil das Büro nebenan schon Feierabend hat und wir am Bahnhof schreckliche Musik von einem miserablen Gitarristen hören müssen,… all das erspare ich euch jetzt mal. Was soll ich sagen, ein besch… Ausflug aber ein wunderbar lustiger Tag!!!
Wenn ich schon mal in Australien bin, dann muss ich natürlich auch Maikes Farm besuchen. So viel habe ich schon gehört von der Blumenfarm, den Kühen und natürlich von Francy und Joseph, den beiden Holländern, die es irgendwann nach Australien verschlagen hat und die jetzt ca. eine Stunde von Sydney entfernt auf eben dieser Farm und mit eben diesen Kühen leben. Irgendwie bin ich ein wenig aufgeregt, als ich so im Zug nach St Mary’s sitze. Es ist ja schon komisch, plötzlich bei Menschen auf der Türmatte zu stehen, die man selbst nicht kennt, zu denen man aber trotzdem irgendwie eine Verbindung zu haben scheint… Trotz all der Geschichten habe ich aber kein konkretes Bild von dem, was mich erwartet. Joseph erkenne ich aber dennoch sofort, als er mit einem kleinen, weißen Lieferwagen vorfährt und munter winkt. Er und Francy sind wirklich herzig. Etwas älter als ich dachte, unglaublich interessiert am Weltgeschehen und sich ihrer vermutlich zunehmenden Schrulligkeiten offenbar vollkommen bewusst. Irgendwann weiß auch ich, dass Joseph konstant „Oh my god…“ sagt und Francy fast ununterbrochen mit sich selbst spricht, wenn sie irgendetwas erledigt oder darüber nachdenkt, was sie noch erledigen muss. Die beiden haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Backpacker bei sich aufgenommen und ihnen nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr Herz geöffnet. Unzählige Anekdoten, Erfolgsgeschichten und weniger schöne Erlebnisse haben sie so gesammelt, die sie bereitwillig mit mir teilen. Irgendwie scheinen sie mit so vielen jungen Leuten mitgereist zu sein, so viele fremde Länder sind ihnen vertraut, obwohl es hauptsächlich Joseph ist, der wirklich schon einmal dort war. Mittlerweile nehmen sie nur noch selten Volunteers auf, gerade ist aber außer mir noch eine Französin hier. Anne-Soleine wartet auf ihren Studienplatz und nutzt die Gelegenheit, ihr Englisch zu verbessern, was ihr auch in erstaunlicher Weise gelingt. Offenbar fehlte ihr hauptsächlich der Mut zum Sprechen und so erfahre ich irgendwann, dass Francy und Joseph erstaunt sind, wie viel und wie gut sie plötzlich spricht, als sie eine fast gleichaltrige (was machen schon 12 Jahre?) Gesprächspartnerin hat. Die Farm an sich ist nicht wirklich groß und die Blumen sind heute auch mehr Hobby, als irgendetwas anderes, denn Kunden gibt es leider nur sehr wenige. Wenn dann einmal jemand auftaucht, ist es das Highlight des Tages, alle freuen sich und sind aufgeregt und nervös. Die Rosen und Dalien und weißichwasnichtnochalles wunderschön und – wer hätte das gedacht – es gibt auch Rosen, die nicht nach Sch… Exkrementen riechen. Ganz im Gegenteil, der herrlich kühle „Flower Room“ riecht so wunderbar, dass ich ihn nur äußerst ungerne verlasse. Aber zum Glück herrscht während meines Aufenthaltes hauptsächlich Schmuddelwetter. Außer den Blumen gibt es noch eine Hand voll Kühe, zwei Katzen und in der Garage wohnt der Papst. Bei ihm habe ich eine tägliche Audienz, denn statt fließend Latein zu sprechen, beschränkt sich dieser auf das Kürzen von Rasenflächen und in diesem Zusammenhang die Herstellung von Kuhfutter. Meine lieben Eltern, wie konntet ihr mir durch den Mangel an Rasenflächen in meiner Jugend den Spaß am Rasenmähen vorenthalten? Es ist laut, stinkt und am Ende hat man ein wunderbares Resultat. Herrlich. Das Schönste ist, dass es bei Francy und Joseph nicht darum geht eine bestimmte Fläche auf Betonniveau zu stutzen, sondern eine Sackkarre voll Rasenschnitt zum Abendessen für die Kühe herzustellen. So kann ich mit dem Papst munter über die Wiesen fahren und es ist egal, wenn ein Stück nicht fertig wird, es unterschiedlich hoch ist, oder die Ränder nicht akkurat sind. Zugegebenermaßen überwinde ich aber bis zum Ende meines Farmaufenthalts nicht den stets in mir lauernden Drang, doch ein Quadrat zu mähen, Rasenflächen komplett zu stutzen und keine allzu munteren Muster in das Gras zu mähen… ich bin halt doch eine Ms. Monk. Selbst die ohnehin nur wenigen Fragen, die ich mir in meinem Reisealltag stelle („Was möchte ich machen?“ und „Was esse ich heute?“) sind während meines Farmaufenthaltes hinfällig und werden durch eine strenge Routine ersetzt, die mir nicht gelegener kommen könnte. 8.30 Aufstehen, anziehen, Frühstück machen 9.00 Frühstücken (Toast mit Marmelade, Nutella oder Erdnussbutter) Danach Aufräumen und irgendwelche Arbeiten erledigen, die erledigt werden müssen. Z.B. Unkraut zupfen, Fensterputzen.. 13.00 Uhr Beim Kühe Melken assistieren 13.30 Uhr Mittagessen machen, essen (Toast mit Käse und Salat), aufräumen Danach machen Francy und Joseph einen kleinen Mittagsschlaf und wir lesen, schreiben E-Mails oder was auch immer 16.30 Uhr Tee und Kekse Danach noch etwas arbeiten – was auch immer anliegt – dann Audienz mit dem Papst, Blumen pflücken, sortieren, wegräumen ca. 21.00 UhrAbendessen kochen, essen, aufräumen. Noch ein Wenig unterhalten, fernsehen oder lesen. 00.0 Uhr (wenn ich es denn solange schaffe): ab ins Heiabettchen Jeder Tag läuft gleich ab, ist absolut vorhersehbar und obwohl es sich um körperliche Arbeit handelt, die ich ja nun gar nicht gewohnt bin, klettere ich täglich weiter auf der nach oben offenen Entspannungsleiter. Diese Routine, sowie die Tatsache, dass ich mehrere Nächte im gleichen Bett, in einem Zimmer für mich alleine schlafe und mir mein Badezimmer nur mit Anne-Soleine teile, führen zu einer Zufriedenheit, die mich rundum erfüllt. Es ist wirklich erstaunlich, wie schön es sein kann, wenn mein zur Zeit eigentlich so spannendes und abwechslungsreiches Leben, das ich in vollen Zügen genieße, plötzlich vorhersehbar erscheint. Hier sogar so sehr, dass ich schon grinsen musste, als Joseph fragt, was für ein Wochentag sei und Francy sagt: „Gestern gab es Fisch und du isst gerade Suppe. Es ist natürlich Samstag.“ Besonders gut gefällt mir auch, dass man bei jeder Arbeit im Anschluss sieht, was man gemacht hat und dass die Tagesstruktur die Form der Arbeit und die Ausführungsintensität bestimmt. Und wenn dann eben die Kühe gemolken werden müssen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man das Beet nicht komplett von Unkraut befreit. Und wenn es Zeit für eine Pause ist, dann ist es Zeit für eine Pause und wenn ich die nicht regelmäßig mache, dann meckert Francy. Wenn es dunkel wird, ist ohnehin genug getan und Geschwindigkeit… was ist das? Das Wasser tropft halt eben auch nicht schneller aus dem Käse, nur, weil ich es gerne so hätte. Und selbstgemachter Käse schmeckt verdammt gut. Nur mal so nebenbei bemerkt. So verbringe ich also eine Woche zwischen Kühen und Blumen, singe ständig „Every rose has its thorn…“ vor mich hin, wenn ich mir wieder einen wunderschönen Kratzer eingefangen habe und genieße es, dass ich beim Unkrautzupfen so im Matsch knie, dass meine Jeans komplett braun sind und unfassbar lustig stauben, sobald sie trocknen. Und irgendwann, als ich so, die Schubkarre vor mich hinschiebend durch die Wiese stapfe und dabei gehe, als wäre ich gerade mit Gummistiefeln von einer Kuh gestiegen, stelle ich fest, dass das hier sogar hinpasst und ich mich gar nicht bemühen muss, einen Gang wie in Hackenschuhen zu haben. Um diesen Moment zu feiern, wische ich mir mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn, grinse vor mich hin und singe das Pippi Langstrumpf Lied.
Ja, ich war naiv. Nein, eigentlich habe ich einfach nur nicht nachgedacht. Meine Entscheidung Silvester in Sydney zu verbringen fiel ja hauptsächlich, weil es in meiner Planung nach einem guten Zeitpunkt aussah, nach Australien einzureisen und ich über die Feiertage gerne in einer großen Stadt sein wollte. So von wegen nicht alleine feiern und so. Dabei habe ich die offensichtliche Tatsache komplett ignoriert, dass Sydney die erste ernsthafte Stadt der Welt ist, in der 2011 beginnt (In diesem Fall nimmt wirklich keiner Neuseeland ernst. Nichteinmal ich.). Außerdem machen die schon seit Jahrzehnten ein riesiges Feuerwerk, dass in alle Welt übertragen wird… der Jahreswechsel ist also alles in allem ein ziemlich großes Ding und ich habe mich zwischenzeitlich tatsächlich darüber gewundert… jetzt aber freue ich mich hauptsächlich und wenn ich schon mal in der scheinbar begehrtesten Silvester-Stadt bin, dann will ich auch alles. Wunderschönes Wetter, perfekte Organisation, keinerlei Stress, viel Spaß, nette Menschen um mich herum, gutes Essen, angemessene Getränke, ein Fleckchen, an dem ich das Feuerwerk gescheit sehe… das kann ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Zwischen den Jahren fällt mir irgendwann eine Broschüre der Stadt in die Hände, in der detailliert sämtliche Orte aufgezeichnet sind, von denen man die Feuerwerke sehen kann. Es ist beschrieben, wie viele Personen auf den jeweiligen Arealen zugelassen sind, wo es Toiletten und Getränke gibt und in welchen Regionen das Mitbringen von eigenem Alkohol verboten ist. Ich bin schlichtweg begeistert. Offensichtlich wissen die hier, was sie tun. Was mich hingegen schockiert ist, dass es ganz danach aussieht, als müsste man sich bereits am frühen Morgen in den Park begeben, um ein schönes Plätzchen zu ergattern. Nein, schockiert ist eigentlich das falsche Wort, denn schon nach kurzem Nachdenken finde ich die Vorstellung von einem ausgiebigen Picknick gar nicht mehr so schlecht. Hätte ich an dieser Stelle länger nachgedacht, wäre meine Einstellung vermutlich wieder eine andere gewesen, aber so schnappe ich mir das kleine Heftchen und zeige es stolz einigen anderen im Hostel. Zu meinem Missfallen kann sich keiner so recht begeistern, denn angeblich haben die Leute vom Hostel ein ganz wunderbares Fleckchen in einem Park entdeckt, zu dem wir unsere eigenen Getränke mitbringen können und auch nicht ganz so früh hinmüssen… Also da bin ich natürlich skeptisch. Es fällt mir ja ganz allgemein schon schwer, das Schicksal meines Vergnügens in die Hände anderer zu legen, wenn ich diese dann aber nichtmal kenne, ein von den gleichen Personen zugesagtes Weihnachts-BBQ nicht stattgefunden hat und es sich außerdem zum Teil um Italiener handelt, die Haare haben wie Sideshow Bob, dann kann man von mir nun wirklich kein Vertrauen in die Organisation erwarten. Aber was soll ich tun? Ich habe die Wahl, mich alleine (oder im besten Fall ein paar mühsam überredeten Personen) früh morgens auf eine Rasenfläche namens Mrs. Macquarie’s Chair zu setzen, zu hoffen, dass das neue Jahr beginnt, bevor ich einen Hitzschlag habe und alles ganz genau so zu haben, wie ich es plane. Oder ich lasse mich darauf ein, dass es ein gnadenlos chaotischer Tag werden kann, den ich aber mit den munteren Menschen verbringe, wegen denen mir schon das Treppengeländer im Hostel egal ist, an dem man so schön festklebt und das sich trotzdem jedes Mal wieder anfasse, wenn ich daran vorbeigehe. Da fällt die Entscheidung natürlich nicht wirklich schwer, man muss ja auch mal was riskieren… Beginn der Feierlichkeiten ist Mittag. Im Hof gibt es Barbecue und die erste Runde alkoholischer Getränke. Sicherheitshalber besorge ich noch etwas fleischloses Grillgut, soweit kann ich mein Vertrauen dann doch nicht strecken. Nach zwei „Würstchen“ bin ich dann bereit für das erste Glas Weißwein. Nein ich korrigiere mich. Für den ersten Kaffeebecher lauwarmen Goon. Für alle, die es nicht kennen, Goon ist das beliebteste Backpackergetränk (vor dem ich mich bisher erfolgreich gedrückt habe) und ist sowas wie Wein. Es kommt aber aus einem 4-Liter-Pappkarton und auf dem steht, dass der Inhalt Milch, Soja, Eier sowie Fisch enthalten könnte, daher ist es strittig, ob es sich auch wirklich um Wein handelt. In prallem Sonnenschein ein Genuss. Nadine und ich kämpfen uns durch den ersten Becher, der Zweite geht schon gleich besser und dann wird es Zeit für die ersten 2 Liter Wasser, denen an diesem Tag noch viele folgen werden. Den Ruf ständig Wasser zu trinken habe ich ohnehin, warum am letzten Tag des Jahres noch dagegen ankämpfen? Daniel und unser Inder drücken sich vor dem Partybeginn im Hinterhof, finden dafür aber heraus, dass die Schlangen vor sämtlichen Parks mittlerweile extrem lang sind und die Sonne dort offensichtlich eine Qual. In mir wächst stetig der Gedanke, dass es gar keine schlechte Idee war, mich auf die Hostel-Feier eingelassen zu haben. Irgendwann am Nachmittag ziehen wir dann in einer ziemlich großen Runde, der sich noch Freunde von Freunden und deren Bekannten angeschlossen haben los, stürmen 1-3 Linienbusse und kommen schließlich zu einem Park, in dem der Hostel-Mitarbeiter, der Aussieht wie Sideshow Bob ein riesiges Fleckchen für uns frei gehalten hat. Und nicht nur das, überall stehen Kühltaschen mit den verschiedensten Getränken, die wir in einer nicht näher definierten Reihenfolge über den Abend hinweg zu uns nehmen können und es auch werden. Ja, ich habe die Organisationsfähigkeiten unterschätzt. Sie wissen tatsächlich, was sie tun. Kurze Zeit später sitze ich mitten in einer Horde lustiger Menschen aus allen möglichen Ländern bei strahlendem Sonnenschein auf meiner Decke, halte eine Dose Bier in der Hand und schaue direkt auf die Harbour Bridge. Wie kann denn bitteschön ein einziger Augenblick so schön sein? Zu schön denkt sich offensichtlich auch das Ehepaar, dass sein Baby als Ausrede benutzt, uns ein Zelt direkt vor der Nase aufzubauen. Und mit direkt meine ich so nahe, dass ich es fast mit den Füßen berühre. Dass wir davon nicht gerade begeistert sind entrüstet die beiden schon fast, schließlich braucht das Kind Schatten und bis zum Feuerwerk sind sie ohnehin weg. Ja wenn das so ist, bin ich natürlich beruhigt und starre gerne 7 Stunden auf eine gelbe Wand, dafür bin ich schließlich hier…. Pappnasen. Mit allen anderen Betroffenen ziehen wir also zwei Meter weiter auf der Wiese, die sich an dieser Stelle als Sumpfgebiet herausstellt. Aber ich sitze immer noch in einer Gruppe netter Menschen, halte immer noch meine Dose Bier in der Hand und die Sonne scheint natürlich auch nach wie vor. Nein, nichteinmal die Tatsache, dass mein Kleid gerade so durchweicht, dass ich es auf dem Weg zu meinem ersten Toilettenbesuch werde auswringen müssen, nimmt diesem Moment auch nur einen Hauch seiner Perfektion. Wow… ich bin einfach nur begeistert, glücklich, entspannt und habe vor Freude Tränen in den Augen, dass ich da bin, wo ich gerade bin. Wir picknicken, quatschen, trinken, stehen vor den Dixi-Klos Schlange, die offenbar in jedem Land gleich widerlich sind, quatschen, trinken, picknicken und irgendwann ist es Mitternacht. Das Feuerwerk, bereits vorab stündlich mit einigen kleinen Schüssen angekündigt, ist groß, bunt, einige um mich herum (und viele, die ich später auf meiner Reise treffe) sind enttäuscht, weil es wohl im Fernsehen besser rüber kommt, oder sie spektakuläreres gewohnt sind. Ich kann und will es nicht be- und schon gar nicht verurteilen, denn ich genieße einfach nur den Moment, den Abend, das neue Jahr und die Gedanken an das Alte, die Aussicht, das Land, den Sommer, die Gesellschaft all der netten, spannenden, inspirierenden Menschen, die ich bisher kennengelernt habe und die mir noch begegnen werden, die Erinnerung und Vorfreude an all die wunderschönen, einzigartigen Orte, eine grandiose Reise insgesamt, die mir schon so viel wunderbares gegeben hat und hoffentlich auch noch geben wird… Prost Neujahr. Auf dass es auch allen meinen Lieben zu Hause so gut geht wie mir und darauf, dass 2011 genauso schön beginnt, wie 2010 geendet hat!
Irgendwann entstehen gewisse Routinen, die ich nach all der ereignisreichen Zeit, in der jeder Tag ganz anders ist, als der vorherige, wirklich schätze. Hier verschwimmt die Zeitebene etwas, denn natürlich dauert es etwas, bis diese wirklich entstehen und wie es die Jahreszeit so will, ändert sich in diesem Zeitraum sogar das Jahr. Ich weiß nicht mehr wann ich die immer gleichen Abläufe bemerke, ob diese überhaupt so gleichförmig sind, wie sie mir erscheinen, aber ich finde es einfach unglaublich schön, mich jeden morgen mit dem immer gleichen Frühstück (Cerealien mit Milch, Tee und Toast) zu dem selben Österreicher (Daniel) im Hinterhof zu setzen, der den letzten von zwei Espressos (Espressi, Espressata was auch immer) trinkt, die er sich von „Pie Face“ gegenüber geholt hat. Nach wenigen Bissen gesellt sich dann unser Inder (Dhiren, der ja eigentlich Südafrikaner ist) hinzu und beginnt irgendein Gespräch mit Smalltalk-Charakter, zwischenzeitlich begnügen gerne mal zwei Franzosen (Babtiste und Emilien) mit ihrer Anwesenheit und während ich die Reste meines Kaffees trinke, kommt eine andere Deutsche (Nadine) hinzu. Wir bleiben ein Weilchen sitzen, quatschen und kommen irgendwann zu einer Entscheidung was wer wann und wie an diesem Tag tut. Mal alleine, mal gemeinsam, in welchen Kombinationen auch immer. Natürlich gibt es in dem Hostel noch viel mehr Menschen, mit denen man immer mal ein paar nette Worte wechseln kann, wie z.B. den US-Soldaten, die beiden Iren, die irgendwo in Australien in zwei vollkommen verschiedenen Minen arbeiten, das italienisch-englische Mädel, das immer so böse guckt, den Texaner mit den türkisfarbenen Cowboystiefeln, der nicht spricht, aber laut seinem T-Shirt mal an einem Schafscher-Wettbewerb teilgenommen hat, den Spanier, der auf seinem Laptop elektronische Musik fabriziert und zu hoffen scheint, damit einmal groß heraus zu kommen, den Deutschen, der glaubt, ich wäre Journalistin, weil man in meinen Unterhaltungen angeblich eine ausgefeilte „Interviewtechnik“ erkennen kann (und er weiß das, weil er selbst bei „den Medien“, genauer gesagt „beim Fernsehen“ arbeitet), die zahlreichen Schweden, die mich immer wieder fragen, ob ich denn schon abreise, weil sich mein Hab und Gut in meinem Rucksack befindet und nicht überall im Zimmer und nicht zu vergessen den Japaner, der aber eigentlich Belgier ist. Eine bunte Mischung lustiger Charaktere, herrlich zu beobachten und zu studieren. Ich wüsste wirklich gerne, viele Kilometer ich in dieser Zeit so durch Sydney laufe. An einige Orte zieht es mich immer wieder, meine Ausrede ist, dass ich die Oper gerne mit blauem Himmel fotografieren möchte, aber wenn ich mal ehrlich bin (und mal darüber nachdenke, wie oft ich dort bzw. am Hafen noch lande, als ich meine Touri-Fotos schon gemacht habe), so hat das Wasser einfach mal wieder eine große Anziehungskraft auf mich, der ich weder widerstehen kann, noch will. Sydney ist definitiv eine schöne Stadt. Nicht überwältigend, aber schön. In manchen Ecken ein Bisschen zu gestylt, zu touristisch, zu viel Bürooptik, ja, fast ein Wenig zu perfekt herausgeputzt. Aber trotzdem schön. Es macht großen Spaß, durch die Straßen zu ziehen, auf’s Wasser zu starren, wenn es denn nicht regnet in der Sonne zu brutzeln und die Stadt auf mich wirken zu lassen. Je länger ich hier bin, desto mehr gewinnt die Stadt mich. Anfang Januar hat unser Inder Geburtstag, bekommt zu seiner großen Überraschung von uns eine Torte mit Kerzen und darf sich aussuchen, was er an diesem Tag unternehmen möchte. Mittlerweile hat sich die Besetzung des Hostels schon deutlich verändert, überall sind neue Gesichter und nachdem sich auch Nadine am Morgen verabschiedet, sind tatsächlich nur noch Dhiren, Daniel und ich die Teilnehmer des „Inder-Geburtstags“ (und ihr glaubt gar nicht, wie lange ich mich schon auf dieses Wortspiel freue!!!). Unser Inder sträubt sich weniger dagegen, sich vollkommen dem klassischen Tourismus hinzugeben und daher besteigen wir den „Sydney Tower“. Nein, das ist das falsche Verb, denn wir fahren gemütlich mit dem Aufzug nach oben und lassen uns auf dem Weg noch vor einer grünen Wand fotografieren, die dann später durch spektakuläre Perspektiven ersetzt wird… wunderhübsch und ja… er kauft die Fotos sogar. Ich hingegen nehme mir vor, beim nächsten Mal ein grünes T-Shirt zu tragen. Sobald man irgendwo hinauf will, gibt es wohl eine gewisse Angst, dass jemand etwas Böses tun könnte. Trotzdem gelingt es mir, mein Taschenmesser durch die Sicherheitskontrollen zu schmuggeln. Wie gut, dass ich so ein netter Mensch bin und keinerlei Ambitionen habe, damit irgendetwas anderes zu tun, als mein Mittagessen zuzubereiten. Die Aussicht ist, wie von allen Türmen, auf denen ich bisher war, von oben herab auf eine Stadt, die etwas anders aussieht als andere Städte, aber trotzdem die klassischen Features wie Hochhäuser, Bürogebäude, Einkaufszentren und Parks erkennen lässt. Immerhin lerne ich, dass die Schienen auf den Dächern nicht für kleine romantische Stelldicheins in Mini-Zügen oder Hochhaus-Selbstmord bei Höhenangst gedacht sind, sondern zum Fensterputzen notwendig sind… macht ja irgendwie auch mehr Sinn. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass ich mich auf dieser Reise bisher von den hohen Gebäuden fern gehalten habe, das mache ich erst in Malaysia wieder. Und da erwarte ich mir wirklich etwas Spektakuläres. Bis dahin bleibe ich bei Bergen. Die hab ich doch mittlerweile so gerne. Danach geht’s ins Aquarium, das hingegen hatte ich mir wirklich für Sydney aufgehoben, auch wenn schon viele andere Städte von sich behauptet haben, die besten Fische in Glascontainern zu haben. Das Sydney Aquarium war vor einigen Jahren sicherlich grandios und modern. Heute habe ich an manchen Ecken wirklich Angst, dass eine Glasscheibe herausfallen könnte und ich zuerst nass und dann von irgendeinem Hai gefressen werde. Zugegebenermaßen ergibt sich dadurch ein Hauch von Spannung… der sich aber schnell wieder erübrigt. Hier sind so viele Kinder, die sind viel zarter und werden daher vermutlich ohnehin zuerst gefressen…. also kehren wir die Nahrungskette um und gehen auf den Fischmarkt. Meine lieben Damen und Herren vom „Lonely Planet“, ihr wart mir bisher eine große Hilfe, habt mir schöne Orte gezeigt und mich vor Touristenfallen gewarnt, aber nach den Blue Mountains ist der Fischmarkt trotz ultimativer Lobhudelei schon der zweite Reinfall. Der „Markt“ ist eine überfüllte Halle, die ich eher als „Food Court“ zum Thema Fisch und Meeresfrüchte bezeichnen würde. Erwartet habe ich Stände mit auf Eis liegendem Frischfisch, fiesen Geruch, Marktschreier… ihr wisst schon…. Atmosphäre. Aber hier ist es einfach nur stickig und voller europäischer sowie asiatischer Touristen, die Berge von frittiertem Ozeanobst (wieder einmal muss ich feststellen, dass die Verwendung zweier Synonyme der Bestandteile eines zusammengesetzten Hauptworts nicht unbedingt ein Synonym für dieses ergeben) zu sich nehmen… nicht schön… Muss ich mich etwa schon wieder mit dem Thema „Erwartungen“ auseinander setzen? Ich versuche doch schon, möglichst unvoreingenommen auf alles zuzugehen, aber so wirklich zu gelingen scheint es mir nicht. Ich genieße meine Zeit in und um Sydney wirklich ausgesprochen, was ich so sehe und tue reißt mich allerdings alles nicht vom Hocker. Vermutlich bin ich durch meine bisherige Reise verwöhnt und irgendwie nach wie vor reizüberflutet. Ich brauche ganz dringend weniger Eindrücke. Die einzige Ausnahme, etwas, das meine Erwartungen tatsächlich übertrifft, ist der Besuch der Oper. Mit Anke habe ich beschlossen, dass das ja wohl irgendwie zu einem Sydney-Aufenthalt dazu gehört und so haben wir Tickets für eine Varieté-Show mit dem Titel „Soap“ erstanden. Hauptsächlich, weil das Plakat gut aussah und das Datum passte. Und diese Show aber ist wirklich grandios. Ja, im Prinzip hat man alles schon mehrfach gesehen: Menschen, die an zwei von der Decke hängenden Tüchern herumturnen, Opernsängerinnen, Comedians, Balance-Akte… kennt man. Hier aber dreht sich alles um das Bühnenbild und das besteht aus mehreren, zum Teil mit Wasser gefüllten Badewannen. Unglaublich, wie die gleichen Akrobatik-Nummern an Spannung gewinnen, wenn sie auf, um und in einer Wanne stattfinden! Faszinierend und von der ersten Sekunde an begeisternd. Da ist es auch egal, das wir uns im Zuschauerraum einer kleinen Bühne im Operngebäude befinden und leider doch nicht mitbekommen, wie es dort drinnen eigentlich so aussieht… Und noch etwas haut mich in Sydney von den Socken, oder wetterbedingt wohl eher aus den Sandalen: Die Fledermäuse. Abends, kurz bevor die Sonne untergeht, wundere ich mich plötzlich über einen extrem tieffliegenden Vogel, der gar keiner ist. Es ist eine „Fruit Bat“. Und wo eine ist, sind noch mehr. In ganzen Schwärmen fallen sie plötzlich ein, schreien herum, hängen sich an Bäume, fliegen mit ihrer wunderschönen Form durch den sich verdunkelnden Himmel und haben irgendwie etwas gruselig-gespenstisch-schönes. Ihre Gefährlichkeit besteht dabei aber hauptsächlich darin, dass sich mein Blick gen Himmel wendet und ich konstant vor mich hinstolpere… Faszinierende Tiere, die mir auch noch den Gefallen tun, an Hochhäusern vorbei und um Kirchtürme herum zu fliegen. Alles bestimmt nur, um mir noch schönere Bilder für meine Erinnerung zu schenken, denn trotz aller Bemühungen klappt das mit dem Fotografieren natürlich nicht wirklich. Wie ging nochmal die Titelmelodie von Batman?


So richtig in weitere Planungslaune komme ich auf der Farm allerdings nicht, was ich aber eigentlich hätte sein sollen… macht nix und so geht’s nochmal für zwei Tage nach Sydney. In dieser Zeit passiert nicht viel. Ich schreibe einige E-Mails, ein paar Texte für meinen Blog und laufe außerdem viel durch die Stadt und denke über meine bisherige Reise nach. Muss ja irgendwann auch mal gemacht werden. Nun bin ich seit fast einem halben Jahr unterwegs. Unglaublich, was ich schon alles gesehen und erlebt habe, wie viele tolle Menschen mir schon begegnet sind und wie viele Anstrengende, Nervraubende. Mittlerweile versuche ich ganz bewusst, den vielen Deutschen aus dem Weg zu gehen, was mir leider nur selten gelingt (in Sifflöchern wohnen ist – wie mir scheint – eine gute Idee, mal sehen, ob sich das bestätigt). Es ist wirklich nicht schön, wenn man jedes nörgelnde Gespräch auch noch versteht und ich sage euch, davon gibt es viele… Solltet ihr euch wirklich von Anfang an durch meinen Blog geschlagen haben, könnt ihr an dieser Stelle mit Stolz behaupten, bereits 93,5 Seiten Fließtext über meine Reise gelesen zu haben. Berichte von dem, was ich in vier Ländern, auf zwei Kontinenten so gesehen, erlebt oder mir einfach nur gedacht habe. Und was mich wirklich erstaunt: Offensichtlich haben bis hierher Menschen aus 66 Ländern auf meine Seite geklickt. Warum auch immer. Vermutlich aus Versehen. Vielleicht habe ich aber auch tatsächlich Fans in Georgien, auf den Philippinen und in Äthiopien, die offenbar genug Deutsch verstehen, um sich verdammt lange auf meiner Website herumzutreiben… Soviel zur Statistik. Mittlerweile befinde ich mich ja quasi auf dem Rückweg, trotzdem liegt noch einiges vor mir und ich muss schon sagen: ich freue mich drauf. Ersteinmal gilt es, dieses riesige Land zu erkunden und dann liegt ja auch noch ein weiterer, unheimlich spannender Kontinent vor mir… also seid gespannt. Ich bin es auch. Und da ich Sydney ja bereits kenne, meinem kurzen Aufenthalt aber noch etwas Neues geben möchte, schalte ich auf meinen Spaziergängen mal die Nebengeräusche aus und gönne mir stattdessen ein Wenig Musik auf den Ohren. Unfassbar, wie anders sich eine Stadt mit Soundtrack anfühlt. Als ich durch eine Allee im Park gehe kann ich dann nicht anders, schaue in die Luft und drehe mich so lange im Kreis, bis mir schwindelig wird. Das ist wirklich lange nicht mehr gemacht worden. Macht aber unglaublichen Spaß… und schon ist das Pippi Langstrumpf Lied wieder in meinem Kopf… manches auf dieser Welt muss man sich gar nicht so machen, wie es einem gefällt… es ist von Anfang an perfekt.
In Kanada und den USA habe ich ja bereits gelernt, dass Hauptstädte auf anderen Kontinenten nicht die gleiche Bedeutung haben wie in Europa. Während sie bei uns nicht nur Regierungssitz, sondern auch kulturelle Hochburgen, Anziehungspunkt für Touristen etc., also schlichtweg in vielerlei Hinsicht von großer Bedeutung sind, sind Ottawa und Washington D.C. hauptsächlich für die Verwaltung geschaffen. Dazu gibt’s noch ein paar Museen. Fertig. So wie es aussieht, ist es bei Canberra auch so, ich rechne mit einer langweiligen Stadt, lasse mich aber trotzdem nicht davon abbringen, dort hinzufahren. Schließlich muss sich ja nicht jede Entscheidung in meinem Leben rational begründen lassen. Auf dem Weg bringt mich ein guter alter Bekannter, der Greyhound Bus. Dieser sollte hier aber anders heißen, denn die Busse riechen nicht nach nassem Hund und es gibt sogar eine Verpflichtung zur Sauberkeit an Bord, den entsprechenden Passus in den AGBs möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten: PERSONAL HYGIENE Passengers must be sufficiently washed and clean prior to boarding the coach. Any passenger with an odour that, in the reasonable opinion of Greyhound Australia, is objectionable to other passengers or staff may be asked to bathe themselves prior to boarding and/or may be required to travel on another service. If this change incurs a fee, it will be borne by the passenger. (aus den AGBs von Greyhound Australien) Die Fahrt ist also entsprechend unspannend. Neben mir sitzt eine nette alte Dame, die zur 70. Geburtstagsfeier ihrer Schwester anreist und den Film, den wir versuchen zu sehen (irgendwie ist die DVD kaputt) bereits kennt und so gerne mag, dass sie mir einfach alle fehlenden Teile erzählt. Außerdem gibt es diverse Backpacker und wie ich zu meinem Erstaunen feststelle, niemanden, der aussieht, als käme er gerade aus dem Knast (und ich bilde mir ein, hierfür einen gewissen Blick entwickelt zu haben). Auch die Landschaft, durch die wir so fahren ist relativ unspektakulär. Ich will ja nun nicht wieder mit dem Sauerland anfangen, aber das vermittelt vielleicht einen gewissen Eindruck, wie es hier aussieht… Was ich allerdings sagen muss: Das Gras ist auf der anderen Seite (und damit meine ich in diesem Falle Neuseeland) wirklich grüner und die Schafe sind hier viel weniger dekorativ. Also, das geht jetzt natürlich nicht persönlich gegen die Schafe, aber zum Einen fallen sie auf Grün viel eher auf, als auf Graubraun (ok, das ist nicht ganz so sauerländisch… außer vielleicht im Herbst…) und zum Anderen sind auch die Schafe hier nicht weiß, sondern ebenfalls graubraun. Ich nenne sie daher liebevoll Camouschafe. Also natürlich erst, als ich sie entdecke. Was ziemlich lange dauert. Sonst müsste ich sie ja nicht so nennen… Nach Canberra wollen ja nur die Wenigsten, denn – wie jeder weiß – ist es dort recht unspannend Entsprechend gibt es wenig Hostelauswahl und ich lande in einem YHA, obwohl ich ja eigentlich die Siffhostel-Strategie fahren wollte.. Für alle, die YHA /HI nicht kennen: Es sind zertifizierte Hostels. Zu Hause z.B. vom Deutschen Jugendherbergswerk. Man bekommt einen bestimmten Standard (z.B. Lampen am Bett), darf aber nicht allzuviel Charme erwarten. Allerdings kann man drauf zählen, verdammt viele Deutsche zu treffen. Und diese sind in meinem Fall natürlich alle zwischen 18 und Anfang 20, gerade mit der Schule (bzw. in einem Fall der Ausbildung) fertig und unglaublich anstrengend. Als ich ins Zimmer komme und die stetigen Nörgeleien höre, denke ich darüber nach, mich einfach als von irgendwoanders her kommend auszugeben. Vielleicht sollte ich wirklich mal mehr über Südafrika lesen, den Akzent kann keiner so richtig zuordnen und mehrfach wurde mir das schon als Heimat nachgesagt… Aber ich bin ja eine ehrliche Haut, irgendwann würden mich meine beiden „Jack Wolfskin“-Artikel ohnehin verraten und irgendwie packt mich dann ja auch der Beschützerinstinkt. So unterhalte ich mich ein Wenig mit den gerade anwesenden Mädels. Die beiden sind seit zwei Wochen in Australien, waren zuerst in Sydney, was sie total toll fanden, wo sie aber keinen Job gefunden haben. Dann sind sie nach Canberra, aber da ist ja nix los. Wie gesagt, das sollte einen eigentlich nicht überraschen, wenn man zumindest einmal kurz den Lonely Planet aufgeschlagen hat. Gäbe es ein Symbol für „langweilig“ wäre es wohl zwischen zwei Ausrufezeichen an einer auffälligen Stelle in Fettschrift abgedruckt… da man aber den Text lesen muss, sind die beiden überrascht über diese Tatsache. Außerdem ist das Hostel ihrer Meinung nach auch nicht schön (definitiv das sauberste und ordentlichste, dass ich in den letzten Wochen hatte), schließlich hatten sie von der Organisation, die ihnen das Visum etc. besorgt hat in Sydney ein ganz besonderes reserviert bekommen und das war viel schöner. War aber sogar noch teurer als das hier und überhaupt ist alles so wahnsinnig teuer, das geht ja gar nicht….zwar gibt es hier einen Aldi, in dem man ordentliche Sachen bekommt, aber der macht ja schon viel zu früh zu…unmöglich… und nach Melbourne brauche ich gar nicht fahren, da sind nämlich alle Hostels ausgebucht (hmmm… komisch, als ich am kommenden Tag nachsehe, finde ich noch einige…), weil alle Backpacker, die nach Queensland wollten jetzt dort sind und außerdem die „Australien Open“ stattfinden. Das ist ja alles gar nicht schön…. Außerdem möchten sie ja Englisch lernen, aber hier sind ja nur Deutsche, wie soll das da denn bitte gehen? Und wenn sie jetzt nicht bald, also in den nächsten Tagen, einen Job finden, dann müssen sie nach Hause fliegen. Das wäre ja auch doof, aber anders ginge es halt nicht…. Als ich dann mal kurz anmerke, dass es ja ggf. auch noch die Option gäbe, durch Volunteering zumindest ein Bett und Essen zu bekommen, zieht es die eine noch in Betracht, die andere aber ist entsetzt. Sowas würde sie ja nicht tun.. Genau. Lieber nach drei Wochen wieder nach Hause fliegen…. Irgendwann während dieses Gesprächs blinkt mein neuer Lieblingssatz in meinem Kopf auf und ich muss mich beherrschen, ihn nicht laut zu sagen. Dieser lautet „Halt die Klappe und sei glücklich!“ Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft der noch aufblinkt… Zum Glück taucht irgendwann eine gutgelaunte Engländerin auf, die ein fröhliches „Hello!!!“ in den Raum wirft und sich damit vermutlich den Unmut der beiden Mädels auf sich zieht, denn diese schlafen den ganzen Tag. Ruth macht in Australien Urlaub, hat zwei Tage in Canberra und möchte was sehen. Also schließe ich mich ihr an und da sie ein Auto hat, ist das Erkunden der Stadt um so leichter. Wir fahren also einmal grob durch die Stadt, schauen uns das wirklich faszinierende Regierungsgebäude von außen an, stellen fest, dass das Wasser im See extrem siffig ist und die Idee, dass irgendwer darin schwimmen könnte (was zum Glück nicht vorkommt) extrem ekelhaft wäre und begeben uns dann auf die vergebliche Suche nach Wi-Fi. Gar nicht so leicht in einer Hauptstadt… Als wir wieder im Hostel sind, sprechen die beiden deutschen Mädels (sowie die drei anderen deutschen Zimmergenossinnen) natürlich nur mich an (auf Deutsch) und meine Versuche, die Unterhaltung in Englisch zu führen, damit sich Ruth nicht komisch vorkommt und die beiden vielleicht doch noch was von ihrer Sprachreise haben, sind vergeblich. Das letzte Stückchen Beschützerinstinkt in mir weicht einer stetig wachsenden Aggression. Wenn sich noch ein einziges Küken darüber beschwert, kein Englisch zu lernen, weil hier zu viele Deutsche sind, dann kann ich für nichts garantieren… So. Genug gelästert. Canberra hat nämlich zum Glück noch mehr für mich zu bieten, als nur nervige deutsche Mädels. Ich tue nämlich das einzig richtige und schließe mich einfach auch am nächsten Tag mit Ruth zusammen, um den Rest der Stadt zu erkunden. So treiben wir uns eine Weile in den Museen und Galerien herum (da sind diese Australier wirklich nicht schlecht drin) und gehen schließlich zum „War Memorial“. Hierfür ist Canberra bekannt und es ist wirklich beeindruckend. Das Hauptmahnmal erinnert an die beiden Weltkriege und im Gedenken an die Gefallenen haben Freunde, Bekannte oder wer auch immer Mohnblumen aus Stoff neben die endlose Liste der Namen gesteckt. Außerdem gibt es auch hier ein Museum. Eine freundliche Dame erklärt uns, dass es dort um die Geschichte sämtlicher Kriege geht, es ziemlich interessant sei und viele Leute tagelang dort drin verweilen könnten. Die Ausstellung ist zweifellos spannend und allumfassend. Der Grund, warum manche dort wohl tagelang verbringen ist aber vermutlich ein anderer… so einfach es auch ist, in das Museum hineinzukommen und unseren Weg durch die einzelnen Themen zu finden… wie wir wieder herauskommen sollen ist uns schleierhaft.n Und zwar ziemlich lange. Unterirdisch, von außen kaum sichtbar befindet sich also ein Museum, das groß genug ist, dass man sich darin problemlos verlaufen kann. Irgendwann, nachdem wir diverse orginale Kampfjets gesehen und gehört haben, auf riesigen Leinwänden Luftangriffe „miterleben“ konnten und überhaupt alles Mögliche bewundert haben, finden wir zwei Mitarbeiter, die uns bei der Suche nach dem Ausgang helfen können… Puh… wie schön kann doch Tageslicht sein… Vor dem Mahnmal, links und rechts der Prachtstraße, die hin zum Parlamentsgebäude führt, befinden sich noch einmal einzelne Denkmäler zu allen weiteren Kriegen, in denen Australier gekämpft haben. Um ehrlich zu sein hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass Australien überhaupt in Kriege verwickelt gewesen sein könnte. Ein Land, so weit weg, dass es keinerlei Interesse an Konflikten zu haben scheint… wäre da nicht die Bindung zu England. Und die Queen hat in den vergangenen Jahren oft genug gerufen, so dass die Australier (genau wie die Amis) nur noch wenig Platz haben, um an all die Kriege zu erinnern, in denen sie mitgemischt haben. Canberra ist wirklich keine Stadt, die man unbedingt bereisen muss. Wenn man aber schonmal vorbeikommt, lohnt sich der Blick in die Museen wirklich. Eigentlich schade, dass es hier so wenige hinverschlägt.
Weiter geht es Richtung Süden. Von diversen Seiten habe ich bereits gehört, dass Melbourne eine schöne Stadt sein soll. Offenbar extrem „laid back“ und relativ „Europäisch“. Wegen der Flut in Queensland habe ich mir die klassische Backpacker-Route ohnehin aus dem Kopf geschlagen und außerdem schulde ich einem Australier, den ich in den Rockies getroffen habe, ein Bier. Oder er mir? So ganz sind wir uns darüber nicht einig, aber als gute Deutsche muss ich das Thema „Bier“ ernst nehmen, soweit geht selbst mein Nationalstolz. So leicht mir die Entscheidung für mein nächsten Zieles auch fällt, in der Reise an sich ist der Wurm drin, so dass ich mich zwischenzeitlich wirklich frage, ob ich dort vielleicht gar nicht hinfahren sollte. Entgegen aller Vermutungen deutscher Mädels, finde ich zwar problemlos ein Hostel in St. Kilda, das nicht einmal übermäßig teuer ist. Leider ist der Bus, den ich gerne nehmen möchte aber ausgebucht, ich muss also einen weiteren Tag in Canberra bleiben. Naja, geht auch rum… Also rufe ich im Hostel an, um meine Buchung zu verschieben und erfahre, dass ich gar nicht mehr einchecken kann, wenn der Bus aus Canberra in Melbourne ankommt. Aber es finde sich bestimmt eine Lösung, ich solle doch am Tag meiner Anreise morgens nochmal anrufen. Gesagt, getan und schon erfahre ich, dass es keine Ausnahmen gibt. Keine Möglichkeiten, den Schlüssel irgendwo zu hinterlegen, mir PIN-Nummern zu hinterlassen oder was auch immer ich in den letzten Monaten so an abenteuerlichen Varianten erlebt habe. Mir bleibt nur, mir ein neues Hostel zu buchen. Sehr schön, dass ich das jetzt erst erfahre… schließlich habe ich nicht mehr allzulange Zeit, bis mein Bus abfährt grrrrrrrr. Also suche ich mal wieder nach einer Möglichkeit, mich irgendwo ins Internet einzuloggen, es gelingt mir, ich buche ein anderes Hostel. Soviel zur Hostel-Situation in Melbourne… allerdings ist es teurer, wegen der Aussie Open. Auch egal, ändern kann ich es nicht und für noch ein paar weitere Tage hat Canberra dann wirklich nichts mehr zu bieten. Auf dem Weg durch die Stadt treffe ich eines der deutschen Mädels, von der ich weiß, dass sie das gleiche Hostel in Melbourne gebucht hat, allerdings zwei oder drei Tage später. Also erzähle ich ihr von dem Problem beim Einchecken und sie verfällt sofort in Panik. Sie wollte sich doch jetzt eigentlich das Kriegsdenkmal ansehen, aber jetzt muss sie wohl doch erst wegen eines anderen Hostels gucken und das kann ja nicht sein und sowas aber auch und Mist und Panik und Aaaaahhhhh… Schnell mache ich mich aus dem Staub, für so dramatisch halte ich das nun alles auch nicht, vor allem, wenn man noch ein paar Tage Zeit hat. Setzt mit der Weisheit des Alters etwa auch eine gewisse Ruhe ein, derer ich mir bisher noch gar nicht bewusst war? Ich gehe zum Busbahnhof, möchte einchecken und erfahre, dass ich gar nicht auf den Bus gebucht bin. Die Gute am Schalter hat mich für einen weiteren Tag später eingetragen. Danke dafür. Dieser Umstand macht mich nicht gerade glücklich, hatte ich ja vor wenigen Minuten erst ein neues Hostel gebucht und so gerne ich mich auch in Museen herumtreibe… jetzt reicht es mal mit dieser Hauptstadt. Kurz ärgere ich mich ziemlich, dann aber überkommt mich doch wieder der Schluss, dass ich mich nicht beschweren werde, wenn Zwischenfälle wie dieser das Schlimmste sind, was mir auf dieser Reise passiert. Also überdenke ich meine Optionen. Wie so oft ist das Einzige, was ich tun kann: Mädchen spielen. In diesem Fall gehe ich zum Busfahrer, glücklicherweise sind es gleich zwei. Ein bisschen Jammern und hier und da und warten und traurig gucken und Jammern und plötzlich findet sich noch ein Platz im Bus… Geht doch. Dank der australischen Greyhound-Philosophie sitze ich auch diesmal wieder ausschließlich neben gewaschenen Personen und höre von keiner Seite Geschichten über Gefängnisaufenthalte und Drogenentzüge. Kurz frage ich mich, ob ich das vermisse, entscheide mich aber doch dagegen. … und dann kommen wir auch irgendwann relativ spät abends in Melbourne an. Es gibt keine weiteren Zwischenfälle, was mich dann doch sehr beruhigt. Kurz zur Begriffsklärung: Es heißt nicht „Melböööörn“ und schon gar nicht Melborn (Ist nämlich auch gar nicht die kleine Schwester von Herr Born – Danke, Habi!), sondern schlicht und ergreifend „Melbn“. Dass die hier vom Verschlucken der ganzen Vokale keine Verdauungsprobleme haben, wundert mich. Offensichtlich handelt es sich hier wirklich um die Westinsel Neuseelands… aber genau diese Kommentare erspare ich mir wohl am besten, so lange ich hier bin… Im Hostel angekommen, begebe ich mich für ca. 10 Minuten in den Aufenthaltsraum, um kurz vor dem Einschlafen noch eben meine Mails zu checken. Und was passiert genau in eben diesen 10 Minuten? Genau. Ich höre ein „I can’t believe it!!! Anna!!!“ Es ist Aafke. Eine Holländerin, die ich aus Neuseeland kenne und die kurz im Hostel vorbeischaut (in dem sie gar nicht wohnt), um dort Freunde zu besuchen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Die Welt der Reisenden ist offensichtlich verdammt klein. Wir quatschen kurz, dann muss sie weiter und trotz diverser Versuche schaffen wir es leider nicht, uns in den kommenden zwei Tagen nochmal zu verabreden. Zuerst ist immer eine von uns beschäftigt und als wir es fast schaffen, muss sie mit einer Freundin ins Krankenhaus, die sich irgendwas an der Hand getan hat. Schade eigentlich. Nach einer ordentlichen Mütze Schlaf (habe ich eigentlich bereits gestanden, dass 10-12 Stunden pro Nacht nach wie vor meine Norm sind?), packe ich meine sieben Sachen und ziehe in das ursprünglich gebuchte Hostel in St. Kilda. Mein erster Eindruck von dem Hostel ist grauenhaft, der der Stadt hingegen verdammt gut. Ich laufe ein Wenig durch die Gegend, freue mich über die gute Atmosphäre und stelle fest, dass ich mich gerade zum ersten Mal auf dieser Reise in einer Stadt befinde, in der ich mir vorstellen könnte zu leben. Ja… Melbourne hat wirklich etwas europäisches mit seinem Mix aus relativ alt (so richtig geht das natürlich nicht), modern und den kulturellen Angeboten an jeder Ecke. Was auch immer es ist, die Stadt hat Charme, die Sonne scheint, die Anna freut sich. Am Abend treffe ich Chris, den Australier, um meine Bierschulden einzulösen. Außerdem freue ich mich darauf, endlich mal einen lokalen Stadtführer zu haben und etwas mehr zu erfahren, als das, was mir der Lonely Planet erzählt. Diese Hoffnung wird allerdings schon nach wenigen Minuten enttäuscht, denn der Gute stellt sich sehr schnell als hundsmiserabler Tourguide heraus. Dafür kennt er sich mit Cafés und Kneipen bestens aus – auch ein Weg, die Stadt kennenzulernen. Wir laufen durch kleine Straßen und mehrfach durch Gässchen, in die ich alleine vermutlich nie gegangen wäre, öffnen scheinbar wahllose Türen in x-beliebigen Hauswänden und dahinter verbergen sich oft winzige, manchmal aber auch recht große, individuelle Bars und Cafés. Melbourne hat mich ja bereits tagsüber begeistert, aber die Tatsache, dass es hier nun wirklich keinen Grund gibt, bei Starbucks einzukehren freut mich umso mehr. Wieder einmal ist es schön jemanden zu treffen, mit dem die Fragen nach Name, Herkunft, Alter, bisherige und kommende Reiseziele bereits geklärt sind. Trotzdem ist Reisen natürlich immer ein Thema und irgendwann erzähle ich, dass ich Hawaii so gar nicht mochte und nicht einmal ein Schirmchen in meinem wohlverdienten Cocktail hatte. Als wir später in einer Cocktailbar landen (die wohl früher mal ein Puff war und heute immer noch sehr rosa ist), bekniet Chris die Bedienung so lange, bis die ihr letztes Schirmchen für meinen Cocktail herausrücken… dafür muss ich Melbourne jetzt wohl einen Paradies-Punkt geben, den Hawaii nicht bekommen hat… wobei die Strände bzw. das dazugehörige Wasser extrem fies sein sollen. Irgendwann an diesem Abend lasse ich mich zu dem Statement hinreißen, dass mich das Hostelleben noch nicht nervt. Ich habe einen verdammt guten Schlaf, die wohl sinnvollste aller Eigenschaften beim backpacken und kann mich daher nicht wirklich beschweren. Irgendwann wieder einmal ein Zimmer oder gar ein Bad für mich alleine haben wäre schon schön, aber bisher ist alles in Ordnung. Das hätte ich mal besser nicht zu laut gesagt. Als ich im Hostel ankomme, schleiche ich mich ins Zimmer, bahne mir mit der Taschenlampe den Weg zum Bad, mache dort Licht an und stelle fest, das noch keine der fünf Finninnen zurück ist. Gut. Kann ich Licht anmachen. Ich ziehe mich um, lasse das Licht im Bad zur Orientierung für alle anderen an, lege mich ins Bett (blos nicht darüber nachdenken, wie siffig hier alles ist…) und als ich kurz vorm Einschlafen bin geht geräuschvoll die Tür auf und das Deckenlicht wird angeschaltet (so eine schicke Leuchtstoffröhre, die erst ein paarmal flackert, bevor sie grell vor sich hin scheint). Danke schön. Aber damit nicht genug. Obwohl es sich um ein reines Mädchenzimmer handelt (zum ersten Mal seit langem bin ich in soetwas gelandet), höre ich sowohl weibliche, als auch männliche Stimmen darüber diskutieren, ob es sich bei mir denn um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Ich grinse in mich hinein und stelle fest, dass ich das – obwohl angeblich frisch gewaschene – unglaublich nach Fremdschweiß riechende Laken offensichtlich so um mich gewickelt habe, das keine verräterischen Körperteile herausgucken, sondern nur mein Kopf. Und dann ist ja alles klar: Kurze Haare, das muss ein Junge sein. War ja schon im Kindergarten so. Als die Diskussion nicht aufhört überlege ich kurz, ob ich das Laken doch lüfte, bevor ich mich endgültig entschieden habe beenden sie das Gespräch dann aber doch und die Finninnen und Begleiter entscheiden sich für eine wahllose Aufteilung auf Betten und Aufenthaltsraum. Das Licht geht noch 3-5 Mal an und aus, die Türe wird noch öfter geöffnet und geschlossen, ich höre Dinge, die ich nicht hören will aber der eigentliche Grund, warum ich nicht schlafen kann ist wohl, dass ich in dieser Nacht das Hostelleben wirklich verfluche. Hätte ich doch einfach mal meine Klappe gehalten… oder wenigstens auf Holz geklopft… Am nächsten Tag erwartet mich ein weiteres Wiedersehen, denn auch Dhiren, „der Inder“, den ich aus Sydney kenne wohnt hier. Er verfügt über einen wunderbaren Teenager-Humor, weshalb der ganze Tag relativ albern wird. Alles beginnt mit einer kleinen Tour durch die Stadt (leider macht auch er sich als Guide nicht wirklich gut…) und als wir einen Straßenkünstler sehen, der Kunststücke mit zwei Glaskugeln vollführt, begehe ich den Fehler zu sagen „guck mal, ein Typ der mit Bällen spielt.“ Ich sage nicht mal „mit seinen Bällen“, aber für Dhiren reicht es zum Kichern. Und zwar nicht nur in diesem Moment, sondern für den Rest des Tages, wann auch immer irgendwer „Ball“ sagt, kann er sich kaum mehr halten. Und ratet mal, was wir am Nachmittag machen? Richtig. Wir gehen zu den Australian Open. Tennis gucken… So ein Turnier ist schon spannend mitzuerleben, wobei wir keine Karten für den Centre Court sondern günstige Tagestickets hatten, mit denen wir uns den gesamten Tag auf dem Gelände aufhalten und kleine Matches ansehen konnten. Irgendwie zieht es uns meist zu den „Mixed“- Begegnungen. So hat jeder etwas zu gucken. Allerdings fällt es uns ziemlich schwer, uns auf ein Team zu einigen, für das wir uns freuen. Entweder sieht die Frau gut aus und der Mann ist hässlich, oder der Mann ist attraktiv und die Frau nicht. Rüschenröckchen bei Frauen scheiden ohnehin schonmal aus, da hilft auch ein extrem gut gebauter Spielpartner nicht… es ist wirklich nicht einfach. Einmal sind beide relativ ansprechend, wir uns aber schnell einig, dass wir unmöglich für eine Mannschaft sein können, in der Einer Rot trägt und die Andere Pink. So sind wir im Zweifelsfall einfach für die Australier, von wegen Stimmung. Und Stimmung und Jubeln und Schreien… das können sie, die Aussies. Der Abend beginnt dann wie ein schlechter Witz: „Ein südafrikanischer Hindu mit indischem Backround, eine deutsche Katholikin und eine Gruppe Juden gehen in eine Cider-Bar…“ Diesen Satz wollte ich schon immer einmal schreiben, stelle ich in diesem Moment fest. Eine Pointe gibt es allerdings nicht, denn es war wirklich einfach nur ein schöner Abend mit lustigen Menschen, die es aus allen möglichen Flecken dieser Erde nach Melbourne gespült hat… unglaublich offene Menschen, mit denen Unterhaltungen über Gott und die Welt wirklich leicht fallen. Und das alles in einer weiteren schönen Bar, die halb Dachterrasse und halb Innenraum ist… Schade eigentlich, dass ich morgen schon wieder weiter ziehe.
Tasmanien. Wieder so ein Fleckchen Erde über das ich keine konkrete Vorstellung habe, das ich aber unbedingt sehen möchte. Allein schon wegen des Namens und der in diesem Zusammenhang stehenden Teufel. Würde Amazon.com Länder verkaufen, stünde unter meinem Profil wohl der Satz „Menschen, die Neuseeland mögen, interessieren sich auch Tasmanien…“. So lautet zumindest die Meinung der anderen Reisenden, die ich bisher so getroffen habe. Also los. Nach einem kurzen, unspektakulären Zwischenstopp in Hobart geht es nach Bicheno, einem ziemlich kleinen Nest mit einer Aussicht… wow. Der Sand an dem kleinen Strand ist unglaublich fein. Sowas hab ich noch nie gesehen, ungefähr so wie der Zucker, den ich gerne mal versehentlich kaufe, wenn ich eigentlich Puderzucker haben möchte. Wisst ihr was ich meine? Er ist so fein, dass ich mich nicht nur wie gehabt schon beim ersten Betreten in ein Schnitzel verwandle, nein, er legt sich sogar um die Härchen auf meinen Armen und verwandelt diese quasi in Minischnitzelchen. Nee, das klingt jetzt wirklich eklig. Aber vielleicht dient das Bild der Erklärung. Hinter diesen feinen Körnchen steckt wirklich mehr Arbeit als sieben mal sieben… Und so verbringe ich einen faulen Tag am Strand und der näheren Umgebung, mache alberne Fotos und freue mich darauf das zu sehen, was als „sehenswerte Flecken“ in meinem Reiseführer beschrieben ist. Am nächsten Tag fahre ich daher mit einem lokalen Bus zum Freycinet Nationalpark. Meineserachtens sollte man den allerdings in „Freixenet“ umbenennen, bekannt ist der Park nämlich für die „Weinglas Bay“ Und wer jetzt meint, klugscheißern zu müssen: Das Unternehmen stellt nicht nur Sekt, sondern auch Wein her. Aber genug davon. Die Weinglas Bay ist… nunja… ein halbrunder Strand, der von oben verdammt hübsch aussehen soll. Dort kann man wandern gehen und das habe auch ich vor. Zu schade, dass es in meinem Hostel außer mir niemanden zu geben scheint und ich mich alleine auf den Weg machen muss. Aber wieder einmal ist das Glück mit mir und so treffe ich im Bus Egne aus Lettland und Monika aus Polen. Und wo wir schonmal alle das gleiche Ziel haben, laufen wir auch zusammen los. Die Landschaft hält tatsächlich, was sämtliche Beschreibungen versprechen und – wie schon in Neuseeland – scheint es egal zu sein, wo man hinblickt… irgendwie ist es immer schön. Ich bin doch sehr beruhigt, dass ich nicht wieder so enttäuscht werde, wie in den Blue Mountains (von denen ich nach wie vor Gutes höre… vielleicht wäre mit dem Auto hinfahren und abgelegene Ecken suchen doch eine gute Idee gewesen…) Hinzu kommt, dass ich mit Egne und Monika wieder einmal etwas „ältere“ Mitreisende gefunden habe, die wie ich ziemlich lange und in verschiedenen Ländern unterwegs sind. Schon spannend zu hören, wo sich unsere Reiseerfahrungen unterscheiden und überschneiden. Irgendwie gibt es doch immer sehr viele Parallelen und so verbringe ich einen rund herum schönen Wandertag, bevor es wieder nach Bicheno zurück geht und Trudi ihr wohlverdientes Bad bekommt. Nachdem Chris (der sie ja schon aus den Rockies kennt) die Gute in Melbourne mit „Mensch Trudi… du hast aber auch schon bessere Zeiten gesehen!“ begrüßt hat, war ich zuerst an Schweinesstelle beleidigt und habe ihr dann eine ordentliche Wäsche versprochen. So einfach es auch ist, einen Weg in das süße kleine Nest namens Bicheno zu finden, es wieder zu verlassen ist nicht so einfach. Diverse Bequemlichkeiten des 21. Jahrhunderts sind in dem drei Straßen umfassenden Dorf noch nicht so wirklich angekommen. Und damit meine ich so etwas wie überall verfügbares Internet und Mobiltelefone. Dafür gibt es aber noch Mittagspausen und frühe Ladenschlusszeiten… Irgendwann finde ich zum Glück ein Restaurant mit einem alten Computer in der Ecke und diversen Essensresten auf der Tastatur… ok, das sollte reichen, um einen Bus zu buchen und die nächste Unterkunft zu reservieren… nein, doch nicht, die wollen eine telefonische Bestätigung. Ja danke. Mein australisches Handy funktioniert hier leider nicht. Und Busverbindungen aus dieser Region sind online auch nicht einsehbar… so müssen sich die frühen 90er angefühlt haben… streng dich an, Anna… du kannst bestimmt noch so denken… Vielleicht kann mir die Touristeninformation weiter helfen… ach nee, die hat Mittagspause, aber irgendwann sollte die auch wieder aufmachen. So genau nimmt man es hier mit den Pausenzeiten offensichtlich nicht… gut. Dann eben warten… endlich bekomme ich Informationen, den Bus der Gesellschaft, die ich benötige, kann ich aber dort nicht buchen. Das muss ich telefonisch machen… ok… Handy geht nicht, in meinem Hostel gibt es kein Telefon… zum Glück kennt die Dame in der Touri-Info die öffentliche Telefonzelle des Ortes und verrät mir, wie ich sie finde. Gut. Jetzt muss ich noch irgendwoher Kleingeld bekommen. Besser schnell, bevor der Laden zumacht… Wasser brauche ich ohnehin auch noch und irgendwas zum Essen… War das Leben früher (vor 10 Jahren) wirklich so kompliziert, war man besser organisiert oder funktionierte es da einfach besser, weil keiner davon ausging, dass man zu jedem Zeitpunkt überall Infos aus dem Netz bekommt und mal eben anrufen kann? Außerdem habe ich mich dran gewöhnt, dass Supermärkte quasi immer offen haben… Ich muss gestehen, dass ich schon ziemlich froh bin, erst 1980 und nicht ein Jahrzehnt früher geboren worden zu sein.. und das nicht nur, weil ich eine Jugend ohne Schulterpolster erleben durfte! Sichtlich amüsiert von meiner Inkompetenz in der Vergangenheit zu leben, gehe ich meine organisatorischen Aufgaben Stück für Stück an, besorge Nahrungsmittel und damit Kleingeld, reserviere mir ein Zimmer und spreche auf den Anrufbeantworter des Busunternehmers. Der hat nämlich entgegen der Uhrzeiten im Ansagetext bereits Feierabend. Auch schön… Gut. Jetzt kann ich wohl nur noch hoffen, dass ich am nächsten Morgen noch einen Platz im Bus nach Launceston finde. Auch, wenn das ohne Reservierung angeblich nicht möglich ist. Notfalls muss ich eben doch noch eine Nacht in hier bleiben. Wann macht nochmal das Café auf, dass die Rezeption meines Hostels übernommen hat und am anderen Ende des Ortes liegt? Wird schon. Bisher ging ja auch immer alles gut und so wirklich beunruhigend finde ich es auch gar nicht. Warum auch? So stehe ich extra früh auf, packe meinen Rucksack, finde einen Kaffee (zumindest der ist 21. Jahrhundert) und… was soll ich sagen… ich habe Glück. Im Bus ist noch Platz und außerdem haben auch Egne und Monika das gleiche Ziel.
In Launceston verdrückt sich Egne relativ schnell, weil sie müde ist… komisch, dass ich sie kurze Zeit später mit einem Typen sehe, den sich offensichtlich „besser zu kennen“ scheint. Nun gut… Auch ältere Menschen können sich offensichtlich wie Teenager verhalten. Kann ich auch. Also verstecke ich mich auf der Couch und tue so, als würde ich sie auch nicht sehen. Wie gut, dass mich mein Gekicher nicht verrät… So ziehe ich mit Monika los und wir machen uns auf zum „Cataract Gorge“, DER Touristenattraktion der Stadt. Und irgendwas machen wir falsch, denn der Weg führt uns konstant bergauf, viel weiter bergauf, als wir später wieder bergab gehen, denn selbst beim Rückweg laufen wir wieder bergauf… Das klingt jetzt vielleicht seltsam und das ist es in gewisser Weise auch, hauptsächlich ist es aber anstrengend und ich bin froh, dass in Tasmanien allgemein ein gemäßigtes Klima herrscht… Außerdem schauen uns diverse Einwohner seltsam an und das nicht nur, wenn wir in ihren Hauseingängen und Hofeinfahrten landen… soll sich halt mal jemand für eine gescheite Beschilderung einsetzen… aber, was lange währt und so… wir finden der/ die/ das Gorge und damit auch gleich einen ziemlich schönen, öffentlichen und kostenfreien Swimmingpool (zu dumm, dass wir keine Badesachen mithaben), eine nette Aussicht und ein Eis. Der Weg hat sich gelohnt. Hatte ich schon erwähnt das mein Leben unglaublich hart ist? Darüber hinaus ist Launceston eine durchschnittliche, mittelgroße Stadt mit diversen nicht wirklich aufregenden Geschäften und wenigen WiFi-Optionen. Dafür gibt’s aber Wein aus Tasmanien… Und wir sind ja schließlich nicht zum Shoppen hier. Es ist vielmehr ein Zwischenstopp auf dem Weg zum nächsten Nationalpark: Dem Cradle Mountain – Lake St. Claire National Park. Wieder einmal ist meine Sorge vollkommen unbegründet, dass ich alleine wandern gehen müsste, denn mit Monika habe ich eine Mitreisende gefunden, die ähnliche Interessen an den Tag legt und die selben Ziele bereisen möchte. Und so bringt uns am nächsten Tag ein Bus in den Cradle Mountain National Park. Nur das Wetter könnte uns jetzt noch so richtig einen Strich durch die Rechnung machen… Die Regenwahrscheinlichkeit ist hier nämlich riesig, irgendwas in Richtung 7 von 10 Tage Regen und darüber hinaus gerne mal grauer Himmel und Wolken… aber ich glaube ja schließlich fest daran, ein Sonnenkind zu sein… oder wie war das… unnormales Wetter herauszufordern… Cradle Mountain ist ein möglicher Startpunkt für den „Overland Track“, einer der bekanntesten Australischen „Bushwalks“, dauert gewöhnlich 5-6 Tage und nach meiner durchaus positiven Erfahrung mit dem Routeburn Track in Neuseeland habe ich tatsächlich eine Zeitlang mit dem Gedanken gespielt, mich auch diesem Abenteuer hinzugeben. Aber dafür hätte ich wirklich jemanden gebraucht, der mitkommt und sowas braucht ein Weilchen Vorlauf. Direkt nach unserer Ankunft begrüßt uns ein Echidna. Eines der lustigen australischen Säugetiere, die Eier legen. Sowas gibt es außer in Australien nur in Neuguinea und somit ist es vollkommen schwachsinnig, in Europa nach der eierlegenden Wollmilchsau zu suchen. Aber das nur am Rande. Echidnas sehen von nahem aus wie Igel mit lustigen langen Nasen, von weitem, wenn sie über die Straße laufen, aber eher wie winzig, winzig kleine Elefanten. Finde ich. Und das Gegenteil könnt ihr mir gerne beweisen, wenn ihr mal welche seht. Passiert nämlich nicht ganz so oft und so ist der Tag bereits gerettet und auch die unfreundliche Dame an der Rezeption kann uns nicht allzulange erschüttern. Wieder ein Tier, das ich beim „Wildlife-Bingo“ abhaken kann. Aber auch sonst ist der Park einfach unglaublich. Als wir mit dem Shuttle zu den Startpunkten der Wanderwege fahren (alles bestens organisiert!) bleibt mir fast die Spucke weg. Wir fahren durch eine Landschaft, die ich nicht anders, als als „Zauberwald“ beschreiben kann. Unglaubliche Farben und Formen aus Moos, Bäumen und Baumresten. Es ist so unglaublich schön, dass ich vergessen zumindest einen Versuch zu wagen, es auf Foto zu bannen. Am nächsten Tag muss ich feststellen, dass zusätzlich auch das Licht das Seine dazu beigetragen hat, einen so umwerfenden Anblick zu fabrizieren. Leider ist es nicht mehr ganz so schön. Aber ich habe ein Gedächtnisfoto und wenn ich mal ein Bild für einen Zauberwald brauche, hole ich es hervor. Elfen und Zwerge gibt es übrigens nicht. Oder sie haben sich gut versteckt. Da wir heute nur einen halben Tag zur Verfügung haben, entscheiden wir uns für eine Wanderung zu „Marion’s Lookout“. Diese beginnt mit einem wunderbaren Blick auf „Cradle Mountain“. Der heißt so, weil er aussieht wie eine Wiege in der ein Baby liegt. Schaut mal auf die Bilder. Wenn man es weiß, sieht man es auch. Und dieses scheiß Baby verfolgt uns… die ganze Zeit… Wir laufen um den See herum, sehen den Berg also aus einem ganz anderen Blickwinkel und das Kind guckt uns immer noch an. Selbst, als wir auf einen benachbarten Berg klettern, schaut es uns noch nach… das ist wirklich irgendwie gruselig… und wenn man erst mal drauf achtet… natürlich schafft es nicht mal eine gehörige Portion Verfolgungswahn, uns vom Genus dieser unglaublichen Landschaft abzulenken. Genau wie in Neuseeland ist es auch hier wieder so, dass man mit verbundenen Augen eine Einwegkamera in einer beliebigen Richtung auslösen könnte und man hätte ein grandioses Foto. Und natürlich scheint die Sonne. Kurz vor Ende unserer Wanderung wartet der Park dann noch mit einer Überraschung auf uns: Wombats!!! Diese Viecher sind dermaßen niedlich, dass ich die von mir so hochverehrten Tapire spontan auf Platz zwei auf der Liste meiner Lieblingstiere verbanne. Wombats sind unglaublich schwer wirkende Fellknäuel, die vermutlich „plopp“ machen, wenn man sie fallen lässt. Trotzdem können sie bis zu 40 km/h schnell rennen. Die beiden Wombats, die wir sehen sind nicht wirklich scheu, anders lässt sich wohl nicht erklären, warum der eine sich in aller Seelenruhe an dem Holzweg schubbert, auf dem diverse Wanderer herumlaufen. Trotzdem lassen sie sich wohl nicht so gerne beobachten, denn als der andere bemerkt, dass ich ihn ansehe, steckt er seinen Kopf kurzerhand in einen Grasbüschel. Frei nach dem Motto „Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht!“ Tue ich aber. Und du bist so süß!!! Für unseren zweiten Tag im Park lassen wir uns im Parkbüro beraten, welche Route wir nehmen sollten. Eine unglaublich nette Dame in Nonnetracht spricht eine ganze Weile mit uns, bis wir wissen, was wir wollen und sie uns zustimmt, dass das ein guter Weg für uns ist. Und so gehen wir los. Diesmal umrunden wir den See in die andere Richtung, dann geht es bergauf… Aussichten, für die ich wieder einmal neue Worte beantragen muss. Kleine Seen, orangefarbenes Wasser und hatte ich bereits erwähnt, dass das Wetter auch an diesem Tag wieder ziemlich gut ist? Nicht ganz so sonnig und etwas bewölkt, aber nach Regen sieht es nicht aus. Auf der ersten Anhöhe erwischt uns dann ordentlich Wind. So ordentlich, dass ich mich dagegenlehen kann. Sieht man auf dem Foto aber net. Doof. War trotzdem lustig. Irgendwann stehen wir dann vor Wegweisern, die uns nicht mehr weiter bringen (das Problem hatten wir gestern schon mal… da waren Wege nämlich plötzlich gesperrt), weil sie keinen der Wege benennen, die wir gehen möchten. Keine Richtung, keinen Zwischenstopp, gar nichts. Nach kurzer Diskussion entscheiden wir uns für einen Weg, den wir verfolgen, bis wir an einer Hütte sind, was nach ca. einer Stunde der Fall ist. In der Hütte könnte man übernachten, nicht ganz so schick wie in Neuseeland, aber durchaus idyllisch. Hier gibt es auch eine Karte des Parks und wir stellen fest, dass wir uns ganz offensichtlich für den falschen Weg entschieden haben. Ok… wir haben noch ein paar Stunden, bis es dunkel wird. Wenn wir jetzt also zurückgehen und dann dort und dort lang, sollten wir eigentlich wieder früh genug am See herauskommen. Also laut Plan. Unsere Desorientierung liegt wohl hauptsächlich darin, dass ich den Namen einer Hütte für den eines Weges gehalten habe (gleicher Name, unterschiedliche Richtungen) und Monika der festen Überzeugung war, dass unser Weg hinter dem Berg entlang geht, was mich zwar stutzig gemacht hat, aber sicher war ich mir wirklich nicht. Es war auch nicht so. Also zurück und auf einen anderen Weg. Dieser ist zwar richtig, aber dafür auch… sagen wir…. abenteuerlich. Wir befinden uns auf einem Wanderweg, den uns eine in die Jahre gekommene, extrem freundliche Nonne empfohlen hat. Das nur nochmal zur Info. Umso mehr erstaunt es uns, dass wir ernsthaft Felsen hochklettern müssen. Naja, besser hoch als runter, denken wir uns…. bevor wir einen ähnlichen Weg wieder herunter müssen… Hin und wieder kommen uns andere Wanderer entgegen. Wir sind wirklich richtig. Es ist einfach nur eine Herausforderung… und zwar eine, die wieder durch gigantische Aussichten belohnt wird. Es geht bergauf und bergab, felsauf und felsab und wir wissen, warum wir es tun: Einfach nur, um die Natur zu genießen und das ist wirklich einfach. Nach ein paar Stunden wird der Weg dann dafür umso einfacher, denn direkt am See ist der Wanderweg fast rollstuhlgerecht. Es fühlt sich seltsam an, wieder dermaßen festen Boden unter den Füßen zu haben… Dreckig, hungrig und müde kommen wir wieder im Hostel an. Wir waren doch ein bisschen länger unterwegs, als wir eigentlich wollten. Schnell unter die Dusche und was Essen… nach so viel Spielen an der frischen Luft, fällt es uns schwer, meine eiserne Regel des „nicht vor 22.00 Uhr ins Bett Gehens“ einzuhalten. Kurzerhand verstoßen wir dagegen… Am nächsten Morgen regnet es in Strömen. Selten haben ich mich so über Regen gefreut, bzw. darüber, dass er zum richtigen Zeitpunkt kommt. Nach zwei wunderschönen Tagen, die wir zum Wandern nutzen konnten, erwartet uns heute ohnehin ein Tag im Bus. Die perfekte Beschäftigung für schlechtes Wetter… an dieser Stelle möchte ich mich daher offiziell dafür entschuldigen, dass ich für den Geschmack derer, die heute wandern möchten vielleicht etwas zu gut gelaunt daherkomme… Ach ja… Tasmanische Teufel habe ich natürlich nicht gesehen… wäre wohl auch zu viel des Guten gewesen… so viel Glück haben wirklich die Wenigsten… Aber allein die Wombats hätten mich schon glücklich gemacht, wäre nicht alles andere auch so unglaublich schön. Und was glaubt ihr, wer nochmal auftaucht um uns zu verabschieden? Richtig. Unser Echidna.
Kennt ihr das, dass man etwas plant und sich nachher fragt, warum eigentlich? So geht es mir, als ich in Tasmanien bin, meine weitere Reise plane und erst nach einiger Zeit feststelle, das es überhaupt keinen Sinn macht von Tasmanien sofort auf Great Ocean Road Tour zu gehen. Ich Lande ohnehin in Melbourne und warum bitteschön sollte die Stadt, die mir bisher am besten gefällt auch die sein, in der ich am wenigsten Zeit verbringe? Nach ausgiebigem Zweifeln an meinem eigenen Verstand gönne ich mir so noch ein paar Tage in der wunderschönen Stadt, die an einem zugegebenermaßen fiesen, stinkigen Fluß liegt. Seit über einem halben Jahr schlafe ich nun in Hoselbetten unterschiedlichster Minderqualitäten, hatte bisher aber tatsächlich Glück, ziemlich gut in sämtliche Liegemulden hineinzupassen. Irgendwann musste es aber ja auch mit diesem Glück einmal zu Ende gehen und so plagen mich fiese Rückenschmerzen, weil offensichtlich Menschen, die nicht meine Größe hatten, mein Bett in Hobart vorgeformt haben. Irgendwie hab ich mir also irgendwas irgendwo eingeklemmt, wo es nicht hingehört und so verschreibe ich mir selbst einen Tag im Schwimmbad inkl. SPA-Bereich. Das alte Stadtbad in Melbourne ist vor allem von Außen wirklich sehenswert. Innen ist es ein Pool, ein Whirlpool und eine Sauna, eher funktional als ästhetisch, eher alt als luxuriös. Aber ich bin ja nicht zum Spaß hier sondern verfolge einen therapeutischen Zweck. Also tue ich erst etwas für mein Gewissen und schwimme ein Stündchen, bevor ich dann darauf hoffe, dass der warme Pool, die Massagedüsen und die Sauna meine Muskeln so entspannen und ich mich wieder in alle Richtungen bewegen kann… Es fasziniert mich doch immer wieder, wie ich mich selbst von meiner eigenen Naivität überzeugen kann, denn natürlich bringt es überhaupt nichts. Also suche ich nach weiteren Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, die mir in dieser Situation behilflich sein könnten… In Krakau hatte ich schon mal ein ähnliches Problem… damals verschwand der Schmerz nach einer Nacht auf einem unbequemen Sitz in einem ruckeligen Zug nach Budapest… wie gut, dass Melbourne eine kostenlose Straßenbahn hat… das ist ein Versuch wert. Aber bevor ich mich dem zweiten Therapie-Versuch hingeben kann, muss ich etwas gegen meine stets drohende Dehydrierung tun und gehe zu Aldi, der ist nämlich gleich um die Ecke. Kaum habe ich den Laden betreten, passiert, was irgendwie immer geschieht, wenn ich hier in Australien in dem Lebensmitteldiscounter ungefähr bei den Süßigkeiten angekommen bin. Hinter mir kommen zwei, meist blonde Mädels um die 20 in das Geschäft und geraten urplötzlich in Ekstase, sobald sie das Produktangebot sehen. Leise und nur für mich selbst, zähle ich von drei Rückwärts und da ist er auch schon, der Satz, der mich fast zur Weißglut bringt: „Ohhhhhh, hier fühlt man sich ja gleich wie zu Hause!“ Mädels… wenn ihr ohne Gummibärchen nicht leben könnt, dann verlasst halt net das Land!!! Und vergesst es… gescheites Brot gibt’s auch hier nicht. Sobald ich meinen kleinen Ausbruch wieder unter Kontrolle und meine drohende Dehydrierung bekämpft habe, geht es dann also in die Straßenbahn. Diese fährt mich geduldig im Kreis um die Innenstadt und eine monotone Stimme erzählt mir auch gleich noch etwas über die Geschichte. So bin ich wenigstens etwas gebildeter, als ich – natürlich noch immer mit Rückenschmerzen – aus der Bahn steige. Am Abend treffe ich mich mit Chris und wir gehen auf den viel gepriesenen Nachtmarkt am Queen Victoria Market. Der normale Obst-Gemüse-Souvenirmarkt hat mich trotz seines guten Rufs ja so gar nicht begeistert… Aber so viel Enthusiasmus von Seiten meiner Mitreisenden und diverser Reiseführer haben eine zweite Chance verdient ( und schließlich habe ich ja auch einige Jahre Oliven-Probieren gebraucht, bis ich sie endlich mochte). Schon nach wenigen Minuten ist mir klar, dass es eine gute Idee war, mir meinen eigenen Australier mitzubringen. Sonst würde ich hier nämlich keinen einzigen Einheimischen sehen… kein Wunder, dass er bisher noch nie hier war. Der gesamte Markt ist voll von Backpackern auf der Suche nach günstigem Essen und billigem Alkohol. Es gibt allerhand Souvenirs zu kaufen, die zu meinem Erstaunen tatsächlich über die Schnapsgläser, Geschirrhandtücher und Schlüsselanhänger hinausgehen, die man sonst überall (und damit meine ich sämtliche Länder und Städte in denen ich bereits war) findet. Dafür singt ein Asiate irgendeine Schnulze. Diesen Auftritt kann man mit viel Wohlwollen allenfalls „mutig“ nennen… mein Versuch den Begriff „fremdschämen“ ins englische zu übersetzen scheitert kläglich… schade eigentlich… ist doch so ein schönes Wort… zu dumm, dass mir jedesmal ein Schmerz durch den Rücken fährt, wenn ich lache. Auch wir suchen uns etwas zum Essen (abgesehen von australischer Küche kann man hier wirklich alles bekommen) und verlassen dann schnellstmöglich das Marktgelände in Richtung Fitzroy, einem Stadtteil, den ich bisher noch nicht gesehen habe, der mir aber zugegebenermaßen ziemlich gut gefällt. Auch hier gibt es wieder nette Kneipen, Bars und Cafés… der „Lonely Planet“ hat Recht: in dieser Stadt geht es wirklich hauptsächlich um Essen und Trinken. Vor einigen Jahren wollte Starbucks hier eine Filiale aufmachen, woraufhin die Einwohner protestiert haben, aus (begründeter) Furcht, dadurch könnte die Café-Kultur zerstört werden. Was soll ich sagen… es gibt nach wie vor keinen Ableger der amerikanischen Kaffee-Kette… Auf dem Nachhauseweg (oder sollte ich sagen Nachhostelweg?) sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben Possums in freier Wildbahn. Mann sind die süß!!!! Nachtaktiv, wie sie nunmal sind, tummeln sie sich in den Bäumen und starren einen mit Riesenaugen an. Irgendwie hat dieser Kontinent einfach unglaublich viele niedlich-lustige Tiere. Das gleicht fast wieder aus, dass einen die andere Hälfte mal eben um die Ecke bringen könnte… vielleicht hätte ich doch nicht Bill Brysons „Frühstück mit den Kängurus“ lesen sollen. Der Gute gerät nämlich wegen all der lebensgefährlichen Viecher ziemlich in Panik und beschreibt es mit einem solchen Humor, dass ich ebenfalls über eine übertriebene Angst nachdenke. Aber ich bin in einer Stadt und da es nicht Sydney ist (dort gibt es die giftigste aller Spinnen), kann ich doch beruhigt schlafen gehen. Am nächsten Tag schaffe ich es dann endlich, mich mit Aafke zu treffen, der Holländerin, die ich aus Neuseeland kenne. Seit Christchurch haben wir beide einiges gesehen und erlebt und so dauert es einige übergroße Heißgetränke lang, bis wir uns über sämtliche Neuigkeiten ausgetauscht haben. Irgendwie lustig wenn man eine Zeit lang zusammen gereist ist, also ein gewisses Vorwissen hat und man sich dann Monate später wieder trifft und die „Lücken“ füllt. Aafke hat das zweite Beben in Christchurch miterlebt (das über Weihnachten), weil ihr (ausgerechnet in Neuseeland) ihr Rucksack mitsamt Reisepass geklaut wurde und sie nicht wie geplant nach Australien reisen konnte. Wegen dieser Planänderung war sie dafür dann nicht in Queensland, als die Flut kam… schon komisch, wie das Leben manchmal so spielt. Auf der Suche nach einer angemessenen Abendgestaltung stolpere ich dann über ein Filmprojekt im „Australian Centre of the Moving Image“. Vier Personen ziehen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn mit jeweils einer Kamera los, nutzen die Stadt als Kulisse und Passanten als Statisten. Vorgeführt werden dann alle vier Filme parallel und es wird live entschieden, welcher Ton wann zu hören ist, wo es Musik gibt etc. Ich finde, das klingt spannend, kann aber leider niemanden davon überzeugen, sich mit mir auf dieses Kinoerlebnis einzulassen (und dabei hatte ich mich doch so gefreut in einer Stadt zu sein, in der ich Menschen kenne) und gehe alleine hin. Ziemlich genau auf der Mitte des Weges zwischen Hostel und Kino, fängt es plötzlich an zu regnen. Ich habe Glück und kann mich durch einen geschickten Sprung gerade noch in die überdachte Einfahrt eines Hotels retten, bevor der Himmel seine Schleusen öffnet und solche Wassermassen entlässt, wie ich es noch nie erlebt habe. So stehe ich eine Weile herum und starre in den Regen. Eine unglaublich romantische Situation, die ich da mal wieder mit mir selbst erlebe. In den ersten Minuten beobachte ich noch Menschen, die auf der Suche nach einem Unterschlupf durch den Regen rennen. Bereits nach kurzer Zeit rennt niemand mehr… wer jetzt noch draußen ist, ist ohnehin nass bis auf die Knochen. Zum Glück hört der Regen irgendwann auf (wenn man sich in einem Land befindet, das zum Teil überschwemmt ist, beschleicht einen nach der Romantik doch irgendwann eine dezente Panik, wenn man so einen Regen sieht) und ich kann meinen Weg zum Kino fortsetzen. Die Vorstellung beginnt damit, dass wir (die Zuschauer), die vier Schauspieler, die nur Unterwäsche tragen, im Treppenhaus mit Wunderkerzen und allerhand Lärm begrüßen und somit Teil der letzten Szene des Films sind. Danach geht’s in den Kinosaal und schnell wird mir klar, warum mir das Konzept irgendwie bekannt vorkam. Die Gruppe ist zwar international, ihr Ursprung aber liegt in München und Berlin. So gut mir die Idee auch gefällt, der Film an sich ist nicht so spannend… die Schauspieler haben das wohl schon zu oft gemacht… irgendwie fehlt die Spannung. Schade, es hätte so schön sein können… Irgendwie frustriert mich das…Vielleicht hätte ich doch lieber irgendwas anderes tun sollen, statt alleine ins Kino zu gehen, um mir ein Experiment anzusehen, das mich nicht vom Hocker reißt… und so wirklich günstig war es auch nicht… Auf dem Weg ins Hostel regnet es natürlich noch wieder und ich kaufe mir einen riesigen Keks und verfalle gerade so richtig schön in Selbstmitleid als ein Lastwagen neben mir durch eine Pfütze brettert und mir somit eine Dusche in Dreckwasser spendiert. Wer auch immer Drehbuchautor meines Lebens ist, mag offensichtlich die Klassiker. Und er weiß, dass er mich damit zum Lachen bringt. Melbourne ist eine dieser Städte, in denen man einfach nur herumgammeln und die Atmosphäre genießen kann. Alleine die Tatsache, dass es am „Federation Square“ (in alten europäischen Städten gibt es Marktplätze, die Aussies mussten sich extra einen zentralen Platz bauen) kostenloses Wi-Fi gibt, macht mich schon ziemlich glücklich und so verbringe ich unglaublich viel Zeit im Internet (weil ich’s kann) und bei kleinen, gemütlichen Spaziergängen. Außerdem besuche ich die National Gallery of Victory, ein unglaublich riesiges Kunstmuseum. Fast beeindruckender als die Bilder ist das Gebäude selbst… vor allem der Wasservorhang am Eingang… und natürlich weiche ich den kulinarischen Genüssen nicht aus, schließlich sind diese Teil der Stadt. Und so sitze ich an meinem letzten Tag am Ufer des unglaublich dreckigen Yarra River und trinke einen der hier so beliebten Fruchtshakes. Die Sonne scheint mir auf die Nase und der Straßenmusiker hinter mir spielt auf seiner Gitarre „Take Five“… Zum ersten Mal auf meiner Reise verspüre ich eine gewisse Wehmut, weil ich Melbourne schon morgen verlasse… ja… irgendwie hat sie mich gefangen, die Stadt, in der es aus einem mir nicht bekannten Grund Petersilie in den Blumenkästen vorm Rathaus gibt.
Auf, auf zu einem der Highlights australischer Landschaften. Glaub ich jetzt mal, schließlich gehört die Great Ocean Road zu den Gegenden, die man offensichtlich gesehen haben muss, wenn man dieses Land betritt. Das sagen alle. „Unser Inder“ hat mir eine Tour-Company empfohlen, mit der er unterwegs und von der er ziemlich begeistert war. Also buche auch ich dort und hoffe auf einige nette Mitreisende. Dominant in dem kleinen Bus sind zwei englische Kerls, die genauso sind, wie englische Kerls eben nunmal sind und weshalb ich ein gespaltenes Verhältnis zu Großbritannien habe. Außerdem zwei junge Kanadierinnen, die alles darauf setzten die beiden Kerls zu beeindrucken, die ihrerseits gar keinen Hehl daraus machen beeindruckt zu sein und selbst beeindrucken zu wollen (ich schätze mal, das ist der Grund für das Gockelgehabe). Außerdem gibt es noch ein paar Päärchen, ein Mädel, das eindeutig nach Ami aussieht und auch so klingt (in einer ruhigen Minute muss ich wirklich mal drüber nachdenken, gegen wen ich eigentlich keine Vorurteile habe), ein paar Menschen, die ich bereits vergessen habe und eine Chinesin mit ihrer Mutter. Mit den beiden habe ich auf den Bus gewartet und es war wirklich nett, aber diese Mutter-Tochter-Kombination hat wirklich etwas Seltsames… wisst ihr was ich meine, wenn ich davon spreche, dass man unterschwellig den Freiheitsdrang der Tochter nicht nur erahnen konnte? Der erste Streckenabschnitt der „Great Ocean Road“ haut mich nicht wirklich vom Hocker und langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich mir mit meiner Neuseelandreise wirklich so manchen Spaß vermiest habe… es ist halt eben wirklich schwierig etwas ähnlich Schönes zu finden. Naja, es ist ja erst der Anfang, außerdem bin ich müde und es kann ja nur besser werden… hoffentlich hält das Wetter! Oder wird am besten noch ein bissi schöner… ich mache doch so gerne Fotos mit blauem Himmel. Nicht zu Letzt um alle Daheimgebliebenen ein wenig neidisch zu machen… ist Winter gerade bei euch, oder? Ach ja… Februar… da ist es ja meist besonders grau und fies. Ja… eigentlich ist es doch recht schön hier. In der ersten Pause gibt’s Tee, Kaffee und Kekse. Da ist mir die Tour doch gleich noch viel angenehmer, soooo schwer ist es schließlich auch nicht, mich glücklich zu machen. Während ich also den ersten Coffein-Schub des Tages gegen meine Müdigkeit ankämpfen lasse, gesellt sich die Amerikanerin zu mir, die allerdings Italienerin (auch das noch!) ist. Schon nach einem kurzen Wortwechsel stellt sich aber heraus, dass Italienerinnen, die aussehen und reden als wären sie Amis fürchterlich nette Menschen sind, mit denen man sich unglaublich gut unterhalten kann. Wenn ich schon verallgemeinere, dann tue ich das doch hier gleich auch. Mit Alice jedenfalls verstehe ich mich auf Anhieb, schon alleine weil sie auch immer erklären muss, wo ihr Akzent her kommt und sie diese Frage in vielen Fällen nur noch gelangweilt beantwortet. Auch ich muss zugeben, dass ich kürzlich, als mich ein mir nicht gerade sympathischer Deutscher danach fragte, mit einem unterhaltungsverkürzenden „Weil ich ein Streber bin!“ geantwortet habe. Der Gute wollte bloß selbst ein Kompliment für sein Englisch bekommen. Seh ich ja gar nicht ein. Nachdem Alice und ich also, natürlich nicht ganz ironiefrei, sämtliche Fragen abgearbeitet haben, die man sich im täglichen Reise-Smalltalk so gegenseitig stellt, sind wir schnell bei Themen über Gott und die Welt angekommen. Ich freue mich, dass es nach den Tagen in Melbourne gleich wieder so weitergeht. Schließlich sind die sich ständig wiederholenden Unterhaltungen (denen man normalerweise aber auch nicht aus dem Weg gehen kann, wenn man jemanden gerade erst getroffen hat) unglaublich ermüdend. Vielleicht geht es hier in Australien auch mehr um meine Mitmenschen und deren Geschichten, als um schöne Aussichten und Sightseeing… dieser Gedanke ist es wert gedacht zu werden… und so sitzen wir im Minibus in der Reihe der Alleinreisenden hintereinander, sehen beide nach vorne (sich schlängelnde Küstenstraßen und nach hinten gucken mag mein Magen irgendwie nicht) und sind die einzigen im Bus die sich unterhalten. Naja, fast. Es gibt ja noch die Hühner und die Gockel. Schon bald kommen wir am „Highlight“ der Great Ocean Road an. Den „Zwölf Aposteln“ – Felsen, die aus dem Wasser gucken, bzw. eigentlich mal Eins mit der Landmasse waren, Wasser hat Löcher rein gespült, bis irgendwann nur noch die Stumpen im Wasser standen… nix Neues, wenn man in Neuseeland war. Außerdem sind es auch gar keine 12 mehr, weil das Meer natürlich nicht aufhört an dem Stein herumzuschubbern, nur weil mittlerweile der Tourismus erfunden wurde. So stürzen sie Stück für Stück ein und ich nenne sie aufgrund ihrer aktuellen Anzahl recht liebevoll „Sieben Zwerge“. Versteht mich nicht falsch. Schön ist die Landschaft hier schon. Sogar unglaublich schön. Einfach nur nicht so atemberaubend, dass ich naturverwöhntes Ding dafür neue Worte erfinden möchte. Außerdem sind es sowohl hier, als auch bei der London Bridge (eine ehemals brückenförmiger „Stein“ mit zwei Bögen) eher die Blicke in andere Richtungen, die mich faszinieren. Aber klar, ganz ohne Zweifel, es ist sehenswert. Wie die Sieben Zwerge, so hat auch die London Bridge noch einen Namen, der gar nicht mehr zu ihr passt. Sie ist nämlich gar keine Brücke mehr. Als sie vor einigen Jahren einstürzte war dummerweise noch ein Päärchen auf der Seite der Brücke, die nach Einbruch eines Bogens nicht mehr am Ufer hing. Passiert ist zum Glück niemandem etwas, das Päärchen wurde vom Hubschrauber eines Fernsehsenders gerettet, verweigerte später aber doch das eigentlich vereinbarte Interview, denn die beiden waren eigentlich Hälften anderer Päärchen… außerdem gibt es noch das Gerücht, dass sie auch gar keinen Urlaub hatten, sondern sich an dem Tag haben krank schreiben lassen… Als ich also an der „London Bridge“ stehe und über die Geschichte kichere (da hatte das Leben wirklich zu viel Zeit, einen Plan zu seinem eigenen Amüsement auszuhecken), höre ich plötzlich hinter mir eine bekannte Stimme, die mich auch noch anzusprechen scheint. Ich drehe mich um und sehe Freddy, einen Deutschen, der mit seiner Freundin in Neuseeland unterwegs war. Den beiden bin ich schon dort immer und immer wieder begegnet. Jetzt also auch in Australien. So wirklich groß kann diese Welt doch gar nicht sein. Oder ist es wirklich der Mangel an Statisten? Ich mag diese zufälligen Immerwiederbegegnungen einfach. Leider haben wir nicht wirklich Zeit, uns zu unterhalten, weil mein Bus sonst ohne mich wegfährt und ob ich das Glück habe im Notfall von einem Fernseh-Hubschrauber gerettet zu werden, wage ich zu bezweifeln.Vor allem weil ich mich ja vollkommen rechtens und ohne irgendetwas zu verheimlichen an der London Bridge aufhalte. Da hat das Leben nichts zum Lachen, das riskiere ich also mal lieber nicht. Die Nacht verbringen wir in einer Art Hostel im Irgendwo. Zumindest rede ich mir das ein, denn vermutlich ist es doch eher das Nirgendwo. Auf dem Weg dorthin wird es langsam dunkel und in unregelmäßigen Abständen hüpfen Kängurus über die Straße. Amy – unser Guide – lässt sich dadurch aber nur wenig aus der Ruhe bringen und erzählt, dass neben „Parken“ und „Durchfahren kleinster Lücken“ auch „Wie überfahre ich ein Känguru korrekt“ wichtiger Bestandteil der Ausbildung als Tourbusfahrer ist. Vermeiden kann man Kollisionen mit den Hüpftieren nämlich leider nicht, daher geht es eher darum, sie im Notfall so zu erwischen, dass sie gleich sterben. Die Wildtiernothilfe erreicht man so weit außerhalb nämlich oft nicht und daher ist sonst oft die „aktive Sterbehilfe“ mit Hilfe eines schweren Gegenstandes die einzige Möglichkeit, den Tieren weitere Qualen zu ersparen. Einen gewissen Pragmatismus kann man den Aussies nicht absprechen, aber mal ganz ehrlich… kann es vielleicht sein, dass dieses Land mit all seinen Tierchen vielleicht einfach nicht dafür gedacht ist vom Menschen besiedelt zu sein? Die Themen Hitze und Wüste mal ganz außen vorgelassen… Bei der Zimmereinteilung sind Alice und ich uns schnell einig, dass auf gar keinen Fall mit der Gockel-Hühner Truppe in einem Zimmer landen möchten, denn nach einem Tag Busfahren und im Freien spielen, sind wir hundemüde (wir sind ja auch keine 20 mehr) und die vier machen eher den Anschein auf Party auszusein. Ja, Leben. Ich sehe es ja ein. Du brauchst auch etwas zum Lachen. Natürlich landet genau diese Truppe in unserem Dorm. Wie lange und wie heftig sie noch im Aufenthaltsraum feiern, bekomme ich aber nicht mit. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich und in aller Form bei meinem guten Schlaf bedanken. Ein Geschenk von Mutter Natur über das ich noch nie so froh war, wie auf dieser Reise. Am nächsten Morgen dann können wir Kängurus aus etwas geringerer Entfernung beobachten. Auf einer Wiese lungern sie herum und… also…. so niedlich sie auch sind, wenn sie durch die Gegend hoppeln… sobald sie langsam gehen, sehen sie komisch aus, weil sie ihren Schwanz dann als quasi fünften Fuß mitbenutzen (das unterscheidet sie übrigens – neben der Größe – von den Wallabys) und das hat irgendwie was gebrechliches. Noch seltsamer allerdings sind liegende Kängurus. Schon mal gesehen? Ich hab noch nicht ganz die richtigen Worte gefunden, da höre ich Alice sagen „They look like old prostitutes!“ Volltreffer. Leider gelingt es mir nicht, ein gescheites Foto davon zu machen, aber wenn ihr mal irgendwo einem liegenden Känguru begegnet: Denkt an diese Zeilen! Den weiteren Tag verbringen wir dann damit, uns wiedereinmal eine Aussicht zu verdienen. Da der Nationalpark wegen Überschwemmung geschlossen ist (wer hat eigentlich behauptet, Australien wäre trocken?), gehen wir irgendwo anders hin. Amy macht die Tour auf diese Weise zum ersten Mal, aber als wir so auf dem Hügel sitzen und uns umschauen sind wir uns mit ihr einig: so ein bisschen Wandern sollte in jeder Tour enthalten sein. Dann kommt man aus dem Bus raus und kann wirklich richtig genießen, was man sieht. Dummerweise knickt Alice auf dem Rückweg um und muss unter Schmerzen zum Bus zurückhumpeln, während Amy nicht wirklich weiß, wie sie damit umgehen soll. Sollten Tour-Guides nicht auch auf so etwas vorbereitet sein (z.B. mit Kühlmittel und Verbandszeug) und nicht nur auf Begegnungen mit Kängurus? Also laufe ich bei nächster Gelegenheit zum Supermarkt und stehe vor der Frage „Eiswürfel oder Erbsen?“ Wieder eine Frage, die ich mir noch nie vorher gestellt habe. Ich entscheide mich für die Eiswürfel, Erbsen wären aber glaube ich auch nicht schlecht gewesen. Was ich in jedem Fall mal hätte lassen sollen, ist Obst für die Weiterreise kaufen. Nach kurzer Zeit im nachfolgenden Linienbus heißt es nämlich: Pause und danach dürfen weder Obst und Gemüse mit an Board. Wir sind kurz davor die Grenze von Victoria nach South Australia zu überqueren und die Australier sehen in einem Apfel, der von einem Staat zum anderen gebracht wird, ungefähr so viel Gefahrenpotential, wie die Amerikaner in einem Lippenpflegestift, der sich nicht in einer wiederverschließbaren Tüte von max. 1 Liter Fassungsvermögen befindet oder die Deutschen in einer Kofferbombe. Und so sieht man auf dem Rastplatz eine nicht genau definierte Menge junger Menschen, die massenweise Obst in sich hineinstopft, um es nicht wegwerfen zu müssen. Um nicht zu viel der gleichen Sorte verdrücken zu müssen, wird außerdem getauscht, verschenkt, gehandelt und schließlich leider doch einiges in die nächstgelegene Mülltonne befördert… Als kleinen Racheakt denke ich darüber nach, der nächsten Fruchtfliege mal zu erzählen, dass sie einfach auf die andere Seite der Grenze fliegen kann…
Natürlich gibt es einen Grund für meine Reise nach Adelaide und der ist, dass ich mit dem Zug durchs Outback nach Alice Springs fahren möchte. Eine der legendären Bahnreisen der Welt. Genannt „The Ghan“. Wenn ich schon nicht von West nach Ost oder umgekehrt durch den heißen Kontinent reise, dann doch wenigstens vom Süden in den Norden. Naja… halb. Von Adelaide bis Alice Springs dauert es ca. 21 Stunden, den Luxus eines Schlafwagens leiste ich mir selbstverständlich nicht. Alles wird angenehmer sein, als 40 Stunden Busfahrt mit meinen amerikanischen Freunden aus dem Knast. Zugfahren ist hier etwas anderes als zu Hause. Es ist irgendwie größer. Etwas Besonderes. Ein Erlebnis. Schon alleine weil man eine Stunde vor Abfahrt am Bahnhof sein muss (nichts für Menschen, die prinzipiell erst am Bahnsteig erscheinen, wenn der Zug bereits kurz vor Abfahrt ist (meinen Gruß an dieser Stelle ) und sein Gepäck einchecken muss. Wie beim Fliegen. Nur mit leichtem Handgepäck, Wasser und sonstiger Verpflegung (es gibt natürlich auch einen Speisewagen, aber der in Sachen Preis und Qualität – zumindest bei Backpackern – keinen guten Ruf) begibt man sich dann in den Zug. In der zweiten Klasse sind es Großraumabteile, die 1. Klasse ist angeblich extrem luxuriös, aber dort darf man nicht mal gucken gehen. Es gibt auch einen Wagen mit Internet, aber für diese Lounge muss man extra Eintritt zahlen… vielleicht kann ich meine Online-Sucht dann doch für kurze Zeit unter Kontrolle halten. Ich habe mal wieder Glück und zwei Sitze für mich. Bei meiner Größe und meinen langen Beinen durchaus angemessen, wie ich finde. Weniger erfreut bin ich über die Tatsache, dass doch tatsächlich schon wieder das halbe Abteil von Deutschen besetzt ist. Könnt ihr mir zu Hause mal einen Gefallen tun und aus dem Fenster sehen, ob überhaupt noch jemand in meiner Heimat ist? Wobei… wenn ich mal genauer hingucke war es vielleicht eine gute Idee, zu Hause mal ein wenig auszusortieren und einen Teil auf die andere Seite der Welt zu schicken… auch wenn ich normalerweise die Ideen der Engländer nicht unbedingt gut heiße. Schon nach kurzer Zeit habe ich ein ganz übles Exemplar (auch in Sachen Geruch) neben mir sitzen (leere Sitze sind irgendwie offensichtlich einladend) und bin unfreiwillig in eine Diskussion verstrickt, ob sich Reisende „Backpacker“ nennen dürfen, wenn sie nicht wissen, wie man einen Rucksack richtig einstellt und genug Geld haben, sich jeden Tag irgendetwas zu Essen zu besorgen, das über Toast mit Marmelade und Nudeln mit Tomatensoße hinaus geht… Ich finde, man muss auch nicht alles zu Grunde definieren, äußere meine Meinung auch, das Schlimme an solchen Dialogen aber ist ja, dass man gar nichts dazu beitragen muss, wenn man an die „richtige“ Person gerät. Diese hat dann nämlich eine feste Meinung, macht fix einen Monolog aus der Unterhaltung und man kann sich in Ruhe ein Käsebrot schmieren. Pumpernickel, keinen Toast. Vor mir sitzt ebenfalls eine Deutsche (sie isst Wraps mit Gemüse), die in Adelaide im gleichen Hostel gewohnt hat, wie ich. Allerdings haben wir uns dort nicht unterhalten, ich wollte ja niemanden kennenlernen. Im Zug dann aber schon und mit Conny hab ich auch wirklich eine gute Gesprächspartnerin gefunden, die mir die Fahrtzeit verkürzt und mich mit ihren Erzählungen dabei gleich auf meine Reise in Südost Asien einstimmt. Conny reist in genau umgekehrter Richtung, so dass wir irgendwann feststellen, dass sie einen Tag gewinnt. Ich hingegen habe ja zwischen Hawaii und Neuseeland den 4. November verloren und damit vielleicht meine einmalige Chance verpasst, die Liebe meines Lebens zu treffen. Da liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Conny an ihrem Zusatztag der Liebe ihres Lebens begegnet. Oder der Liebe meines Lebens? Natürlich müssen wir Kontaktdaten austauschen, wie ärgerlich wäre es denn, wenn sie meinen Traummann trifft und weiß dann nicht, wie sie mich kontaktieren soll? Mittlerweile weiß ich, dass es nicht der Fall war, aber zum Glück ist ihr auch nicht das für mich bestimmte Klavier auf den Kopf gefallen. Der Blick aus dem Zugfenster hat nicht viel Spektakuläres zu bieten. Roter Boden, grünes Gestrüpp. Hin und wieder kommt eine Durchsage, denn wenn wir an einem See oder Ähnlichem vorbeifahren sollten wir ja schon wissen, wie dieser gerade heißt. Der Zug ist für Touristen gedacht und nicht mehr wirklich eine Beförderungsoption für die Einheimischen. Viele Seen sehen wir natürlich nicht, wenn auch mehr als für gewöhnlich… hat schließlich ordentlich geregnet in der letzten Zeit… Irgendwann am Abend meldet sich dann der Zugführer noch ein letztes Mal und erklärt uns, dass wir uns noch im Australischen Bush befinden (das scheint mir so ziemlich alles zu sein, was keine Stadt ist und noch nicht Wüste), wenn wir morgen aufwachen, sind wir aber so richtig im Outback. Ich freue mich drauf und bin fast ein Wenig aufgeregt, als ich mich auf meinen Sitzen zusammenknäule um zu schlafen. Als ich wach werde schaue ich dann mit großer Erwartung aus dem Fenster und…. es sieht ganz genauso aus wie am Vortag. Roter Boden, grünes Gestrüpp. Das ist also diese Wüste, von der alle sprechen… ziemlich grün. Irgendwas habe ich da wohl missverstanden. Aber laut Zugführer ist dies das Outback… ok… ist in diesem Land denn gerade irgendetwas so wie immer? Von Conny erfahre ich, dass der Zug nachts eine ganze Weile stand, wenn man das bedenkt und die Tatsache, dass wir uns sonst im Schneckentempo fortbewegen, so hegt sich in mir doch die Vermutung, dass man die Strecke Adelaide – Alice Springs mit einem handelsüblichen ICE vermutlich in acht Stunden schafft. Wenn man einen ICE ohne Achsenschaden findet. Aber dann wäre es ja kein Erlebnis mehr. Ehrlich gesagt, so wirklich ist es das ohnehin nicht… Vielleicht gerade weil auch unser Zug keinen Schaden an der Achse hat… der versprochene Hauch von Abenteuer fehlt. Die Landschaft ist zweifelsohne wunderschön, wenn auch nicht gerade abwechslungsreich, Sonnenunter- und -aufgang waren schon sehr schön, aber in einem klimatisierten Zug mit zivilisierten Mitreisenden (der eine oder andere USA-Greyhound-Reisende würde da doch einen Unterschied machen) ist es halt doch eher ne Kaffee-Fahrt. Trotzdem bin ich froh, mich für’s Zugfahren entschieden zu haben. So kann ich die endlose Weite spüren, die dieses riesige Land mit sich bringt… meineserachtens verpasst man wirklich etwas, wenn man bei Reisen auf diesem Kontinent ausschließlich fliegt. Einzig mit einem Wohnwagen durchs Outback zu fahren könnte noch ähnlich, vielleicht sogar besser sein. Aber so viel Glück ich auch in sämtlichen anderen Belangen auf meiner Reise bisher hatte… Menschen, die mit einem ähnlichen Zeithorizont und ähnlichen Zielen wie ich reisen und dann noch den Anschein machen, als könnte ich sie und sie mich für mehr als ein paar Tage am Stück ertragen, sind mir leider in Australien noch nicht begegnet. Zur Verteidigung der Menschheit muss ich allerdings sagen, dass es hauptsächlich an geplanter Zeit und Richtung der weiteren Reise liegt.
Adelaide ist ein seltsamer Ort. Irgendwie… wie soll ich sagen… funktional. Die Stadt ist nicht schön, hat kein Flair, keine Bekanntheit für irgendetwas, man kann nicht wirklich etwas sehen oder erleben, abends ist sie wie ausgestorben… aber so wirklich schlimm ist es auch nicht. Ein idealer Ort, um einfach einmal nichts zu tun, ein Wenig zu schreiben, Kaffee zu trinken und über die Welt nachzudenken. Nicht, dass ich in den letzten Monaten sonderlich produktiv gewesen wäre, aber irgendwie gab es doch überall etwas zu sehen und zu erleben. In Adelaide ist das nicht wirklich der Fall. Hinzu kommt, dass es zwischenzeitlich dermaßen heftig regnet, dass ich kurz in Gedanken mein Adressbuch durchgehe. Würde ich jemanden kennen, der Noah heißt, befände ich mich jetzt mit Sicherheit in seiner Nähe, oder würde ihm zumindest eine SMS oder eine fürchterlich nette Email schicken, um in seiner Erinnerung einen präsenten Platz einzunehmen. Man weiß ja nie. Ich kenne aber keinen Noah, also halte ich mal besser meine Augen offen, für den Fall, dass ich irgendwo Tiere entdecke, die paarweise in irgendeine spezielle Richtung laufen… Wenn es denn mal nicht regnet, ist es so heiß und so schwül, dass ich schon beim Blinzeln ins Schwitzen gerate. Vielleicht trägt auch das zu meiner ausgeprägten Aktivitätslosigkeit bei (wobei ich mich irgendwann doch dazu aufraffe joggen zu gehen, als es mal etwas kühler ist). Zwar schaffe ich es noch, an einer Führung im Kunstmuseum teilzunehmen und beschäftige mich aus einer albernen Laune heraus ausgiebigst mit dem Selbstauslöser meiner Kamera, zu viel mehr kann ich mich dann aber doch nicht aufraffen. Außer auf dem Sofa meines wunderschönen Hostels festzuschwitzen und meinen Bildschirm anzustarren. Schon wieder neue Menschen kennenlernen mag ich nämlich gerade auch nicht. Lustigerweise treffe ich Alice wieder, die mit ihrer Familie (Mutter, Tante und Onkel) nun auf einer organisierten Tour durch Australien ist und daher gerade das Reisen von einer anderen als der Backpacker-Seite erlebt. So kann ich mich dann bei endlosen Chai Lattés doch noch mit jemandem unterhalten, ohne mich auf komplett Fremde einlassen zu müssen… Auf einem meiner zahlreichen Spaziergänge durch die Stadt stolpere ich über eine Platte im Gehweg, dir mich mit einigen statistischen Daten zu Adelaide versorgt. Unter anderem auch dem Fakt, dass die Erde hier 365 Tage und 5 Stunden braucht, um um die Sonne zu kreisen… Sollten wir dann nicht alle fünf Jahre ein Schaltjahr haben und nicht alle vier? Kann mir das jemand erklären? Trotz ausführlicher Google-Recherchen bin ich hier nämlich nicht weiter gekommen. Aber apropos Zeit.. diese Australier… mal ganz ehrlich… wer braucht denn halbe Zeitzonen? Wisst ihr, wie kompliziert das ist? Halbe Zeitzonen, manche Staaten haben sich dem Konzept der Sommerzeit angeschlossen, andere nicht… da hatte doch wirklich jemand zu viel Langeweile… aber ich habe eine schöne Anekdote gehört, die ich hier noch einmal zum Besten geben möchte: Ein Mädel, das ich irgendwo auf Reisen traf, war mit einer Gruppe von Leuten durch das Outback unterwegs, von West nach Ost. Irgendwann halten sie an einer Tankstelle und fragen die Frau an der Kasse, wie spät es denn sei, damit sie ihre Uhren korrekt stellen können. Da antwortet die Dame: „Tut mir wirklich leid, aber ich weiß selbst nicht, in welcher Zeitzone wir uns hier befinden. In diesem Ort leben nur sieben Personen und bisher war es niemandem wichtig genug, mal herauszufinden, welche Zeitzone es ist.“
Alice Springs ist nicht weiter der Rede Wert. Vielleicht unterschätze ich das Städtchen auch, weil ich ihm nicht genug Zeit gebe, um seinen Charme auf mich wirken zu lassen… in dem halben Tag, den ich dort verbringe erlebe ich es allerdings eher als ein Dreckloch in dem man einen extrem schlechten Eindruck von den Aborigines bekommt, weil sie überall herumlungern und einen auf unangenehme Weise ansprechen. Die Stadt ist der einzige Ort in Australien, an dem man gewarnt wird (von Reiseführern, Hostelbesitzern und quasi jedem, dem man begegnet), sich im Dunkeln alleine (oder in zu kleinen Gruppen) draußen aufzuhalten. Egal ob männlich oder weiblich. Schon tagsüber fühle ich mich nicht gerade wohl, als ich durch die Straßen gehe. Das ist vor allem deshalb schade, weil ich vermutlich nicht die einzige Reisende bin, die zu Verallgemeinerungen neigt. Und die problemstiftenden Aborigines in Alice Springs nicht unbedingt repräsentativ für alle Ureinwohner sind, sondern im Gegenteil Menschen, die es sich auf verschiedenste Art und Weise mit ihren Stämmen verscherzt haben und diese deshalb verlassen mussten… Ausgestoßene quasi, die wir zwangsläufig (weil wir sonst nicht vielen begegnen), als den Normalfall ansehen. Nach Alice Springs (das nebenbei bemerkt noch mehr mitten in der Wüste liegt, als Las Vegas, glaub ich, aber viel weniger blinkt) kommt man hauptsächlich, um von dort aus auf eine Tour zum Uluru (Ayers Rock) zu gehen. Der große rote Stein in der Mitte des Kontinents ist nicht nur „das“ Wahrzeichen Australiens, sondern auch eine Kultstätte der Aborigines. Hier wird man zwangsläufig damit konfrontiert, wie unschön die Atmosphäre für sie wurde, als die Engländer hier Fuß fassten. Um es mal ganz milde auszudrücken. Alles, was wir heute als sehenswert erachten, hatte schon einen Aborigine Namen, den die Engländer geflissentlich ignorierten. Erst seit wenigen Jahren werden diese wieder benutzt, ich erwähne hier einfach mal beide. Den einen aus Prinzip, den anderen wegen seiner Bekanntheit und weil es leichter scheint, ihn auszusprechen. So steige auch ich am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang wieder in einen Tourbus. Unser Guide heißt Elli, eine winzige Mitzwanzigerin mit unglaublicher Energie, die mit allen Mitteln versucht, in der Gruppe gute Laune aufkommen zu lassen. Das gelingt ihr allerdings nicht wirklich und damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt, warum das so ist, beschreibe ich euch meine Reisegruppe mal etwas detaillierter (und das nicht nur, weil ich weiß, das mein Onkel und wie ich gerade höre auch meine Mutter, Fans meiner Personen-Charakteristiken sind): Meine Mitreisenden sind so eindrucksvoll keinen wirklichen Eindruck auf mich gemacht, dass ich tatsächlich sämtliche Namen vergessen habe, daher werde ich der Einfachheit halber auf die altbewährte Methode zurückgreifen und alle Mädels Julia und alle Jungs Mark nennen. Wo fange ich an… am besten halte ich mich grob an die Sitzordnung im Bus… also: Da wären Julia und Mark aus der Schweiz. Verheiratet oder seit Ewigkeiten ein Paar. Die beiden sind nicht gerade Plappermäuler, genau wie Julia und Mark aus Liechtenstein, weshalb ich die Biographien der beiden Päärchen gerne verwechsle. Ein Paar ist Ärzte, mit dem anderen sind sämtliche Versuche der Kommunikation (und glaubt mir… Smalltalk kann ich mittlerweile) nie so weit gekommen genaueres herauszufinden. Immerhin weiß ich, dass ich jetzt gerne mal nach Liechtenstein möchte. Genauergesagt möchte ich gerne mal durchlaufen. Weil es geht. Wo hat man sonst die Gelegenheit in so kurzer Zeit ein Land zu durchqueren? Die beiden Päärchen sind auch vom Erscheinungsbild relativ ähnlich. Die beiden Julias sind klein, zierlich und blond, die beiden Marks etwas größer und unauffällig. Keine Ecken, keine Kanten, alle vier ausgestattet in Outdoorkleidung, die sie sich anscheinend direkt vor der Reise zugelegt haben. Dann ist dort Julia aus Dänemark. Sie sieht so ganz und gar nicht Dänisch aus. Klein, dunkle kurze Haare eher burschikos. Krankenschwester, schüchtern und schweigsam. Außerdem die beiden Julias aus Frankreich, die mit zwei Marks, ebenfalls aus Frankreich irgendetwas zwischen einer Beziehung und einer Freundschaft pflegen zu scheinen. Die vier sprechen gerne und laut, allerdings hauptsächlich französisch. Der englische Wortschatz der Mädels scheint sich hauptsächlich auf „Mir ist heiß!“ und „Ich will endlich duschen“ und „Wann sehen wir denn endlich Ayers Rock?“ zu beschränken. Leider verstehe ich diese Sätze auch auf Französisch, so dass sich in mir mit zunehmender zeitlicher Entfernung der Verdacht erhärtet, dass die beiden vermutlich in keiner Sprache etwas anderes sagen. Ach doch… als es am ersten Abend darum geht Bier zu kaufen, sind sie auch ganz groß dabei was in mir die Hoffnung auf Kommunikation geweckt hat… mit anderen zusammensitzen, Bier trinken und vielleicht eine gute Zeit haben, ist dann aber doch nicht so ganz deren Ding. Ganz europäisch sind wir nicht, sondern haben einen Kanadier an Bord. Tatsächlich die einzige Person, deren Namen ich mir gemerkt habe, denn er heißt wirklich Mark. Er ist „Bushfirefighter“ und sollte ich jemals in ein Buschfeuer geraten, so ist er definitiv jemand, auf dessen Hilfe ich vertrauen würde, denn er könnte mich vermutlich mit einem Arm aus dem Wald tragen und mit dem anderen gleichzeitig eine Kleinfamilie inklusive Katze retten. Er scheint seinen Traumjob gefunden zu haben, dieser beinhaltet es aber, dass er manchmal Wochenlang, nur mit seinen Kollegen, irgendwo im Busch lebt und entsprechend bezeichnet er die Einsamkeit als „sein Ding“. Worte eher nicht so. (Obwohl ich ihn am letzten Morgen beim Hike um Uluru tatsächlich zu einer Unterhaltung gebracht habe und jetzt über ein unglaubliches Wissen über Bushfirefighting verfüge. Z.B. dass die Feuerwehrmänner im Einsatz mal eben 9000 Kalorien verdrücken und gleich verbrennen (no pun intended)). Und dann sind da noch Mark und Mark aus England. Ersterer stellt sich selbst als „das Baby“ vor, er ist nämlich erst 18. Letzterer bringt mich ziemlich lange zum Grübeln. Er ist noch älter als ich (und ich habe die Vermutung, das will in diesem Bus bzw. unter Reisenden in diesem Land, etwas heißen), winzig klein, zierlich, Haare und Bart haben -wo vorhanden- die gleiche Länge und sind auf dem Weg eher grau zu sein, als meliert. Aber irgendwoher kenne ich seine Stimme. Nach einer Ewigkeit komme ich drauf. Er klingt wie Tobi! Würde er nicht direkt hinter mir sitzen und mir so erlauben, mich nur auf die Stimme zu konzentrieren, wäre ich vermutlich nie drauf gekommen. Ein Ire darf natürlich auch nicht fehlen und so haben wir Mark mit an Board. Der Gute ist ziemlich grummelig, wirkt ein wenig deplatziert, spricht kaum und wenn, dann mit diesem irischen Genuschel, das beim besten Willen keiner verstehen kann, der nicht selbst von der Grünen Insel ist. Natürlich bin ich nicht die einzige Deutsche im Bus, denn mit dabei sind noch zwei Kerls mit Namen Mark. Vom äußeren Erscheinungsbild würde ich die beiden eher am Ballermann vermuten, als in der Wüste Australiens. Als ich mich mit ihnen unterhalte, ändere ich diese Meinung kein Stück. Der eine ist dünn, weit entfernt von jedem Muskelansatz, schütteres, blondes Haar, trägt Hawaiihemden, hat „Wirtschaft“ studiert, ist gerade fertig und muss erst mal raus. Der andere ist kräftiger, trägt T-Shirts, die um den Bauch herum gerne etwas mehr Freiheit hätten und liebt Sprüche, die vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen irgendwo unter der Gürtellinie liegen. Auch er hat irgendwas mit Wirtschaft studiert, ist gerade fertig und muss sich ersteinmal erholen. Beide sind Ende 20 und haben sich ein wenig Zeit gelassen mit dem Studium. Und dann ist da noch ein weiterer Typ, von dem ich alles vergessen habe, außer sein Name: Er heißt Mark. Und so ist die Stimmung relativ schläfrig und das obwohl wir mit Eddings an die Fensterscheiben malen dürfen und jeder die Geschichte seines ersten und letzten Kusses erzählen musste. Mal abgesehen davon, dass es natürlich bei den Päärchen zu einer unglaublichen Aufregung kommt, ob denn auch beide das Richtige sagen. Uiuiui… Mir ist klar, dass ich diese Gruppe eher als soziales Experiment betrachten sollte, als als Quelle für neue Freundschaften… Irgendwann kommen wir zu unserem ersten Stopp, dem „King’s Canyon“. Hier geht’s zu unserer ersten Wanderung und wer nicht mindestens drei Liter Wasser dabei hat (leere Flaschen reichen, kann man im Bus auffüllen), darf nicht mit. Viel zu Hoch ist die Gefahr einer Dehydrierung, wenn man sich bei der Hitze in der Wüste bewegt. Natürlich hören wir allerhand Schreckensgeschichten von Tour-Teilnehmern, die nicht auf ihre Guides gehört haben und dann keinen sonderlich guten Tag hatten. Bei mir stößt das natürlich auf offene Ohren, schließlich habe ich bereits im gut klimatisierten Deutschland eine irrationale Angst zu dehydrieren. Die beiden Französinnen sind ganz allgemein nicht von dem Konzept überzeugt, sich aus dem klimatisierten Bus zu bewegen und zu laufen. Vor allem, weil das ja gar nicht Uluru ist. Irgendwann kommen sie dann aber doch mit und man sieht, dass ihre beiden Marks eigentlich lieber einen Schritt schneller laufen würden, statt mit ihren Mädels hinterher zu trödeln. Wir haben aber Glück. Es ist etwas bewölkt und daher viel „kälter“ als gewöhnlich. Und so ist die Wanderung zwar anstrengend, aber die drei Liter braucht keiner von uns. Der King’s Canyon ist schon sehr schön. Nichts gegen den „Grand Canyon“, aber mit dem sollte ich nichts vergleichen und auch nichts gegen die kleinen Canyons in den Rockies, die sind nämlich ganz anders, aber schon auch sehr schön (eigentlich sogar schöner, aber ich sollte mir abgewöhnen so wählerisch zu sein). Am faszinierendsten finde ich jedoch, was Elli uns so über Flora, Fauna und Aborigines erzählt. So sind z.B. die „Gumtrees“, so perfekt an die unwirtlichen Lebensbedingungen in Australien angepasst, dass sie nicht nur Feuer brauchen, um sich zu vermehren (das gilt übrigens auch für die Pine-Trees in Kanada, dank Mark bin ich da informiert), sondern auch die Wasserversorgung zu einzelnen Ästen abschneiden können. Wenn sie also merken, dass nicht genug Wasser für den ganzen Baum vorhanden ist, lassen sie einen Ast absterben und retten damit den Rest des Baumes. Ziemlich genial, wie ich finde. Außerdem produzieren sie ein weißes Pulver, dass als Sonnenschutzmittel wirkt. Grandios. Höhepunkt am „King’s Canyon“ ist das Paradies. Wie kann ein Besuch im Paradies auch nicht Höhepunkt sein? Im Garten Eden gibt es ein Wasserloch, in dem wir baden können und es auch tun. Prinzipiell spricht nichts dagegen, dies in Badekleidung zu tun, da ich aber endlich mal die Chance habe, in voller Bekleidung schwimmen zu gehen und die dann folgende Verdunstungskälte als meine persönliche Klimaanlage zu nutzen, schwimme ich lieber in Hose und T-Shirt. Das macht auch alles soweit Spaß, als ich dann aber komplett bekleidet und entsprechend triefend nass, versuche aus dem Wasserloch zu klettern und auf den glitschigen Steinen immer wieder ausrutsche, bis ich es endlich heraus schaffe, fühle ich mich doch wie das genaue Gegenteil von Halle Berry in James Bond… Wie gut, dass Pierce Brosnan nicht zu meiner Reisegruppe gehört. Bei diesen Temperaturen ist so ein erfrischendes Bad wirklich paradiesisch, der Ort hat seinen Namen verdient, finde ich. Trotzdem freue ich mich, keine Schlange zu entdecken. Denn ganz ehrlich… in diesem Land könnte die Begegnung mit einer Schlange definitiv noch unangenehmer enden, als mit der Tatsache, dass uns Feigenblätter nicht mehr genügen… Die Gelegenheit, im Garten Eden einen Apfel zu essen, lasse ich mir trotzdem nicht entgehen. Kann ja eigentlich nix passieren, ich hab ja einen Bauchnabel, Eva heiße ich auch nicht und Adams gibt’s hier ebenfalls nicht. Es heißt ja eh jeder Mark. Außerdem entdecke ich einen Felsen, der Aussieht, wie ein Hase. Nicht mal Elli kannte den und entsprechend auch keine Aborigine-Geschichte, die dazu passt. Ich werde mir bei Gelegenheit eine ausdenken. Nach dem Frosch in Neuseeland ist er definitiv der coolste Fels. Langsam habe ich eine ganze Sammlung und außerdem das Gefühl, dass man einen Blick dafür entwickelt… Am Abgrund des Canyons machen wir das erste und einzige Gruppenfoto auf dieser Tour. Leider kann ich es euch nicht zeigen, weil Julia, die es an alle weiterschicken sollte, wohl unter der Dusche ihre Mission vergessen hat… arrggghhh. Danach müssen wir Holz für’s Lagerfeuer suchen und dürfen alles zum Anhänger schleppen, was tot ist, also kein Grün mehr hat. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Sich einfach an einen Ast hängen und so lange wippen bis er abbricht, ist ja schon irgendwie nach meinem Geschmack… Wen ich allerdings nicht mit nennenswertem Holz in der Hand sehe, sind die beiden französischen Julias… genau diesen Eindruck von ihnen hatte ich ja von Beginn an… das muss ich weiter beobachten, so unfair bin ich zugegebenermaßen… erwartungsgemäß halten die beiden sich auch gleich raus, als es ums Abendessenkochen (bzw. Kleinschneiden von Gemüse) geht. Aber da mussten sie sich wohl noch von ihrem Schock erholen, denn mitten im Nichts, wo wir heute Nacht kampieren werden, gibt es keine Duschen. Die beiden fanden es gar nicht lustig, als Elli dies begleitet von einem „Wir werden nach den drei Tagen alle so richtig schön dreckig sein und übel riechen!“, erwähnte. Versteht mich nicht falsch, auch ich bin durchaus ein Freund von regelmäßiger Körperhygiene, aber wenn ich mich auf eine dreitägige Tour ins Outback begebe, die mit „Aktivität und Abenteuer“ wirbt und klar ist, dass wir nicht in Hostels schlafen, rechne ich nicht mit fließend Wasser… Die ganze Tour ist relativ rustikal, nicht weiter erstaunlich, wenn man einen Blick auf die Werbebroschüre geworfen hat. Die erste Nacht verbringen wir auf einer Farm. In diesem Fall heißt das: auf einem Fleckchen rotem Sand mit Feuerstelle, einem Plumsklo und einer kleinen Überdachung für den Notfall. Dass es sich um das Gelände einer Farm handelt, weiß ich nur, weil man es uns sagt. Kein Haus weit und breit, keine wirkliche Straße und auch die zigtausend Kühe, die es hier wohl gibt, sind weit entfernt. Wir machen ein Lagerfeuer, in dem wir auch gleich unser Abendessen kochen. Aus Emailleschüsseln gibt es dann Kartoffel-Möhren-Durcheinander, Reis und wer mag Chilli. Es ist unglaublich, wie sehr ich es genieße, mein Abendessen mehr oder weniger im Staub sitzend zu verputzen. Wiedereinmal stelle ich fest, dass ich Land-Dreck gar nicht schlimm finde. Etwas Staub im Essen hat noch keinem geschadet. In der Stadt finde ich es allerdings mehr als unangenehm etwas zu essen, wenn ich mir vorher die Finger nicht ordentlich waschen kann… Der größte Teil der Gruppe verzieht sich direkt nach dem Essen zum Schlafen oder zumindest in Ecken, die weitere Interaktion mit Fremden nicht zulassen. Ich trinke mit den beiden Marks aus Deutschland, dem Bushfirefighter und Mark aus England noch ein Bier (was zugegebenermaßen sehr lustig ist, wenn man sie nicht allzu ernst nimmt) und dann verkrieche auch ich mich in meinen SWAG. Swags sind Matratzen mit aufgenähtem Schlafsack/Minizelt… naja… so ähnlich. Man nimmt schon noch einen normalen Schlafsack (in meinem Fall nur so ein Seidending, aber das reicht), aber kann sich halt gegen Regen schützen. Außerdem sind die Dinger ziemlich weich, gemütlich Über uns ist eine gigantische Anzahl an Sternen, die sich im Kunstlicht der Städte lange Zeit vor mir versteckt haben. So einen wunderschönen Sternenhimmel habe ich wirklich erst einmal gesehen… auf dem Vulkan in Hawaii… und wann ich das letzte Mal direkt unter den Sternen geschlafen habe, weiß ich gar nicht mehr… ach doch… auf der Fähre durch die Inside-Passages in Alaska… naja fast. Das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer, schon alleine, weil ich nicht befürchten muss, dass mich jemand mit Oliven bewirft. Den ganzen Tag saßen wir im Bus oder sind herumgelaufen und jetzt umgibt mich eine Ruhe, die ich in den letzten Monaten, in all den Hostel Dorms nicht hatte. Selbst die wenigen Schnarcher legen sich weit weg von allen anderen. Und auch wenn ich nur selten wirklich schlecht schlafe, so gut wie hier, fernab von jeglicher Zivilisation, neben dem Lagerfeuer auf meinem gemütlichen Swag, war es schon lange nicht mehr… Es ist noch dunkel, als Elli uns aufweckt, um in den nächsten Tag zu starten. Bereits am Vorabend habe ich festgestellt, dass mir das Plumsklo nicht wirklich liegt. Schon alleine, weil es irgendwann um einige Zentimeter versetzt wurde und sich daher nun vor dem eigentlichen Donnerbalken ein weiteres Loch befindet. Dieses zu überwinden bin ich einfach zu klein. Und mal ganz ehrlich… bei Sonnenaufgang hinter einem Busch zu hocken und das wunderbare Farbspiel am Himmel zu beobachten, hat eine ganz besondere Abenteuer-Romantik, der ich mich nur zu gerne hingebe. Nach dem Frühstück (unglaublich, wie gut Instant-Kaffee bei solchen Gelegenheiten schmeckt) fahren wir dann doch ersteinmal zu dem Campingplatz am Uluru, dort gibt es nämlich Duschen. Und so sind wir allesamt sauber und wohlriechend, als wir zum nächsten schweißtreibenden Hike aufbrechen. „Kata Tjuta“, auch bekannt als „Die Olgas“ ist unser Ziel. Diverse rote runde Felsen, die einfach unglaublich schön sind. Unsere kleine Wanderung ist auch hier wieder anstrengend. Und das obwohl der größte Teil der Gruppe (inkl. mir) den einfacheren, aber dafür schöneren Weg wählt. (Einige Jungs nehmen natürlich die sportliche Variante. Dazu zählen auch die Begleiter der französischen Julias – die das nicht so gut finden – und meine Vermutung ist, dass es sich dabei eher um eine Flucht, als um den Wunsch nach körperlicher Betätigung handelt) Es ist ohnehin weniger der Weg, als einfach nur die Hitze, die einen bereits bei den kleinsten Bewegungen zum Wasserauswurf bringt. Und wir haben noch Glück: selten ist es um diese Jahreszeit so „kühl“ in dieser Region. Aber was wir sehen ist jede Anstrengung wert und mal ganz ehrlich: rote Felsen sehen auf Fotos auch gleich viel schöner aus, wenn man einen blauen Himmel dazu hat. Und bei all dem Grün wäre ich auch wirklich enttäuscht, wenn ich in der Wüste nicht mal schwitzen würde. Elli teilt derweil ihr Wissen über die Region, die Aborigines und die medizinische Wirkung diverser Pflanzen mit uns. Wirklich spannend und alleine all die „Traumzeit“ Geschichten, die Aborigine-Mytologie, in der z.B. die Entstehung von Kata Tjuta, Uluru etc. erklärt werden, sind einfach faszinierend. Viele Touristen sind hier nicht unterwegs, aber hin und wieder habe ich dann doch das Gefühl, dass irgendein (vermutlich deutscher) Imkerverein auf Klassenfahrt in Australien gelandet ist. Eine erstaunlich hohe Anzahl an Touristen trägt lächerliche Fliegennetze über dem Kopf, die durchaus die Fähigkeit haben, mich eine ganze Weile lang zu amüsieren. Zwar habe auch ich von den Fliegenmassen gehört, die einem hier angeblich in Augen und Ohren herumkriechen und sämtlichen Nerv rauben, aber was ich hier erlebe, ist nun wirklich nicht dramatisch. Die paar Fliegen. Und die stechen einen ja nicht mal… alles Pienschen. Zugegebenermaßen sind es mehr, als ich gewöhnt bin, aber da sie mir ja nichts tun, lasse ich sie auf mir sitzen, übe mich in Selbstbeherrschung (was von diversen Mitmenschen honoriert wird, die eine eher aggressive Haltung an den Tag legen) und irgendwann verschwinden sie ja auch wieder. Man muss sich ja auch nicht über alles aufregen. Zum Sonnenuntergang sehen wir ihn dann zum ersten Mal. Den verrosteten Stein in der Mitte des Kontinents, für den wir alle mehrere tausend Kilometer gereist sind. Wir sind früh genug am Aussichtspunkt, um einen wirklich grandiosen Platz zu ergattern. Um uns herum werden Tische aufgebaut, mit weißen Tischdecken geschmückt, Gläser platziert und als die großen Busse mit massenweise gut gekleideten Touristen ankommen, knallen die ersten Korken. Wir machen derweil alberne Fotos und trinken Dosenbier. Es gibt einfach unzählige Varianten, wie Reisende ein und das selbe sehen, aber trotzdem so unglaublich unterschiedliche Erlebnisse haben können… das größte Gelächter kommt aber definitiv von uns. Die Natur allerdings verspürt keine große Lust, uns ein ordentliches Spektakel zu zeigen und die Sonne verschwindet einfach so und ohne den Himmel sonderlich bunt zu machen. Schade. Aber wir haben ja noch den Sonnenaufgang. Zurück auf dem Campingplatz ist dann die Stimmung mal wieder eher dröge. Wirklich faszinierend, wie sich so eine Gruppe so gar nicht zu einer Gruppe oder wenigstens mehreren Untergruppen formieren will. Ich finde es einerseits schade, andererseits aber auch wirklich spannend, denn es geht so gegen jegliche Beobachtungen, die ich bisher gemacht habe. Aber Stimmungslosigkeit ist ohnehin nichts für Elli und so kann sie wenigstens einen kleinen Teil von uns zu albernen Spielen überreden. Zuerst spielen wir ein Spiel, dass ich schon wieder vergessen habe, aber wenn man etwas Dummes macht, muss man tanzen und das ist schon sehr amüsant. Dann kommt die großartige Idee des „SWAG-Sumo“ auf. Zwei Teilnehmer werden jeweils in einen SWAG gehüllt, Arme innen, und gut verschnürt. Dann kommt mit ordentlich Klebeband noch eine Metallschüssel auf den Kopf und dann müssen die beiden so lange gegeneinander rennen, bis einer aus dem Kreis im Sand heraustritt. Unglaublich lustig! Leider komme ich selbst nicht zum Zug. Sämtliche Mädels drücken sich und Elli fordert den einzigen Mark („das Baby“) heraus, der größenmäßig noch in Ordnung wäre. Gegen alle anderen hätte ich keine Chance und Mitleidsnummern mag ich nicht. Aber Zuschauen alleine ist auch schon einfach zu gut. Trotz des lustigen Abendausklangs kann ich es kaum erwarten, wieder in meinen SWAG zu kriechen, denn obwohl wir auf einem Campingplatz sind, verspricht es wieder eine gute, erholsame Nacht zu werden. Und da wir ja den Sonnenaufgang sehen wollen, wird sie ohnehin nicht sonderlich lang. Geweckt werden wir von einer leicht panischen Elli, die ruft: „Beeilt euch, die böse Elli hat verschlafen, wir müssen alle in spätestens 10 Minuten im Bus sein!“ Ich weiß nicht, wie Julia und Julia es schaffen, aber offensichtlich verzichten sie für den großen roten Stein sogar auf die morgendliche Dusche, denn wir sind alle schneller im Bus, als man glaubt und dann geht es relativ rasant los. In meiner Erinnerung stellt sich der Bus in den Kurven quer, als wir auf dem Weg zum Aussichtspunkt sind, aber es ist durchaus möglich, das ich mir das auch nur ausdenke. Wir schaffen es rechtzeitig und ganz ehrlich… so ein Frühstück bei Sonnenaufgang mit Blick auf den Uluru könnte selbst meinem Perfektionismus noch ein Meister ein. Währen dort nicht die Fliegen. Schon nach wenigen Minuten nehme ich sämtliche Kommentare zurück, die ich am Vortag (meist mir selbst gegenüber) über den Imkereiverein gemacht habe und wünsche mir so ein verdammtes Netz über dem Kopf. Was wollen denn die blöden Viecher in meinen Ohren und Augen? Ich bin doch kein Pferd! So bin ich mit einer Hand konstant am wedeln, was bei meiner rechts-links-Handkoordination leider zu einigen Schwierigkeiten beim Genuss meines Frühstücks führt. Auch Fotografieren ist nicht einfach und noch schwerer ist es, fotografiert zu werden, weil sich in dem kurzen Zeitraum in dem man posiert bereits mehrere Fliegen irgendwo im Gesicht sammeln und einen fürchterlich kitzeln. Hat eigentlich jemals jemand über Fliegen als Foltermethode nachgedacht? Ich will doch nur in Ruhe Kaffee trinken!!! Irgendwann ersäuft eine Fliege jämmerlich in der koffeinhaltigen Brühe und und ich erwische mich bei einem recht lauten Ausruf, der in Richtung: „Siehst du, du Mistviech, das hast du nun davon!“ Und ernte dafür erstaunte Blicke. Offenbar habe ich zu lange still herumgesessen, so dass der plötzliche Ausbruch überrascht. Bei mir ist es jetzt wirklich vorbei mit jeglicher Selbstbeherrschung. Ich versuche ein Exempel zu statuieren, in dem ich möglichst viele Fliegen erschlage. Vielleicht lernen ihre Freunde daraus… Aber wie im Leben der Menschen lernt keiner aus den eigenen Fehlern und noch weniger aus denen der Mitmenschen und es surrt und summt und kitzelt unaufhörlich weiter. Arrrrggggghhhhhh….. bevor ich endgültig ausraste ist zum Glück irgendwann die Sonne da, scheint munter auf uns herab und wir räumen unser Frühstück zusammen, um uns den Felsen aus der Nähe anzusehen und um ihn herumzulaufen. Leider haben Fliegen keinerlei Respekt vor Kultstätten und so nerven sie uns weiter, aber selbst das wird zur Routine. Während des gesamten Spaziergangs wedele ich mit meinem Hut vor mir herum und wenn man ersteinmal im Rhythmus ist, haben die Fliegen keine Chance und verlieren damit ihre Nervkraft… man kann sich tatsächlich an alles gewöhnen. Und so ein Gespräch über Bushfeuer ist auch ziemlich beruhigend, zumindest wenn der Gesprächspartner jemand zu sein scheint, der eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Irgendwann frage ich Mark tatsächlich, ob er jemals in Panik gerät. Die Antwort dauert (erwartungsgemäß) eine Weile, fällt aber negativ aus. So jemanden hätte ich gerne in klein für auf den Schreibtisch. Uluru ist ein beeindruckender Felsen, irgendeine Form von Magie spüre ich allerdings nicht. Wirklich lustig allerdings finde ich, dass ich in einer Höhle eine Zeichnung finde, die aussieht, als stünde ein Schwein auf einem Globus. Die Zeichnung ist schon sehr alt, aber offensichtlich war schon damals klar, dass Trudi irgendwann die Welt bereist. „Kata Tjuta“ hingegen wirkt auf mich eindeutig eindrücklicher, wobei ich nicht beschreiben kann warum. Es ist einfach so. Aber da man auf einer Tour ohnehin die ganze Region besucht, kann man sich ja sein Sahnestückchen heraussuchen und ich muss schon sagen… es ist es wirklich Wert, diese Entfernung von der Zivilisation zurückzulegen. Nach dem Spaziergang geht es noch in ein Kulturzentrum und dann mit dem Bus zum Flughafen. Leider verpasse ich das Kamelreiten, weil ich von hier aus weiterfliege und nicht zurück nach Alice Springs fahre. Wobei… vielleicht wäre es auch gar nicht so lustig geworden, schließlich scheine ich die Einzige zu sein, die für diesen Programmpunkt einen gewissen Enthusiasmus aufbringen konnte. Aber egal. So viel so schöne Natur in so einer kurzen Zeit gesehen und so viele schöne Geschichten dazu gehört zu haben, plus den Bonus, jetzt über ein für einen Laien recht ausführliches Wissen über das Thema Bushfirefighting zu besitzen, machen mich glücklich. Außerdem habe ich drei Tage lang nicht nur draußen, sondern auch noch im Dreck gespielt… was will ich mehr?
„Sag mal… wolltest du nicht auch nach Asien?“ Klar. Wollte ich. War ich sogar. Und es war spannend. Ich kann euch also beruhigen… es sind nur Gerüchte, dass ich am Uluru hängen geblieben bin und von nun an in der Wüste lebe. Naja, es währen welche, hätte es jemand behauptet. Hat aber keiner. Der einzige Grund, warum hier noch nichts von meiner weiteren Reise steht, ist, dass mich mein reales Leben schon wieder von meinem virtuellen abgelenkt hat. Klassisches Problem unseres Jahrtausends. Und so kommt es, dass ich mittlerweile wieder zu Hause angekommen bin, herzlichst begrüßt wurde, meine Homepage von Piraten gekapert wurde und ich mich auch gleich schon wieder aufgemacht habe und mich erneut auf der anderen Seite der Erde befinde. So schnell kann’s gehen….und ihr wisst davon noch nichts, es sei denn, wir haben uns zwischenzeitlich gesehen, gehört oder geschrieben. Das ist natürlich möglich und wahrscheinlich. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es noch jede Menge Geschichten zu erzählen gibt… Ein paar aus Australien und viele, viele, viele von dem interessantesten Kontinent, den ich bereist habe… also schön immer weiter auf meine Seite schauen, ich verspreche euch, dass es hier ganz bald wieder Neuigkeiten gibt.

„Sag mal… wolltest du nicht auch nach Asien?“ Klar. Wollte ich. War ich sogar. Und es war spannend. Ich kann euch also beruhigen… es sind nur Gerüchte, dass ich am Uluru hängen geblieben bin und von nun an in der Wüste lebe. Naja, es wären welche, hätte es jemand behauptet. Hat aber keiner. Der einzige Grund, warum hier noch nichts von meiner weiteren Reise steht, ist, dass mich mein reales Leben schon wieder von meinem virtuellen abgelenkt hat. Klassisches Problem unseres Jahrtausends. Und so kommt es, dass ich mittlerweile wieder zu Hause angekommen bin, herzlichst begrüßt wurde, meine Homepage von Piraten gekapert wurde und ich mich mittlerweile wieder auf der anderen Seite unseres schönen Planeten Erde. So schnell kann’s gehen….und ihr wisst davon noch nichts, es sei denn, wir haben uns zwischenzeitlich gesehen, gehört oder geschrieben. Das ist natürlich möglich und wahrscheinlich. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es noch jede Menge Geschichten zu erzählen gibt… Ein paar aus Australien und viele, viele, viele von dem interessantesten Kontinent, den ich bereist habe… also schön immer weiter auf meine Seite schauen, ich verspreche euch, dass es hier ganz bald wieder Neuigkeiten gibt.
Mit Julia und Mark aus Liechtenstein, Mark aus Irland und noch einigen anderen, die ich bereits vergessen habe, sitze ich am Flughafen und warte auf meinen Abflug. Ich bin die Einzige, die nach Perth fliegt, der Rest strebt Richtung Osten. Weil wir zufällig nebeneinander sitzen, unterhalte ich mich irgendwann mit Mark, dessen Irischen Akzent ich langsam zu verstehen beginne. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er zum ersten Mal mehr als einen kurzen Satz sagt (und damit meine ich nicht nur im Gespräch mit mir, sondern ganz allgemein auf dieser Tour) und bei längerer Unterhaltung sogar ganz nett zu sein scheint. Mir scheint, er hat sich bisher einfach nicht getraut, den Mund aufzumachen (insofern man bei Iren überhaupt davon sprechen kann), denn er ist zum ersten Mal alleine unterwegs, eigentlich wollte er nur seine Freundin besuchen, die zum „Work & Travel“ in Australien ist, aber die hat die Tour für ihn gebucht und alleine Reisen macht ihm Angst. Ein guter Grund die Klappe zu halten. Vielleicht nicht unbedingt so meine Art, aber das kann ja jeder halten, wie er will. Immerhin spricht er jetzt und so wird die Wartezeit dann doch recht angenehm. Vielleicht hätte ich das nicht denken, sondern über die Tortur des ständigen Wartens auf Reisen philosophieren sollen… Das Leben dachte sich wohl, es tue mir einen Gefallen, als ich kurz darauf eine Durchsage höre, die mir erzählt, dass mein Flug verspätet ist. Mark sagt: „Oh nein, wie ärgerlich für dich!“ Ich denke „Was soll’s? Ich sollte herausfinden, ob die hier irgendwo Kaffee verkaufen…“. Und sage es dann auch laut. Wenn mir das Leben schon versucht, auf seine seltsame Art etwas Gutes zu tun, dann sollte ich vielleicht auch einfach das Beste daraus machen. Irgendwann fangen die Durchsagen an wirr zu werden. Zuerst wird die Verspätung immer länger, dann heißt es, dass der Flug evtl. ganz ausfällt. Panik oder Unmut habe ich offensichtlich an diesem Tag delegiert, denn während Mark für mich die Apokalypse meiner Reise ausmalt, kann ich keinen einzigen Grund finden, warum es für mich schlechter sein sollte, erst morgen in Perth anzukommen und noch nicht heute. Ich gehe zum Schalter, um mal genauere Auskünfte zu bekommen und dort sagt man mir, dass ich einchecken könne, dann kann ich in den gesicherten Bereich und dort erhalte ich Wasser, Kaffee und einen Snack. Mit größter Wahrscheinlichkeit müsste ich dann aber wieder aus dem Bereich heraus, denn es sieht danach aus, dass der Flug storniert wird und wir in ein Hotel gebracht werden. Ich wäge kurz Coffein gegen Gesellschaft ab und warte dann doch lieber außerhalb des Security-Bereiches. So eine Tasse Kaffee hält ja auch nicht ewig. Irgendwann verschwindet dann aber auch mein Gesprächspartner… zum Glück weiß kurz darauf auch die Fluggesellschaft was los ist. Das Flugzeug, dass uns eigentlich an die Westküste bringen soll hat ein technisches Problem. Deshalb können wir heute nicht los und werden stattdessen gleich von einem Bus abgeholt, der uns in ein Hotel bringt. Es gibt ein Abendessen und morgen nach dem Frühstück werden wir dann wieder abgeholt, zum Flughafen gebracht und nach Perth geflogen. Für mich klingt das alles nach einem sehr guten Plan. Vielleicht muss man eine Weile mit knappem Budget in Hostels unterwegs gewesen sein, um sich über so etwas zu freuen, aber für mich ist die Aussicht auf ein kostenloses Zimmer (ganz für mich allein), Abendessen, ausgiebiges Frühstück und das alles in einer Qualität, die ich (wenn überhaupt) seit Ewigkeiten nicht mehr hatte, ein wirklich großer Grund zur Freude. Und diese bin ich bereit zu teilen. Um mich herum versammeln sich die anderen Passagiere der Maschine und während mir die Sonne aus dem Allerwärtesten scheint, besteht sonst allgemeine Grummellaune. Ich für meinen Teil finde es gut, nicht in einem Flugzeug zu sitzen, das irgendwelche „technischen Probleme“ hat. Sämtliche Auskünfte waren gut, die Wartzeit nicht allzulang und für mein Empfinden läuft die Problemlösung hier einfach absolut professionell. Daher bedanke ich mich bei den beiden am Schalter, die nach wie vor freundlich auf die meckernden Reisenden reagieren und tänzle zum Bus. Dieser lädt und uns vor der Lobby des schicksten Hotels ab, dass das Resort zu bieten hat und ich fühle mich plötzlich nicht nur überglücklich, sondern auch so fehl am Platz, dass es mich schon fast wieder stolz macht. Heute Morgen noch war ich wandern, trage also Cargo-Hosen, die bis zu den Knien rot eingestaubt sind. Dazu ein nicht unwesentlich durchgeschwitztes T-Shirt und natürlich Wanderschuhe. Mein Gepäck besteht aus einem großen und einem kleinen Rucksack, die beide schon bessere Zeiten erlebt haben und das gilt sowohl für Optik, als auch Geruch. Alle anderen Fluggäste (die ja jetzt keine sind, weil wir nicht fliegen) sind frisch geduscht, tragen eher elegante Freizeitkleidung und haben Koffer und Handtaschen neben sich stehen, die alle noch keine schlechten Zeiten gesehen haben. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass irgendwie alle die Mundwinkel nach unten gerichtet haben, während ich über beide Ohren strahle und mit meiner guten Laune vermutlich allen auf die Nerven gehe. Es herrscht allgemeine Unzufriedenheit, dass wir keine richtige Entschädigung bekommen, man für die zur Verfügung gestellten 25 Dollar nicht gescheit zu Abend essen könne und sowieso und überhaupt. Weil mir das Problem nicht so ganz klar ist und ich finde, die Leute sollten sich mal lieber freuen, dass sie überhaupt in so einem schönen Land Urlaub machen können, beschließe ich, meine Freude zu teilen, sie ist ohnehin zu viel für einen Menschen. So unterhalte mich mit diversen Menschen und finde heraus, das bis auf ein Ehepaar, das eine Tour in Perth gebucht hat (und eine Reiseversicherung hat, die das finanziell lösen dürfte), keiner irgendetwas verpasst oder irgendeinen Schaden davon nimmt, dass wir einen Tag später in Perth ankommen. Trotzdem scheint es sie alle zu erstaunen, dass man sich über so etwas sogar freuen kann. Ist wohl doch alles eine Frage der persönlichen Situation und Perspektive. Was bin ich heute gerne ich. Schließlich hätte ich gar keine Lust, mich jetzt aufzuregen. Eine Alleinreisende Engländerin Ende 30 lässt sich tatsächlich anstecken und auch einige andere scheinen zu bemerken, dass es sich vielleicht wirklich nicht zwangsläufig um das Ende der Urlaubsfreude handeln muss. Fast. Schließlich haben sie Hunger und wir müssen ja noch ewig auf unsere Zimmer warten. Und wieder lerne ich auf meiner Reise etwas für’s Leben: Kekse sind ein Garant für ein Lächeln. Gut, dass ich unterwegs meist welche dabei habe. So teile ich, die offensichtlich am unteren Rande des Reiseniveaus unterwegs ist, mein Essen mit der feineren Gesellschaft und muss darüber irgendwie schmunzeln. Kurz darauf erkläre aber auch ich die Warterei für Zeitverschwendung und bitte die Damen an der Rezeption mein Gepäck zu lagern, damit ich spazieren gehen kann. In meiner fast endlos guten Laune bilde ich mir das vermutlich bloß ein, aber mir scheint, als freuten sich die Mädels, dass jemand wohlgelaunt einfach eine Alternative zum muffelig herumsitzen gefunden hat. So laufe ich ein Wenig durch die Hitze, schaue mir die Anlage des Ressorts ein Bisschen genauer an und als ich zum Hotel zurück komme, erhalte ich einen Schlüssel und begebe mich zum ersten Mal seit Alaska in ein Zimmer, das nur für mich alleine da ist. Mit einem Bad, ganz für mich alleine und sogar einem Fernseher, einem Wasserkocher und einer kleinen Auswahl an Teebeuteln… ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut sich das anfühlt!!!!! Innerhalb von Sekunden verwandle ich das Zimmer in absolutes Chaos, einfach nur weil ich es kann. Seit viel zu langer Zeit konnte ich nichts mehr einfach nur irgendwo liegen lassen und mich breit machen. Oder ohne nennenswerte Kleidung herumlaufen. Das muss genutzt werden. Außerdem schalte ich natürlich den Fernseher ein. Nicht, dass ich dem Programm auch nur die geringste Aufmerksamkeit schenke, aber das Flimmern freut mich. Dann geht es ersteinmal unter die Dusche. Schließlich muss ich sämtliche, dort aufgereihten Pflegeprodukte testen und so einen guten Wasserdruck, ein so sauberes Bad und niemanden der vor der Tür steht und wartet, gab es auch schon lange nicht mehr. Ja… die Wüste ist eigentlich nicht der richtige Ort, um eine ausführliche Dusche zu genießen, aber ich kann einfach nicht anders. Und die Handtücher sind so schön sauber und wohlriechend…. da muss ich mein Gewissen leider ignorieren. Außerdem war ich nach der abenteuerlichen Wüstentour auch wirklich angemessen dreckig. Wieder im Reinen trinke ich erstmal fix einen Tee und dann geht’s ab in den Pool, ein paar Runden Schwimmen, ein Wenig Lesen und Sonnenbaden… wie kann denn irgendjemand auf die Idee kommen, sich bei einem solchen, auch noch kostenfreien, Angebot zu beschweren? Einfach unfassbar. Wenn ich es nicht besser wüsste, hielte ich mich selbst für eine Prinzessin. Ach, was soll’s ein bisschen Mädchenhaftigkeit darf heute sein und so werfe ich mich anschließend in mein schickes schwarzes Kleid, bei dessen Anprobe mir kurz die Luft wegblieb und beschließe, dass es Zeit für eine Fotosession vor dem großen roten Stein ist. Und vielleicht ist Natur ja gewillt, mir diesmal einen schönen Sonnenuntergang zu zeigen. Die Engländerin habe ich leider nicht wieder gefunden. Schade eigentlich, irgendwie ist das Leben in Gesellschaft ja doch amüsanter… Am Sonnenuntergangsaussichtspunkt treffe ich ein australisches Ehepaar, das erstaunlicherweise gewillt scheint meine anstrengend gute Laune zu ertragen. Eigentlich nicht nur zu ertragen, sie erfreuen sich sogar daran, haben Spaß mit mir und der Mann lässt sich als mein persönlicher Fotograf anstellen, was extrem lustig, leider aber wenig erfolgreich ist. Gerade „Sprungfotos“ erfordern so einiges an Übung oder zumindest Gefühl für meine spätauslösende Kamera. Egal, es ist lustig und so vertreiben wir uns die Zeit, bis die Sonne ganz ohne Spektakel ihren Untergang vollzogen hat und es stattdessen ordentlich anfängt zu gewittern. Schon bei den ersten Regentropfen flieht das Ehepaar und ich beschließe, mich darüber zu freuen, dass der Regen so schön warm ist. Schließlich freue ich mich heute über alles. Außerdem ist es mal wieder Zeit für eine kleine Session mir mir und dem Selbstauslöser meiner Kamera und so tanze ich albern im Regen, mitten in der roten Wüste Australiens, mit Uluru im Hintergrund bis ich patschnass bin und Hunger habe. Da es immer noch warm ist, beschließe ich, nichts gegen das Nass-sein zu tun und dafür lieber zügig etwas gegen den Hunger. Es treibt mich in ein Barbecue-Restaurant, in dem man sein Grillgut roh bekommt und es sich dann selbst zubereiten kann. Hier kann man sich einmal durchs Tierreich essen und Beilagen gibt es auch noch. Für ca. 18 Dollar bin ich mit meinen Garnelen dabei, bleiben mir also noch 7… da sollte ich doch noch woanders hin und dort schauen, was es zum Nachtisch gibt…. Alkoholische Getränke können wir mit unserem Gutschein leider nicht bekommen, egal, auf diesen Tag muss getrunken werden, kaufe ich mir eben ein Glas Weißwein, Wasser gibt es ohnehin wie überall kostenlos. Zu meiner großen Freude (was auch sonst an diesem Tag) setzt man sich hier einfach an langen Tischen mit beliebigen Menschen zusammen und so gerade ich in eine Gruppe älterer Herr- und Damschaften aus England, die offensichtlich schon verdammt viel Spaß zusammen hatten und gewillt sind, sich auch gleich noch für mich zu freuen, weil ich so einen tollen Tag hatte. Nach drei riesigen Garnelenspießen und entsprechenden Beilagen bin ich zwar vollgegessen, aber Nachtisch geht ja bekanntermaßen immer. Also ab in den Shuttlebus, der einen im Ressort herumfährt und auf zum nächsten Restaurant. Das hat leider schon zu. Bleibt noch das in meinem Hotel. Da muss ich ja eh hin. Das schließt aber auch gerade vor meiner Nase… Hmmm da hab ich wohl zu lange im Regen getanzt… und es somit nicht geschafft, meinen 25 Dollar Essensgutschein aufzubrauchen… trotzdem bin ich satt mit vermutlich dem besten Essen seit… langem. Dann gehe ich halt auf mein Zimmer. Mein Zimmer. Nur für mich. Mit einem riesigen Bett, das nicht durchgelegen ist, aber dafür ganz frisch bezogen… ich möchte fotografisch festhalten, wie sehr es mich freut und verbringe gute zwanzig Minuten damit, auf dem Bett herumzuspringen und ein Bild zu machen. Gar nicht so einfach. Und ziemlich anstrengend. Hätte ich gar nicht gedacht. Macht aber unglaublich viel Spaß… ok… damit war zu rechnen.